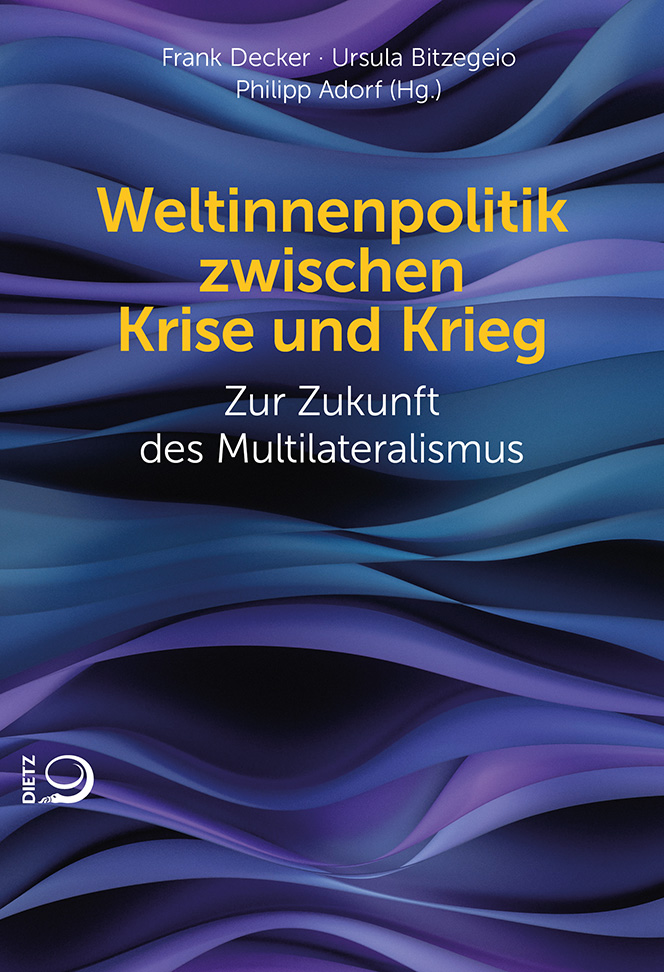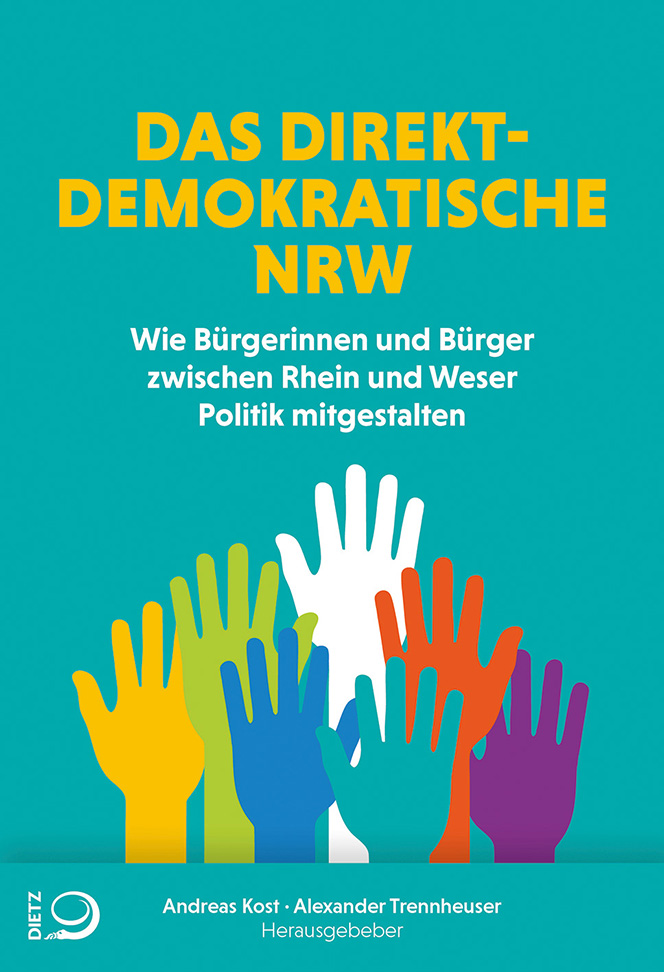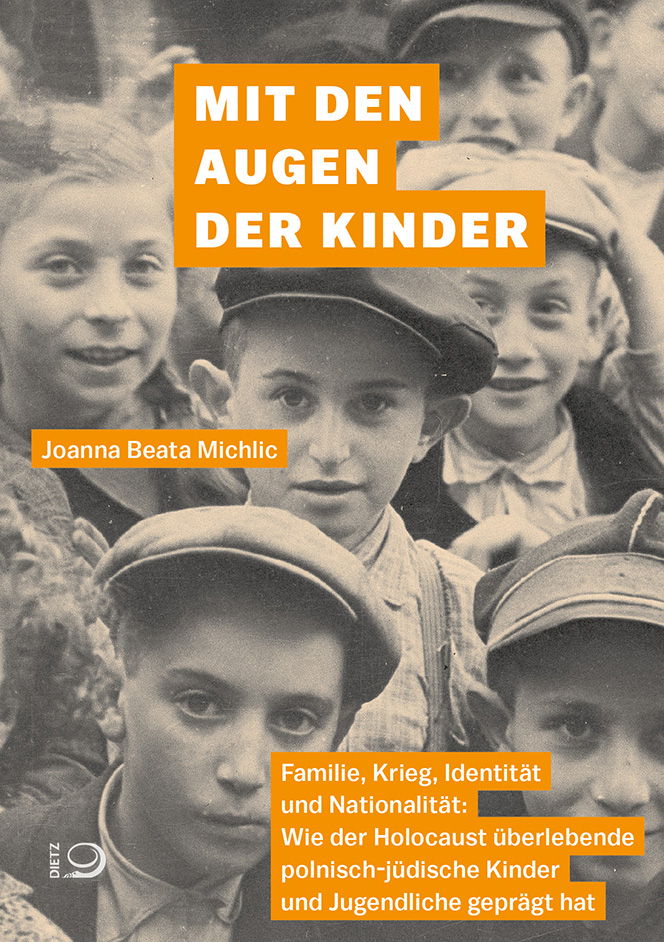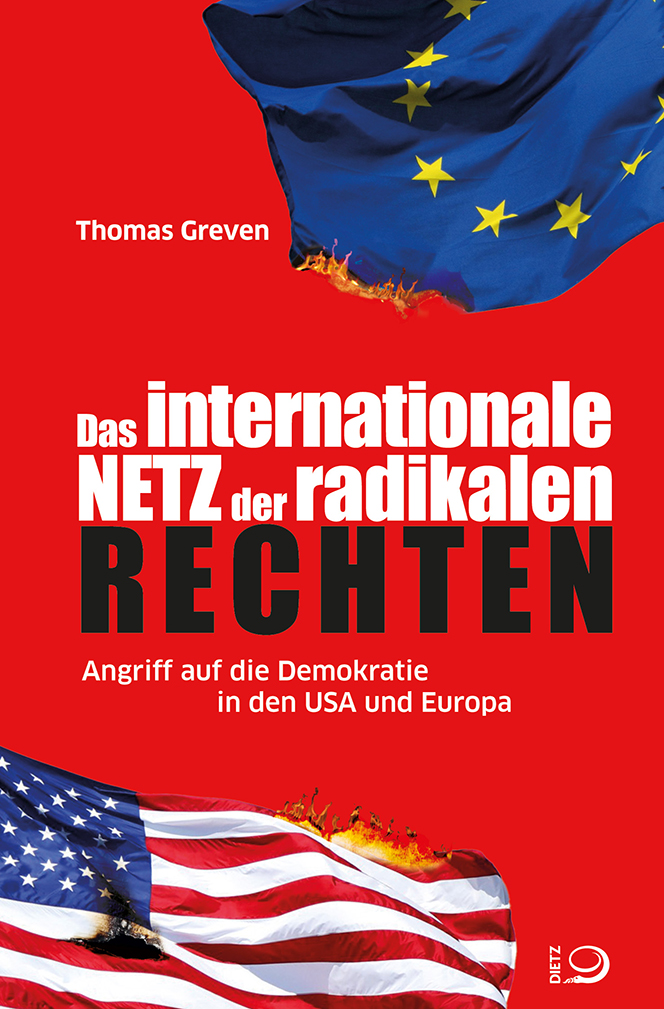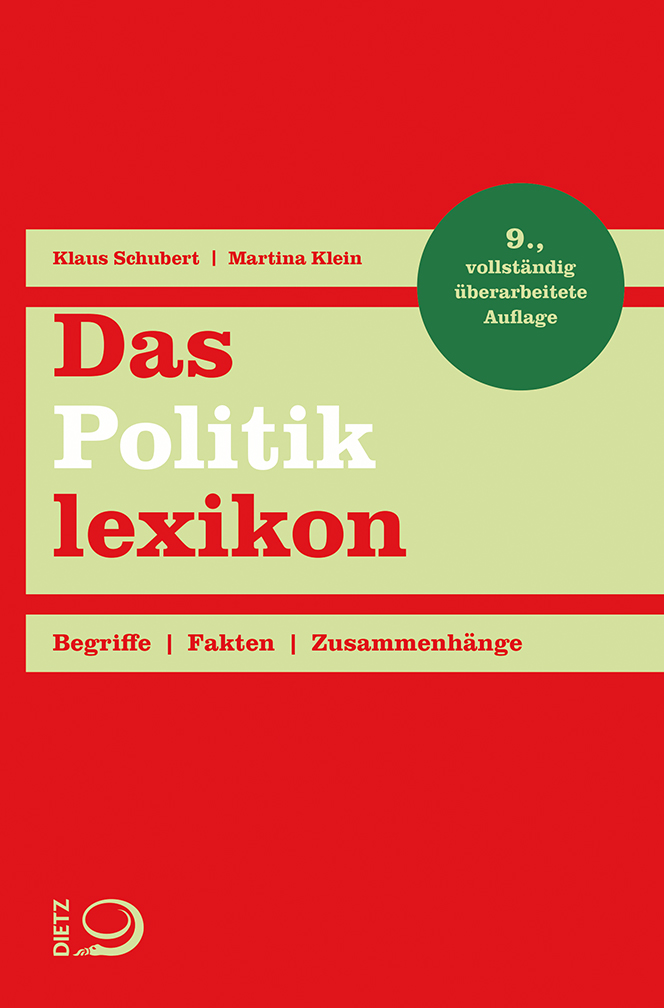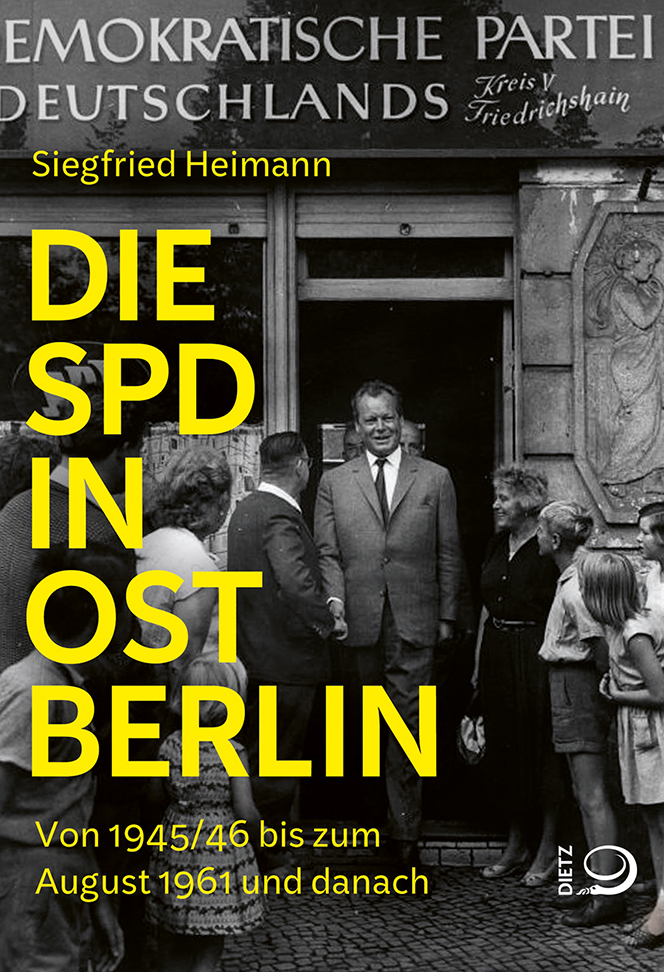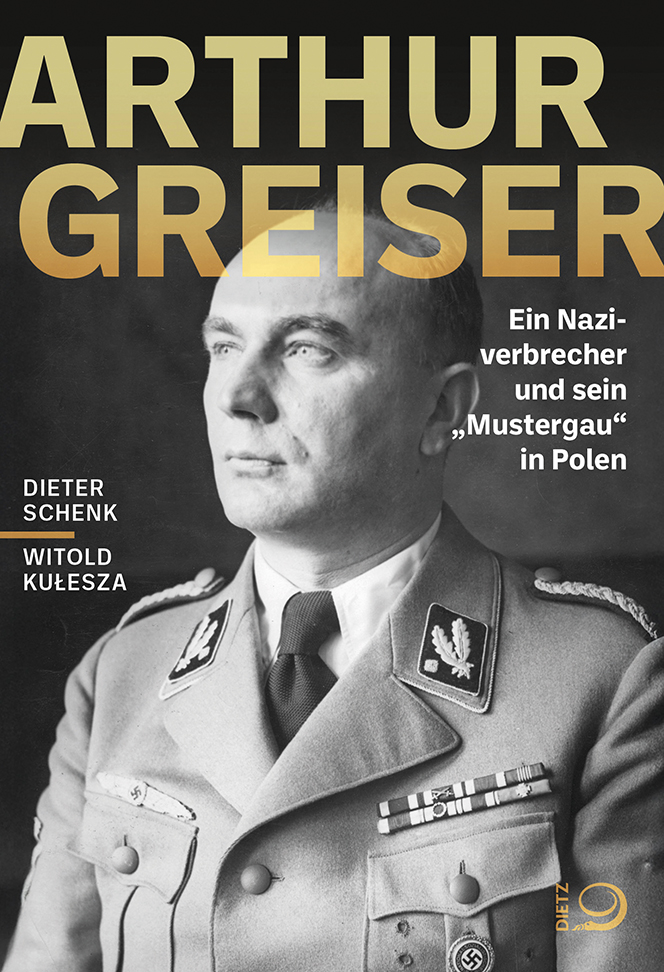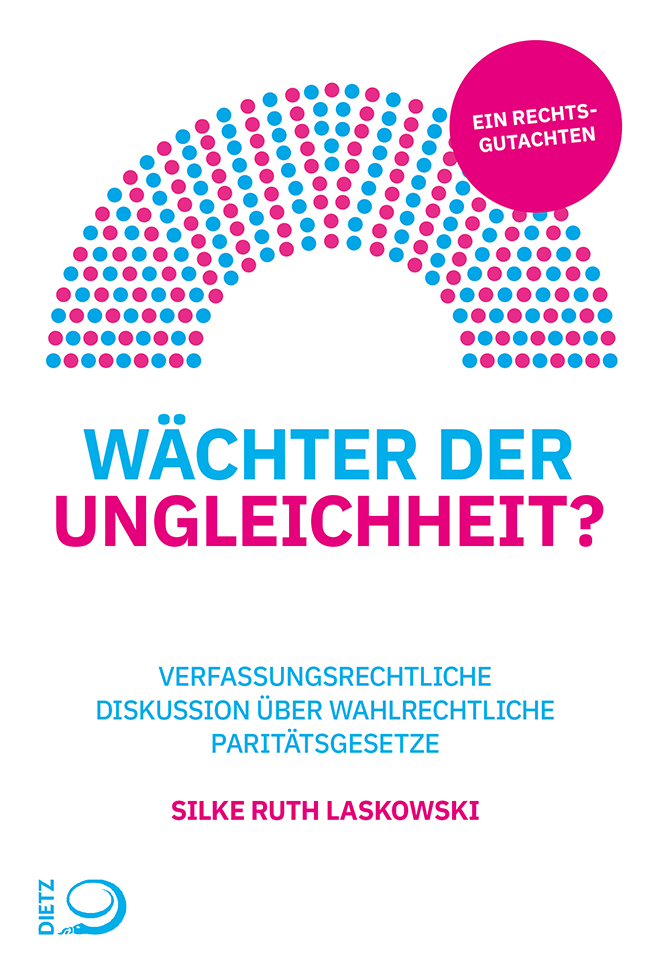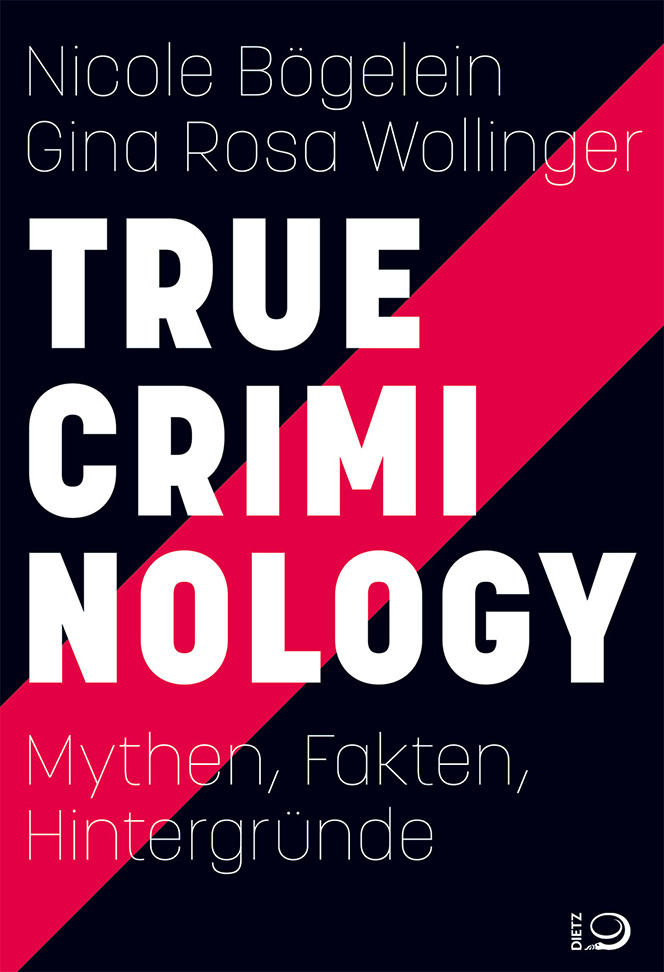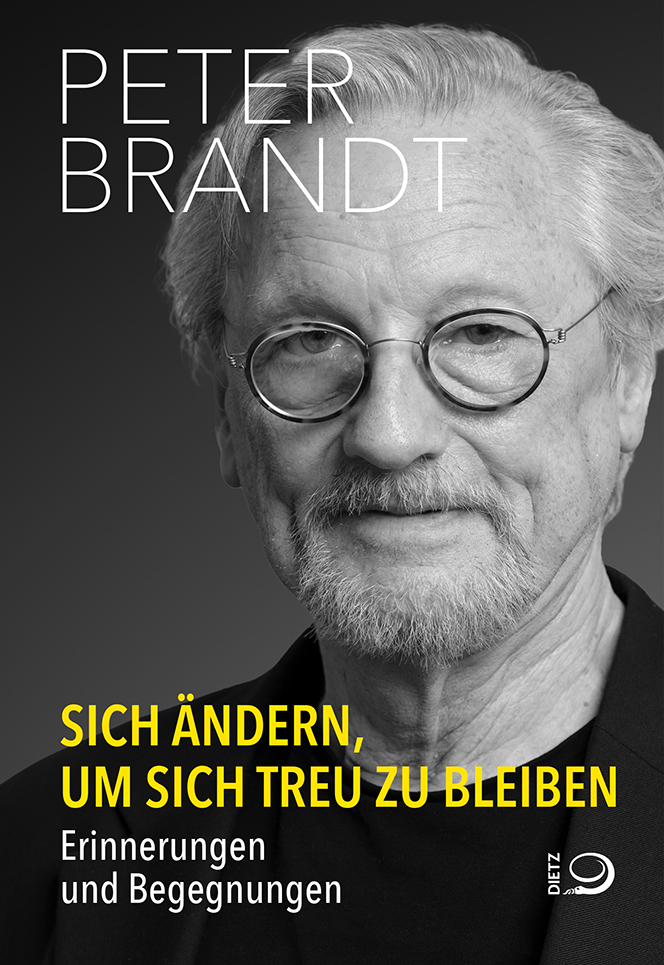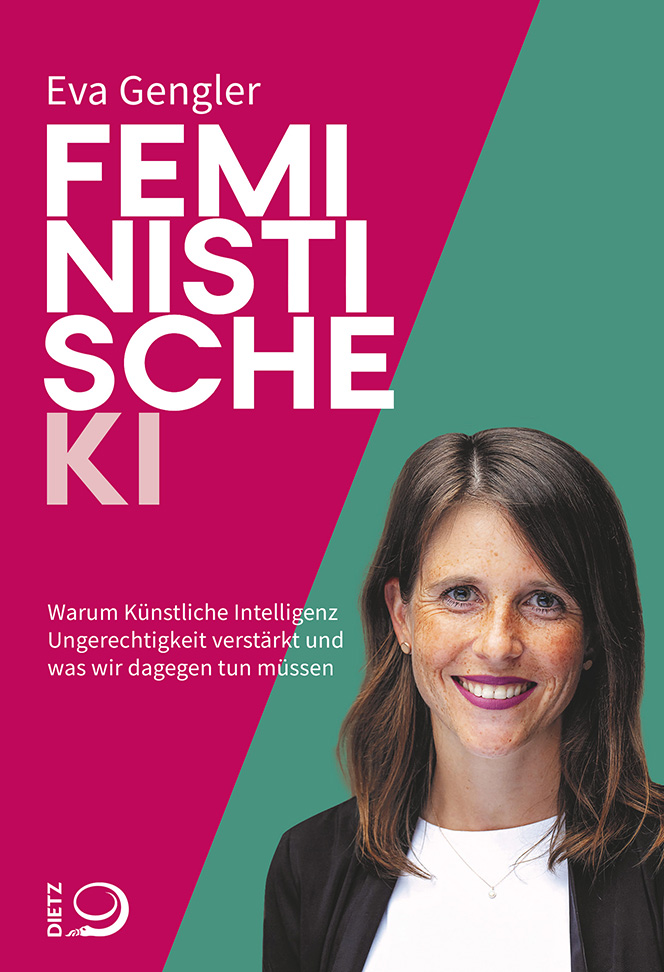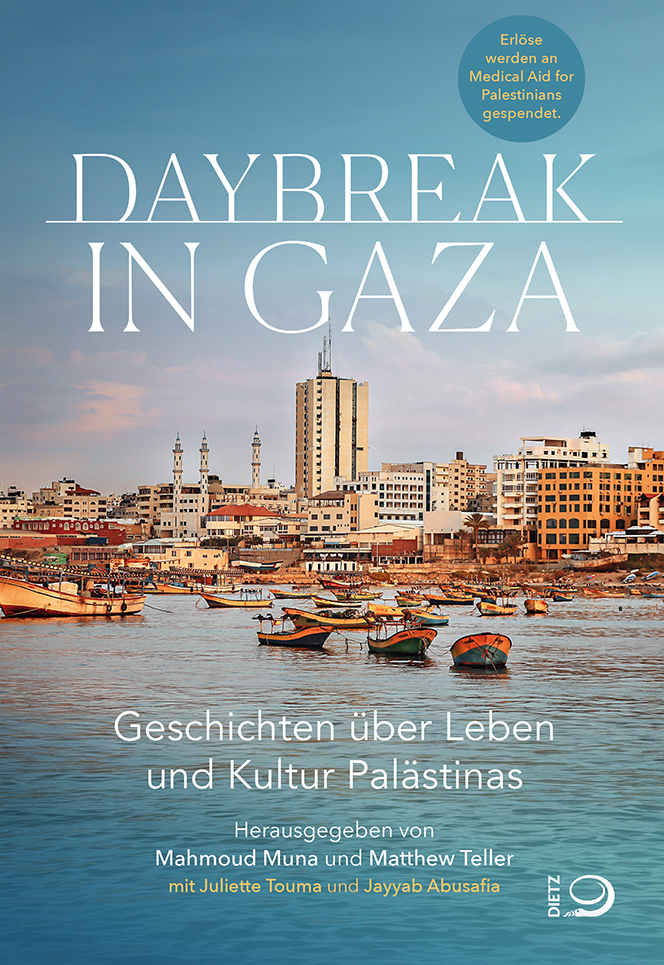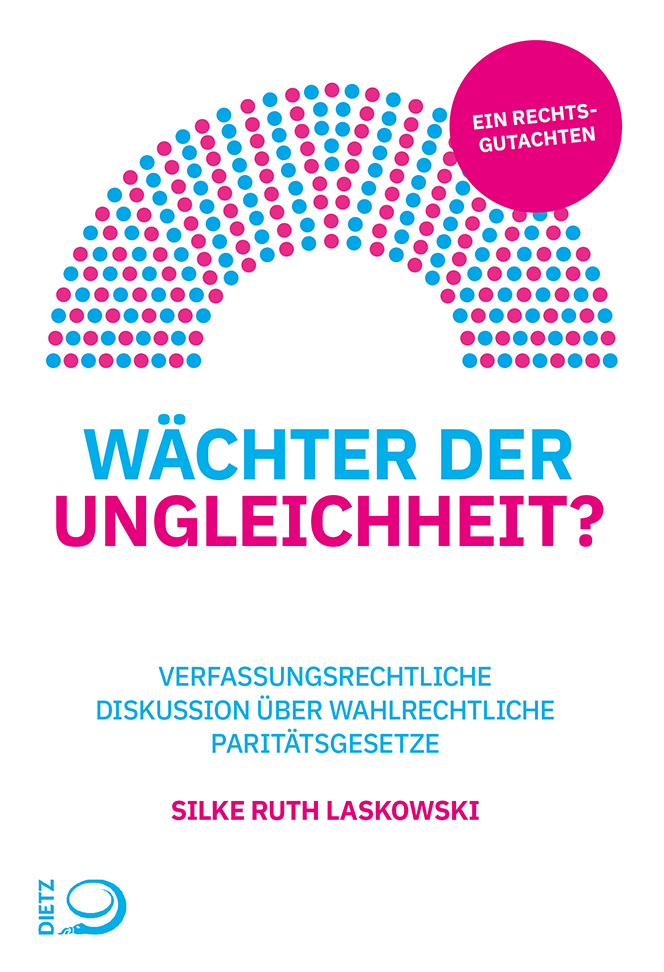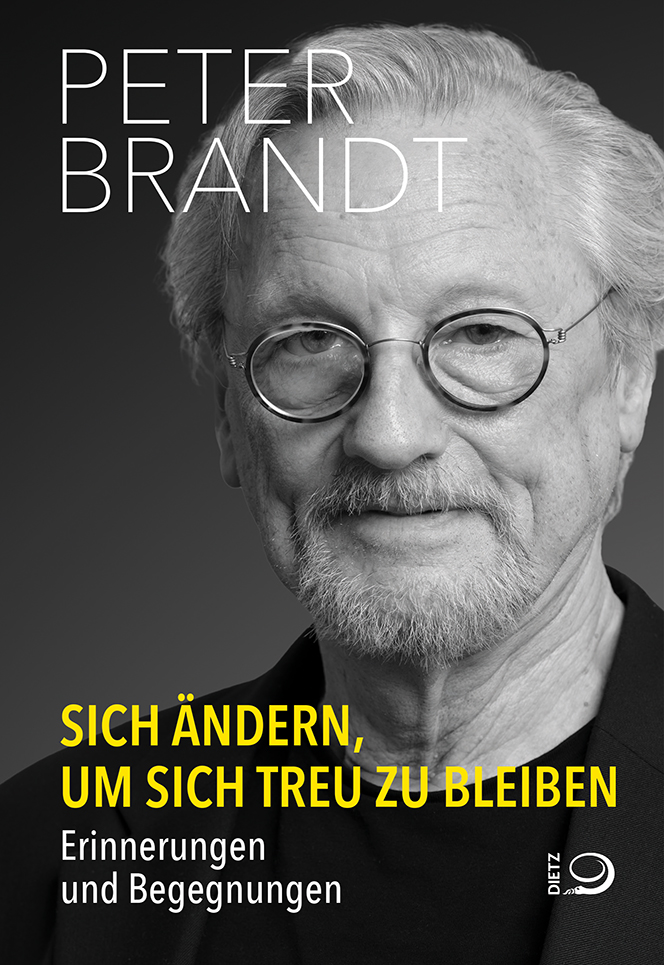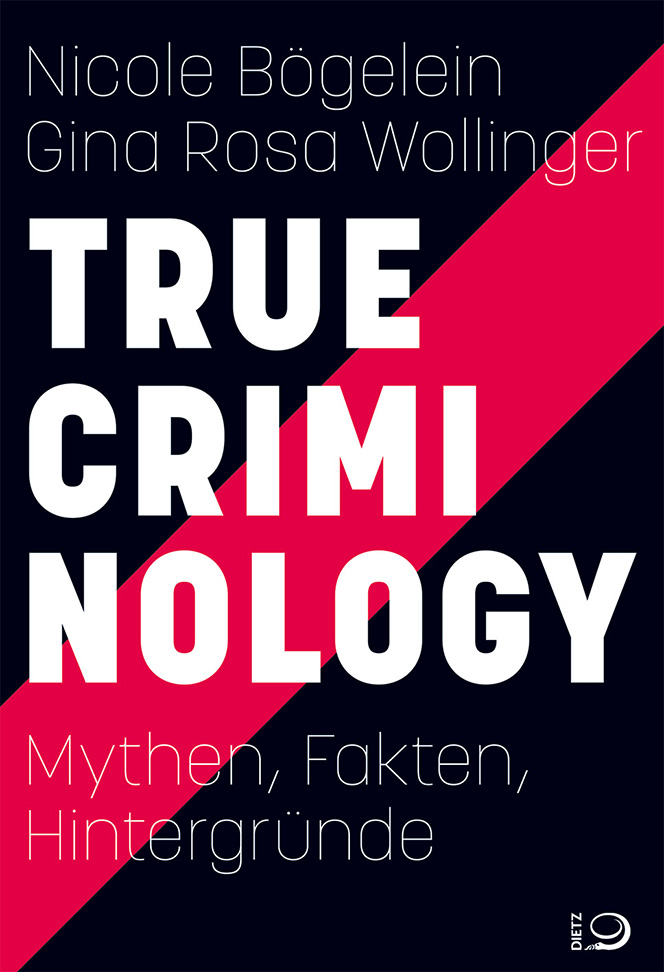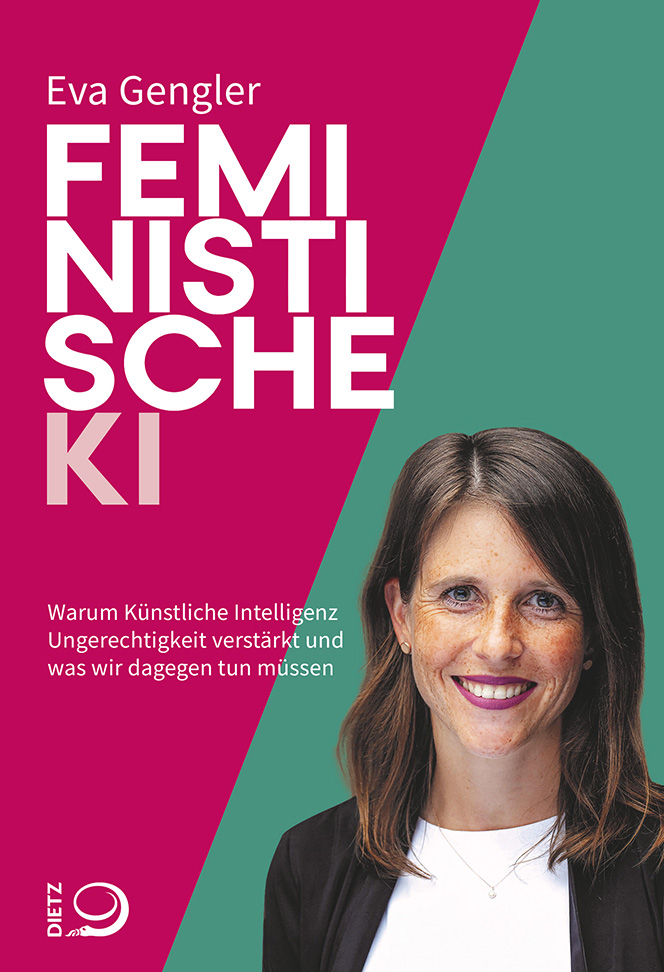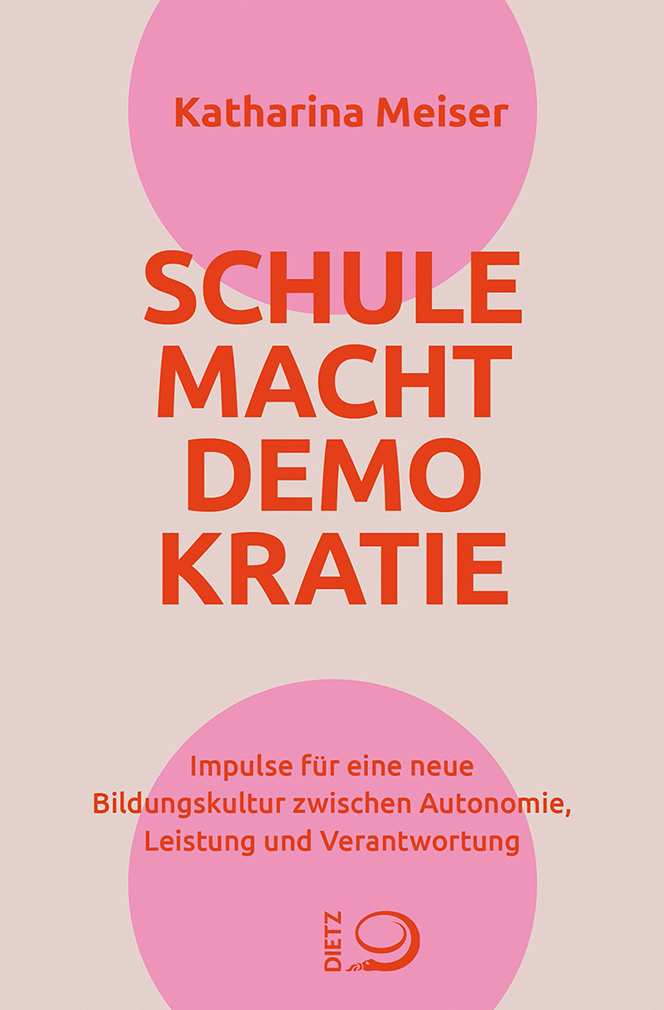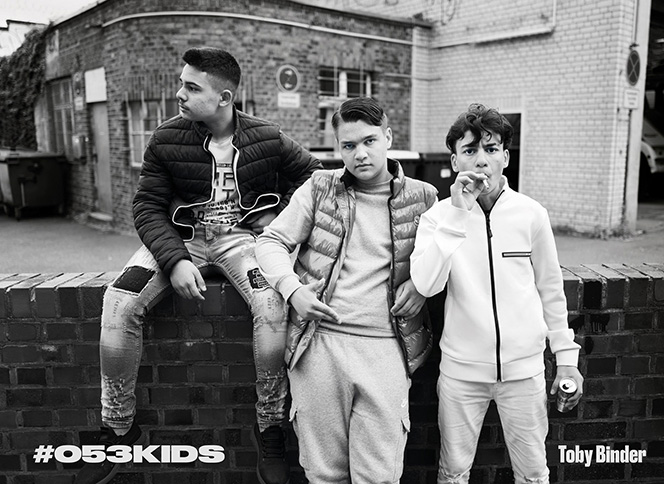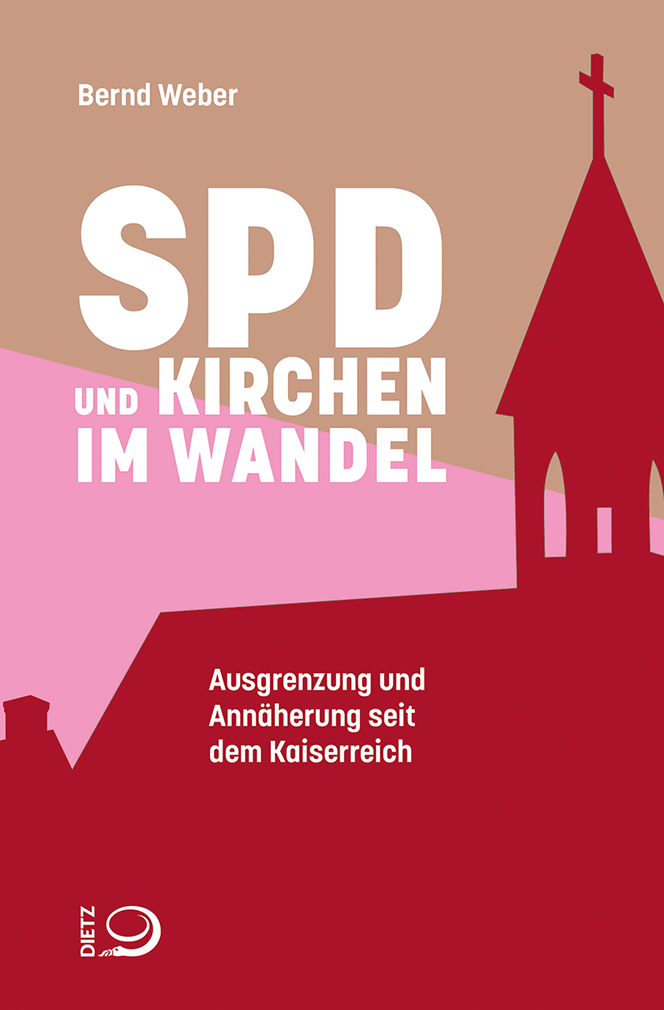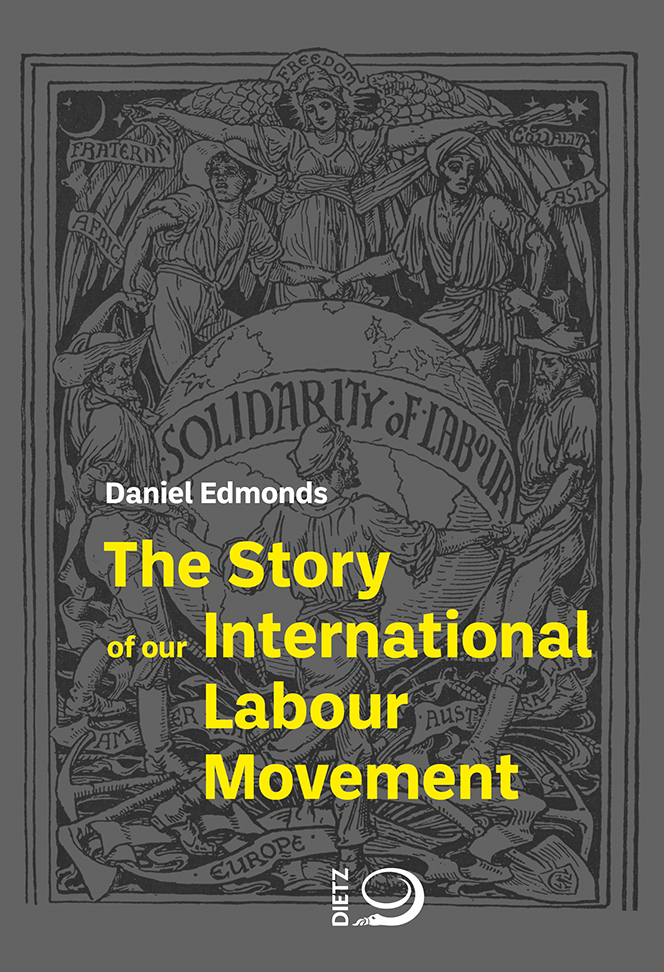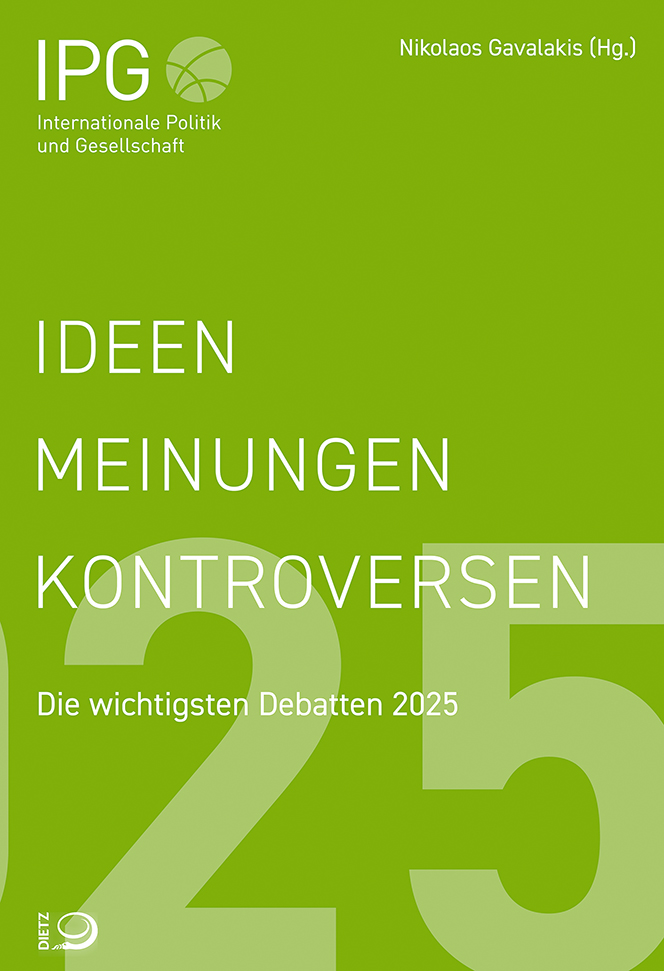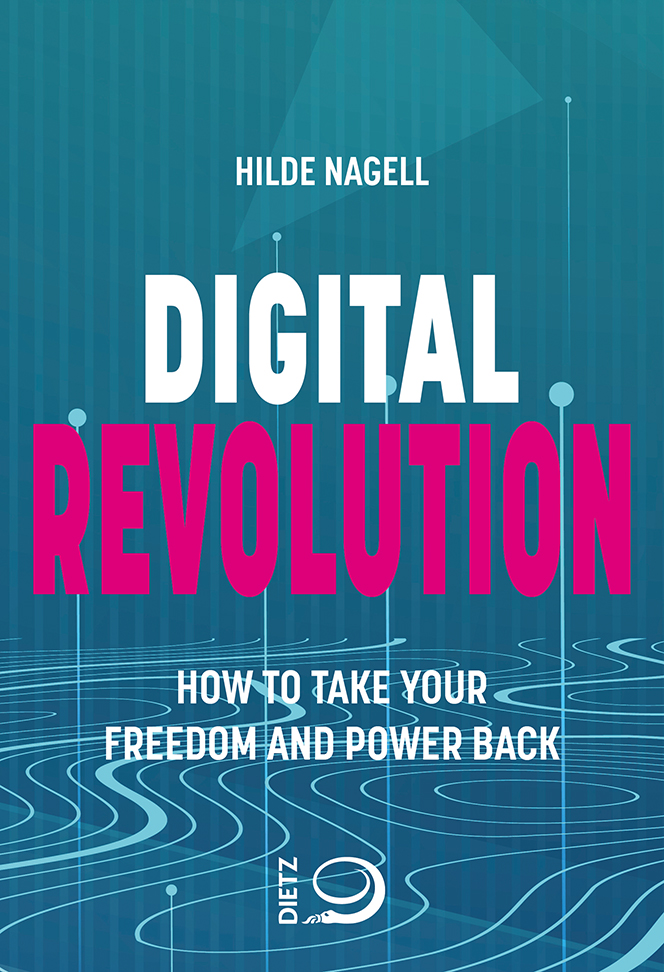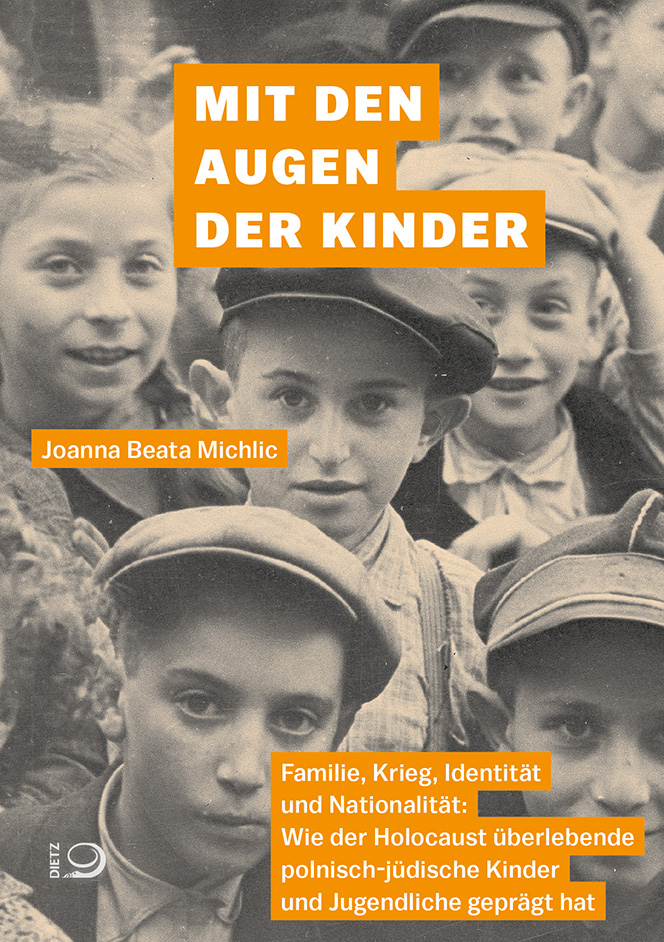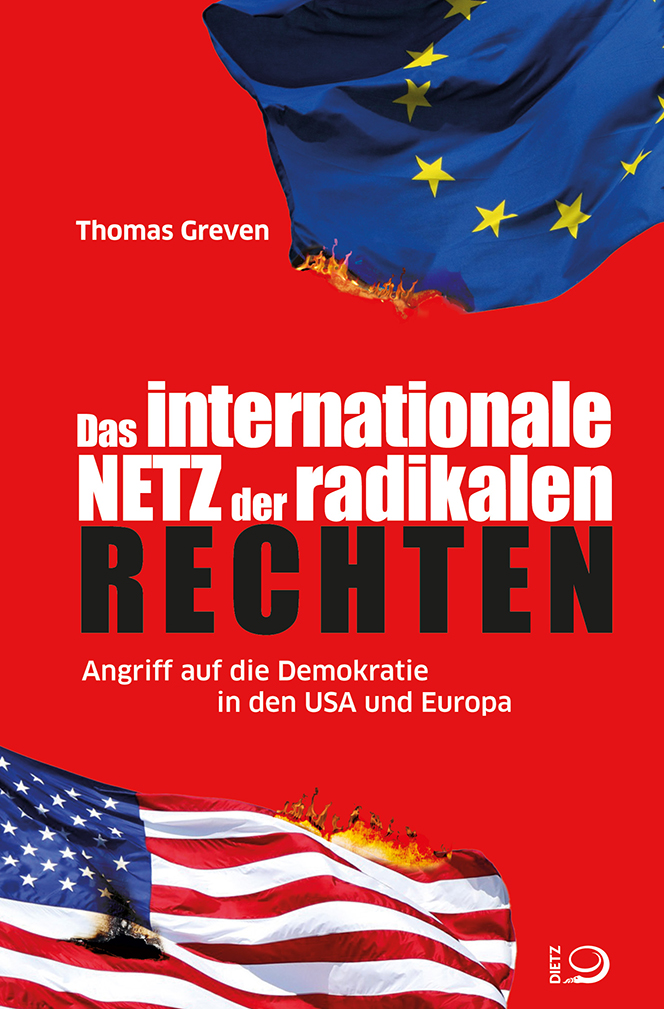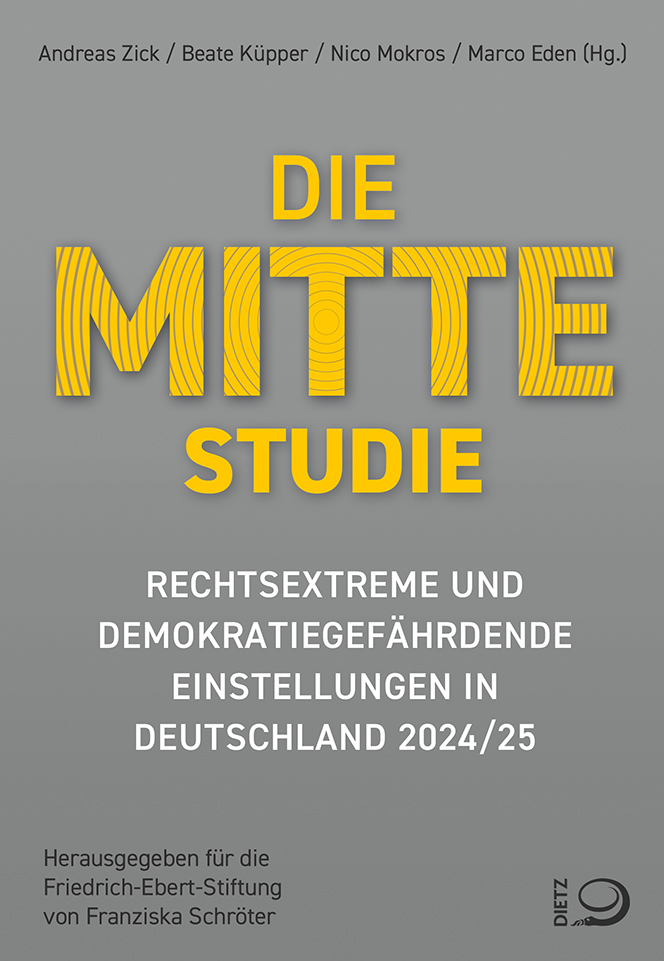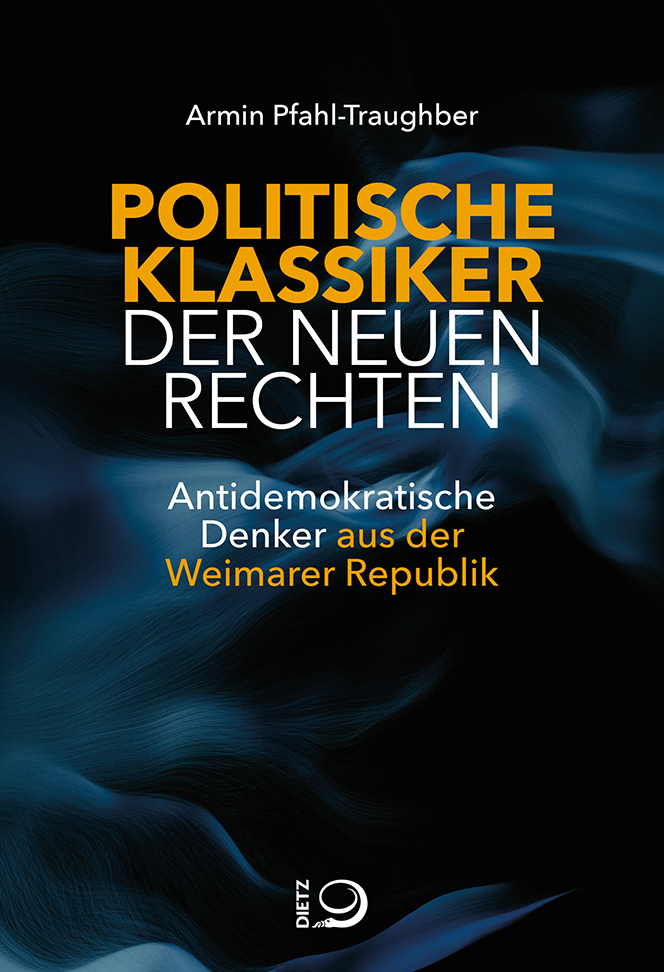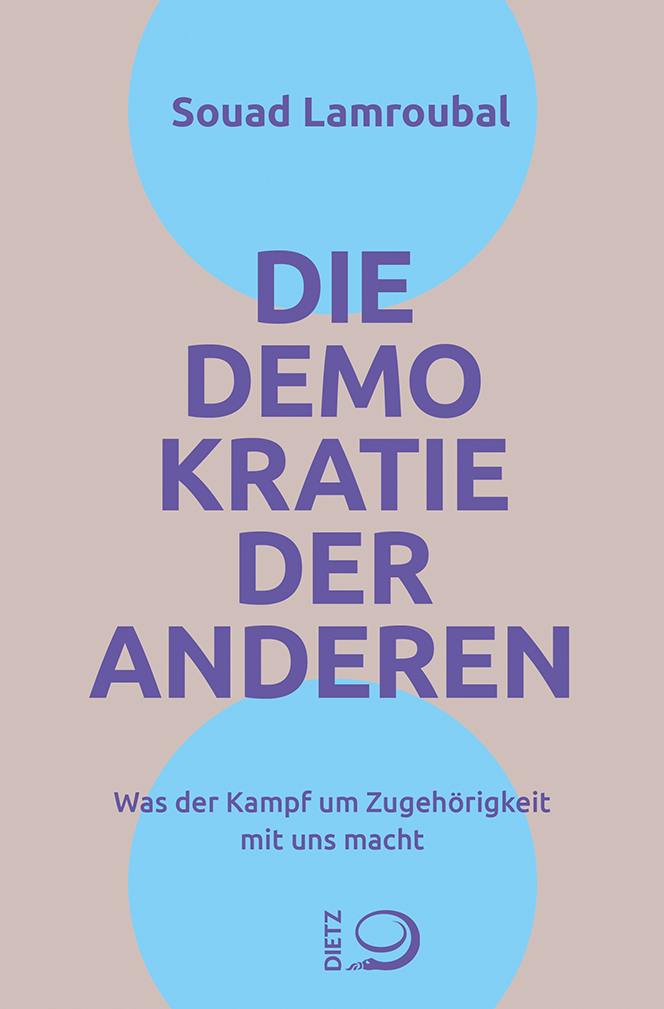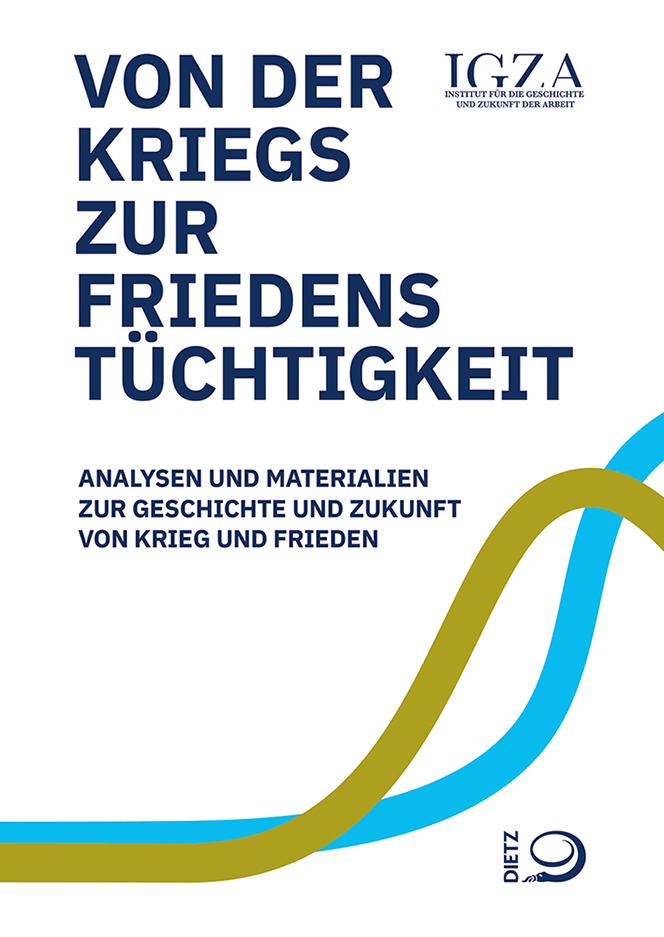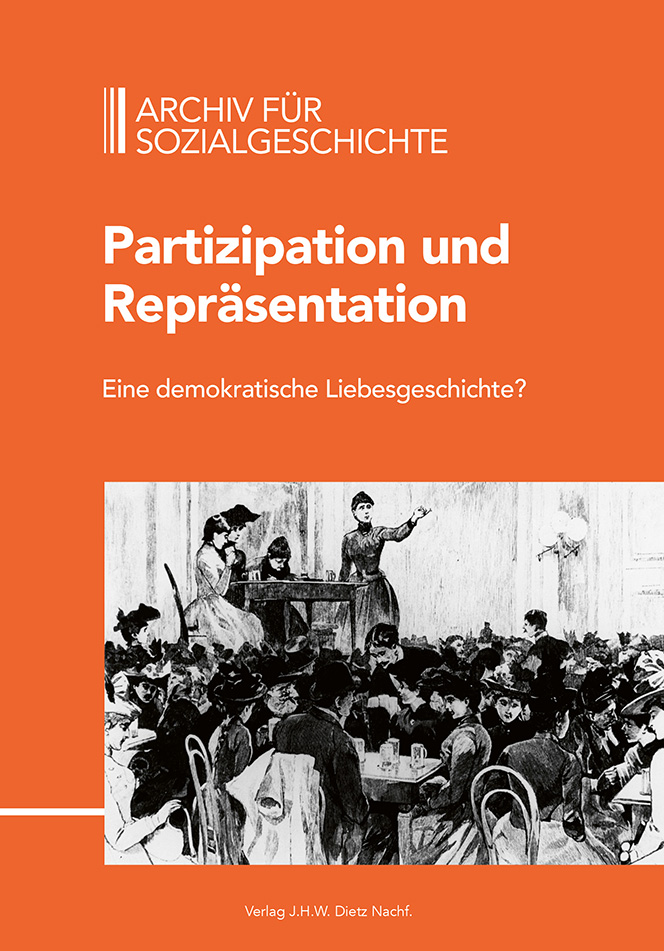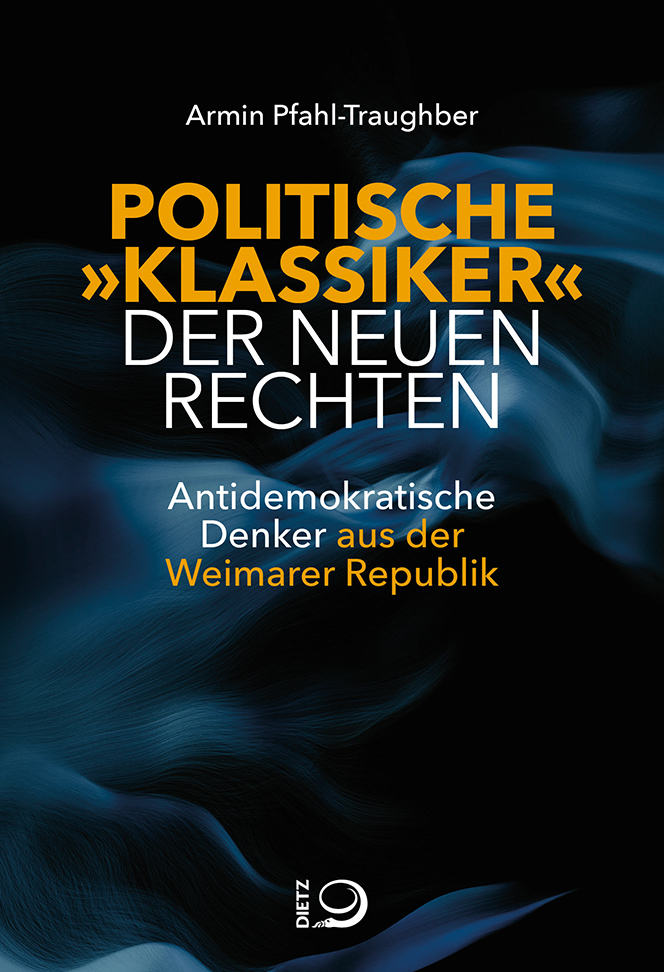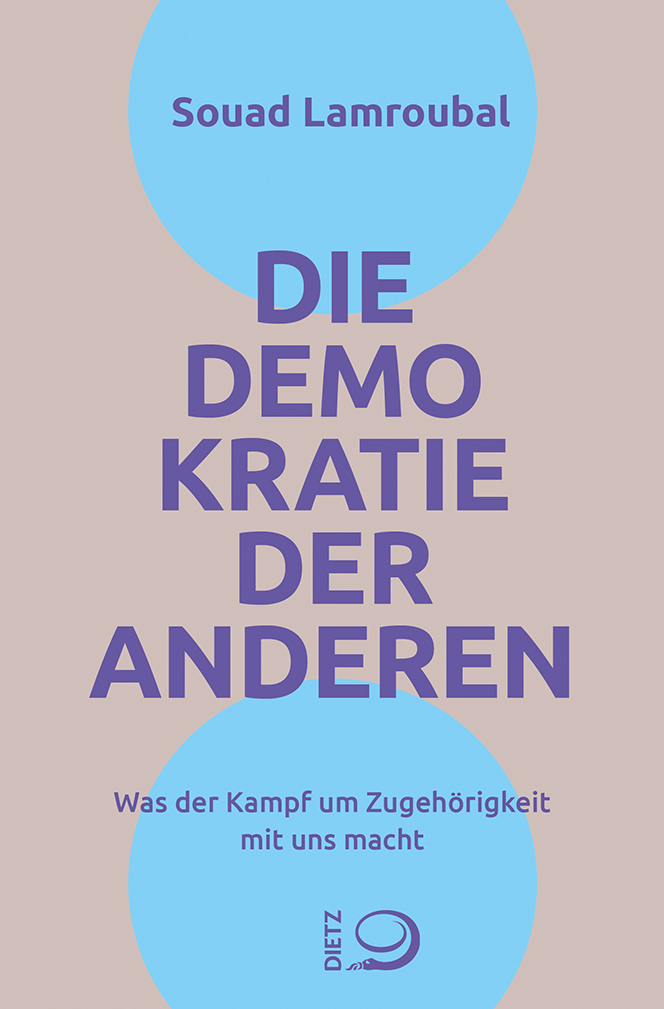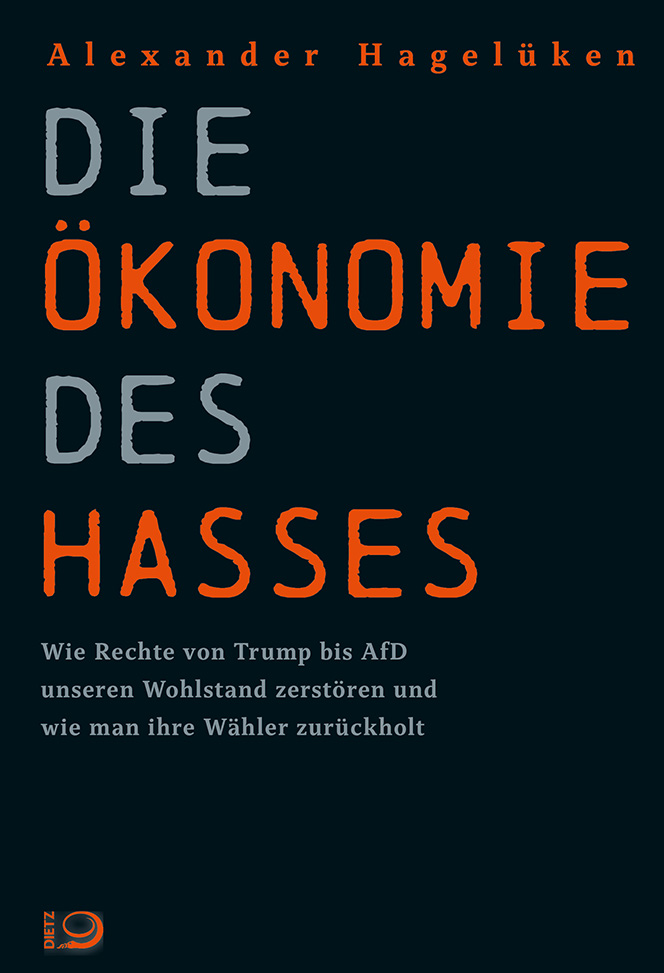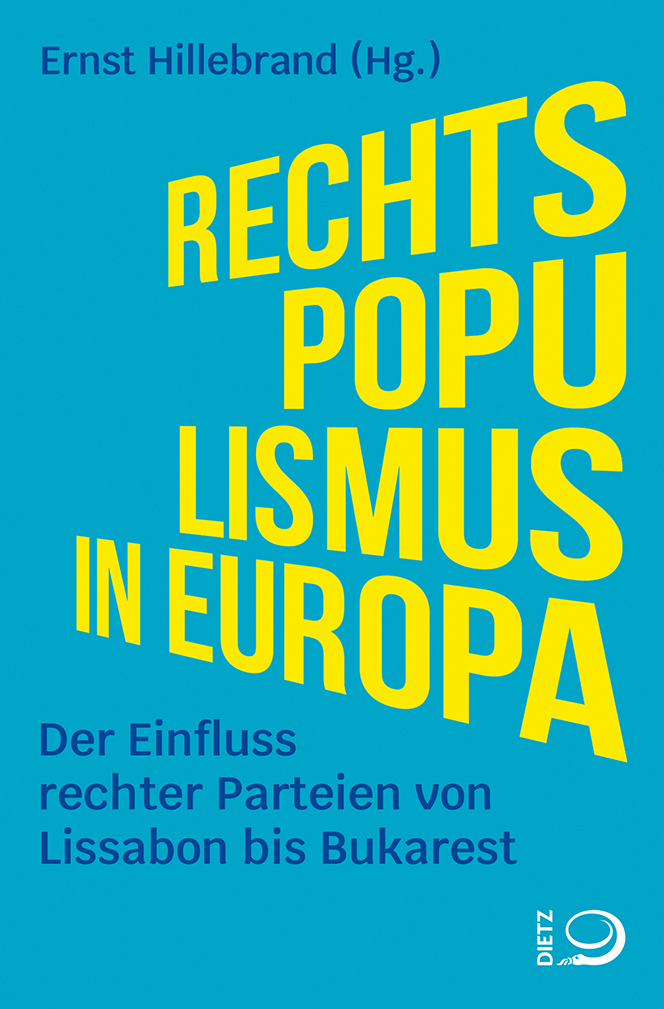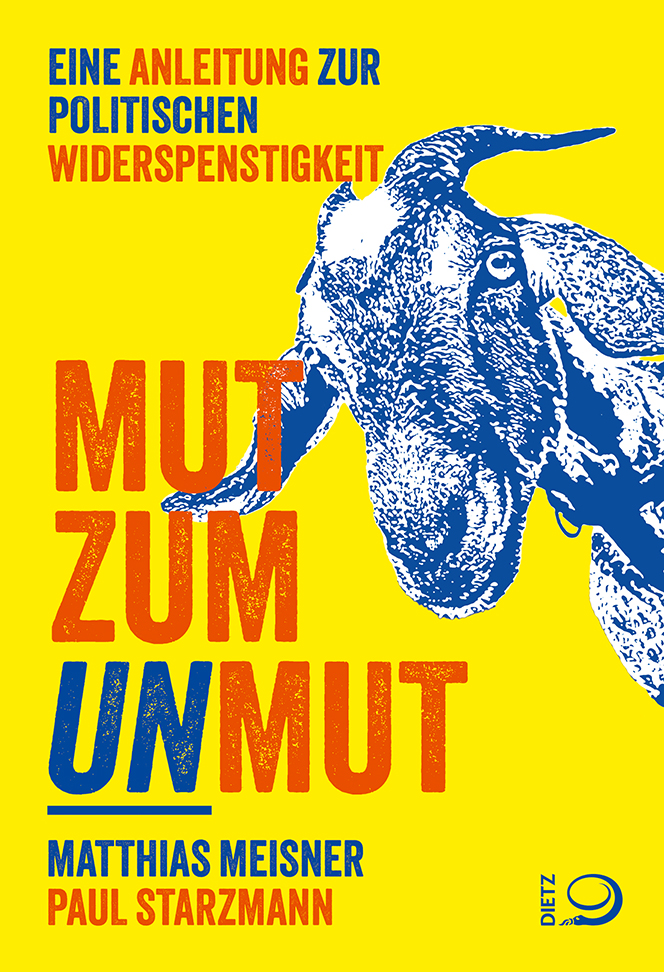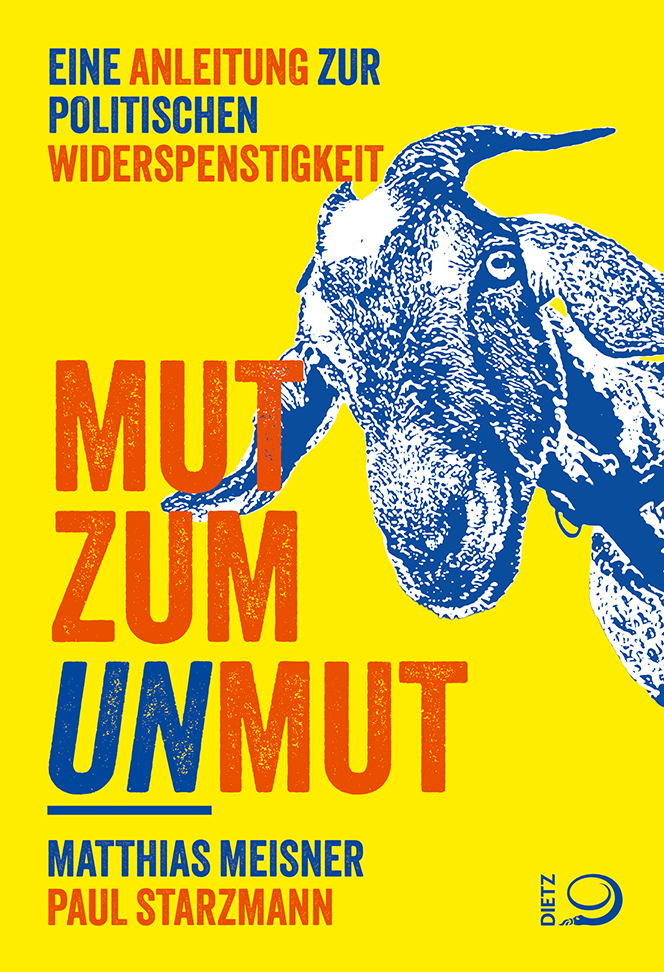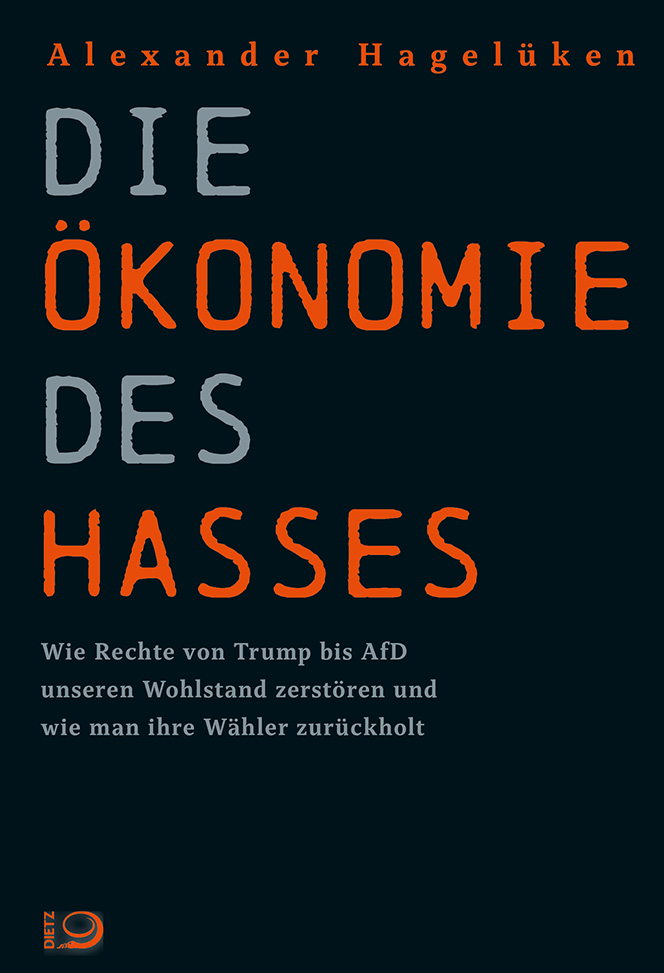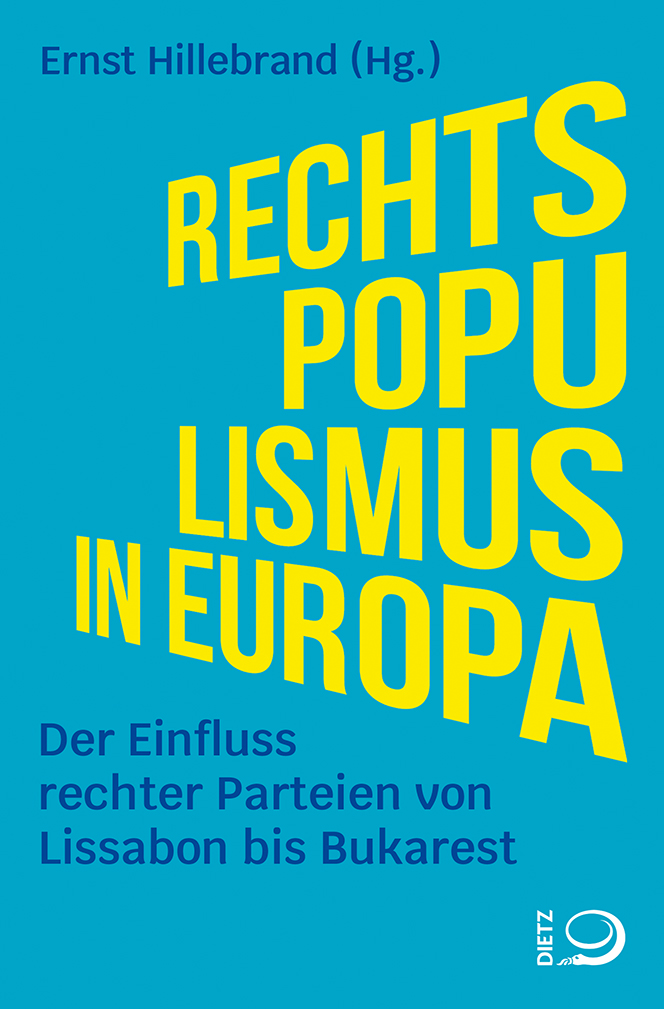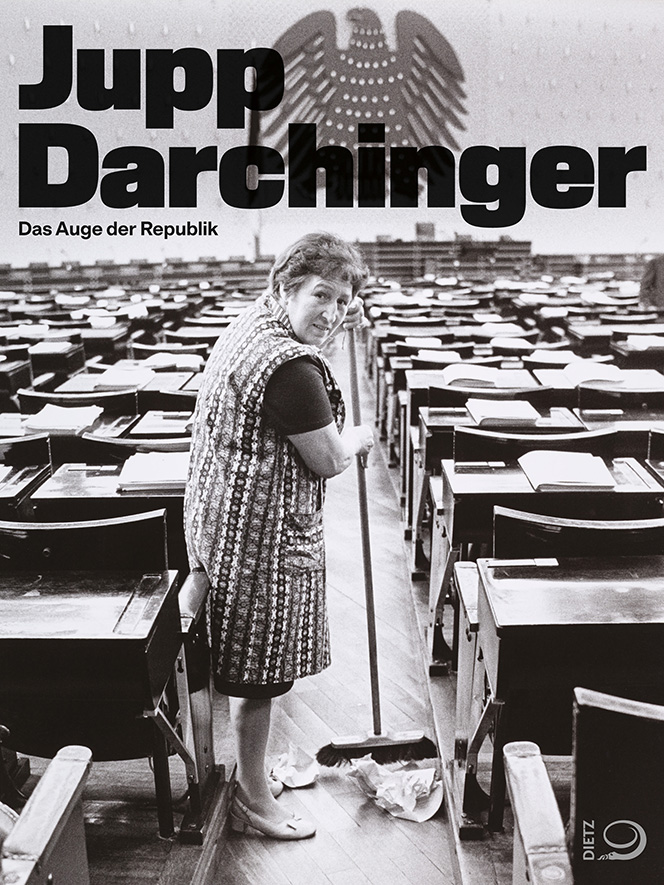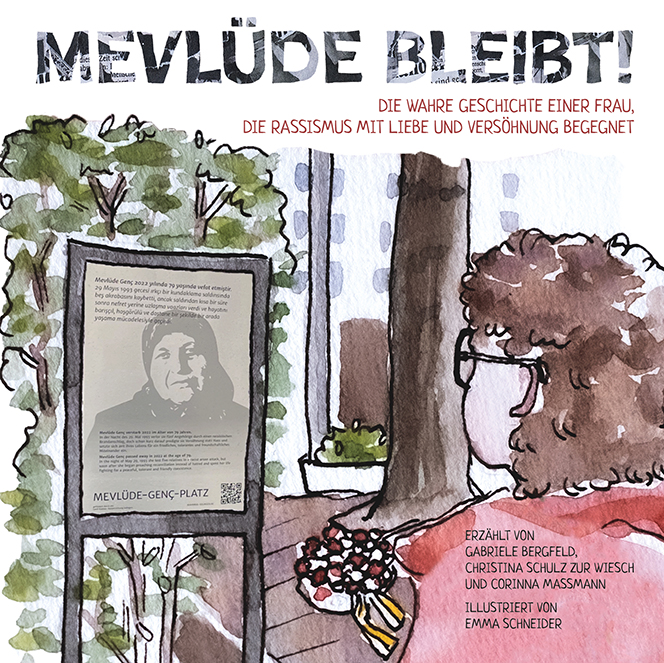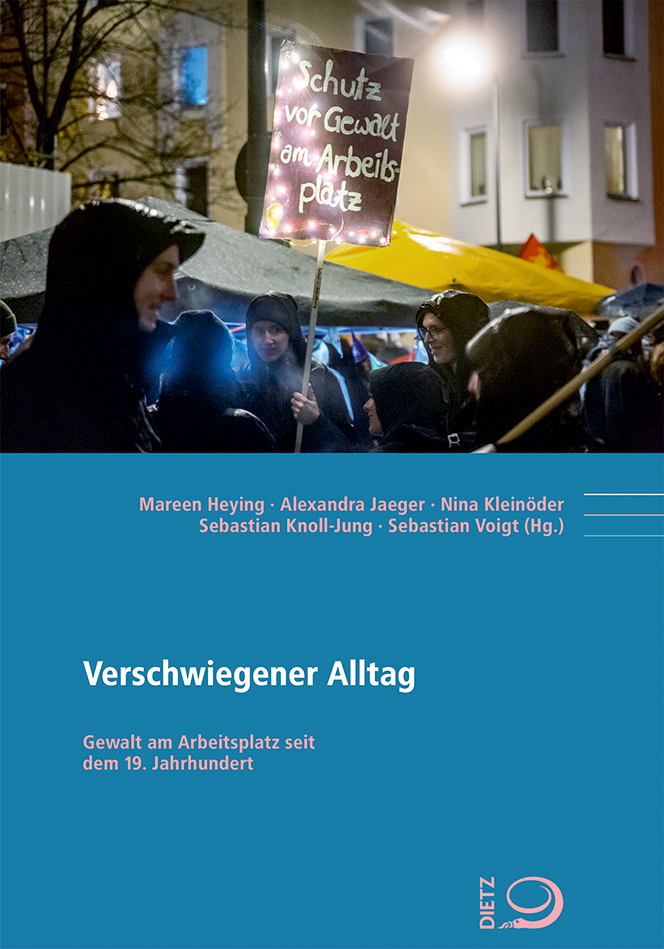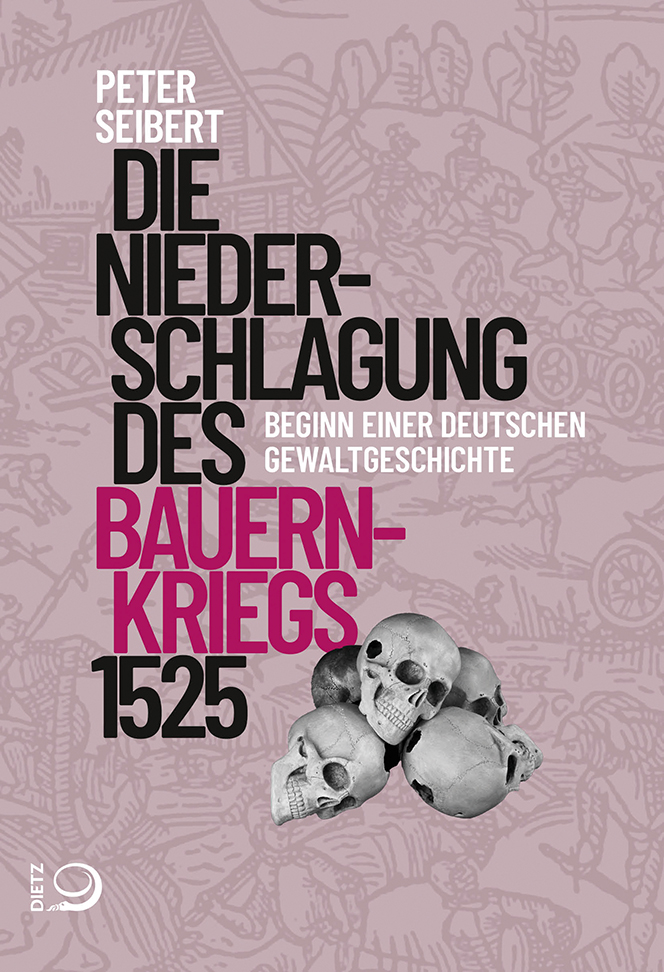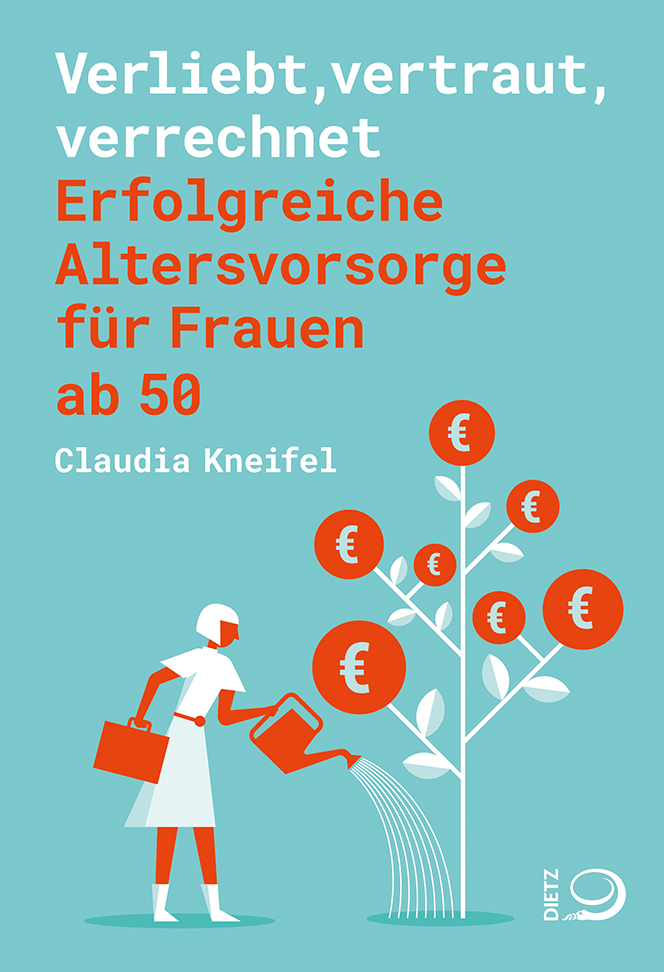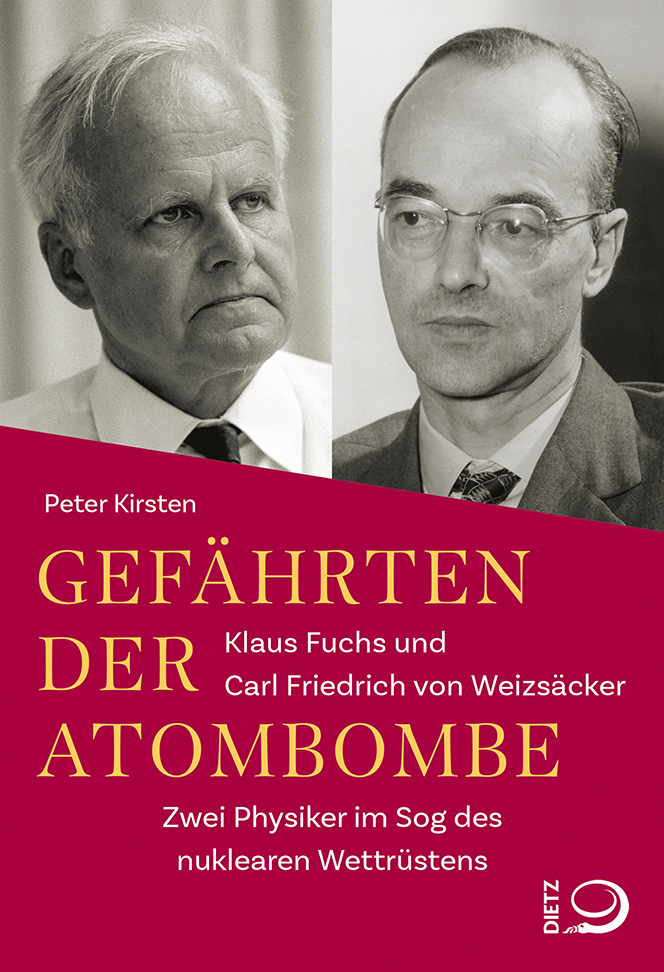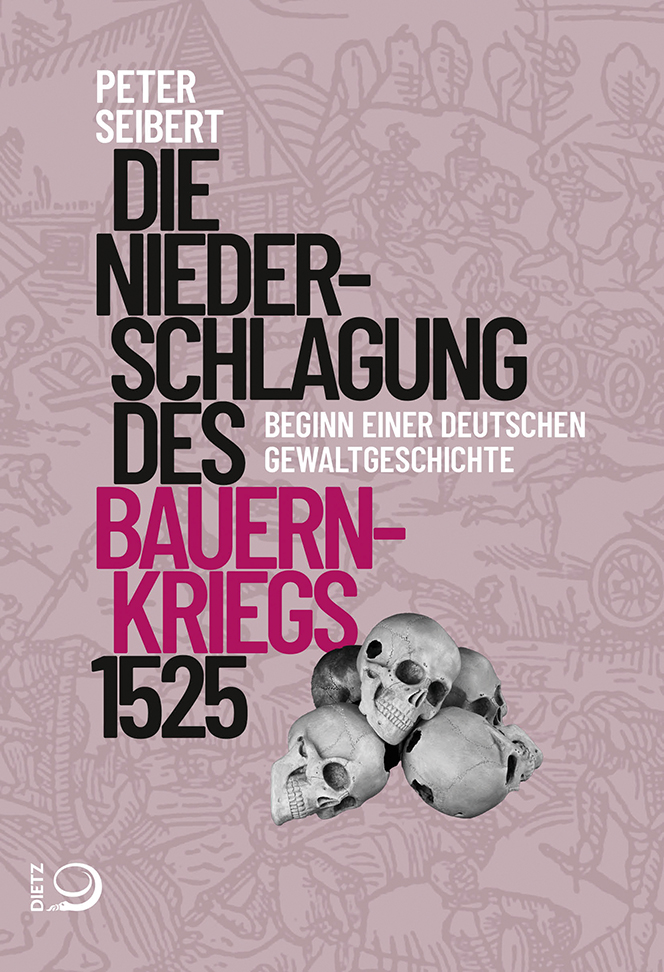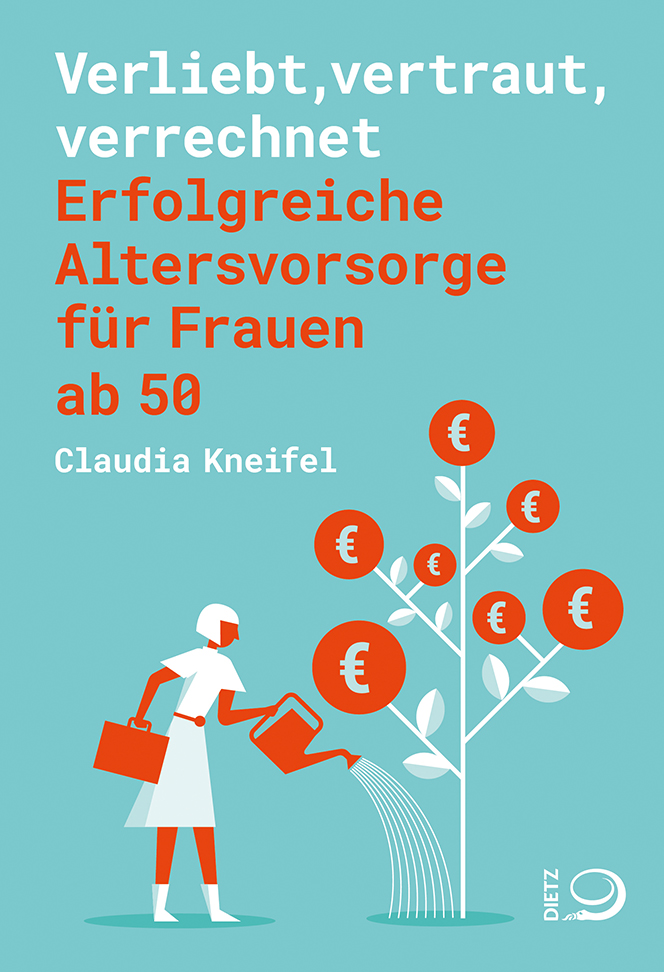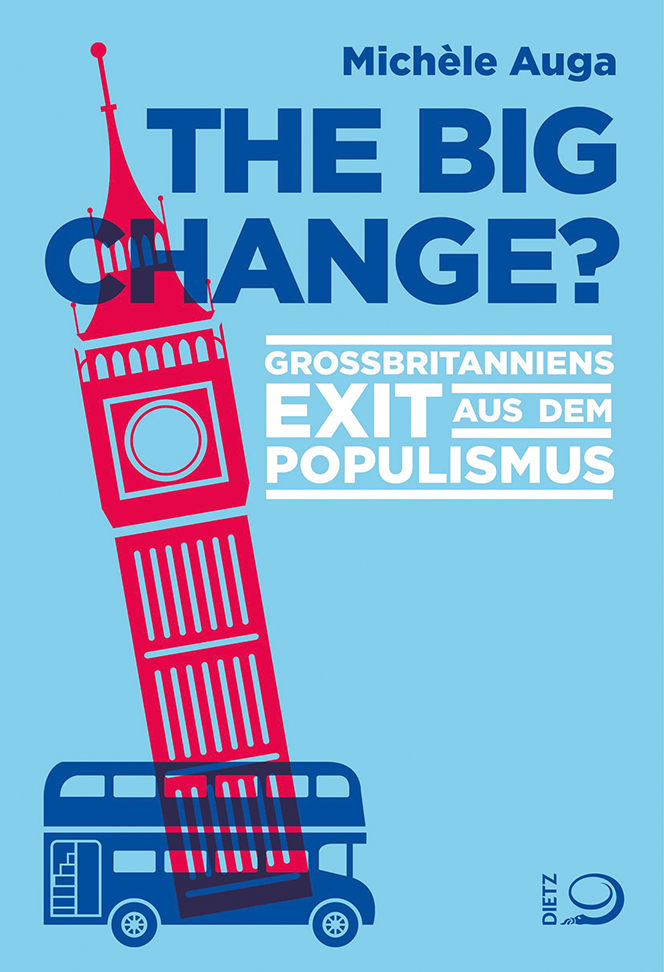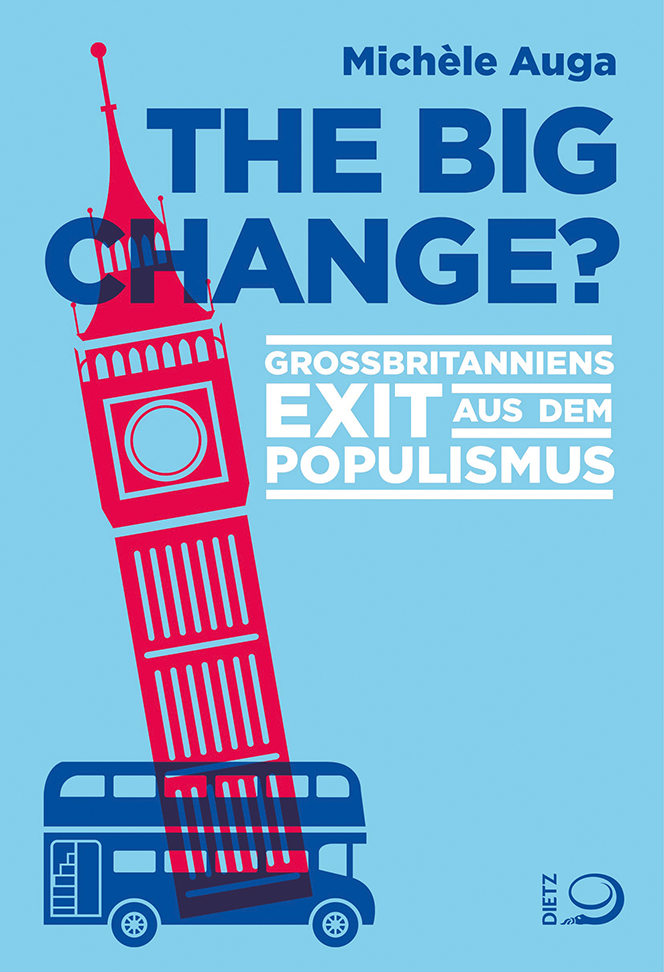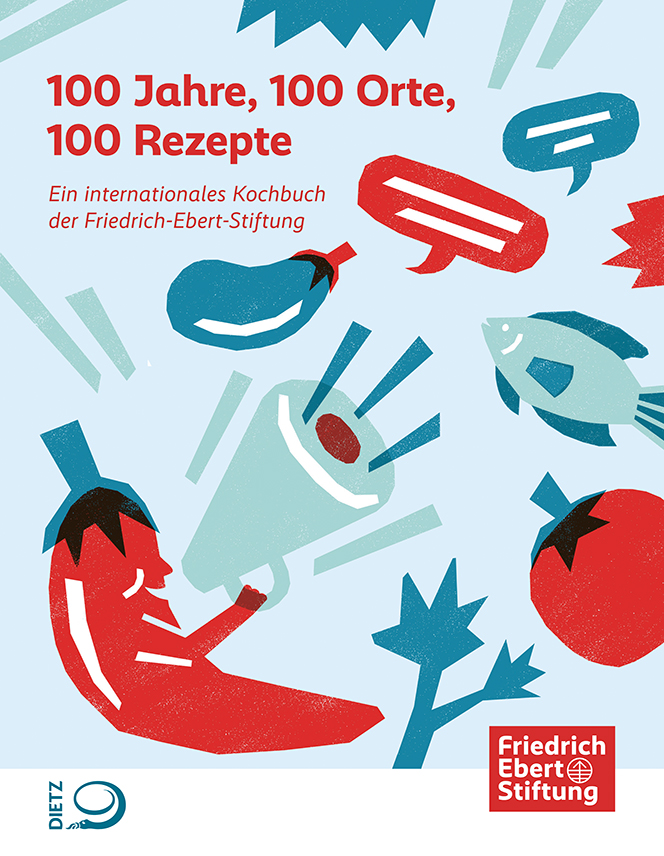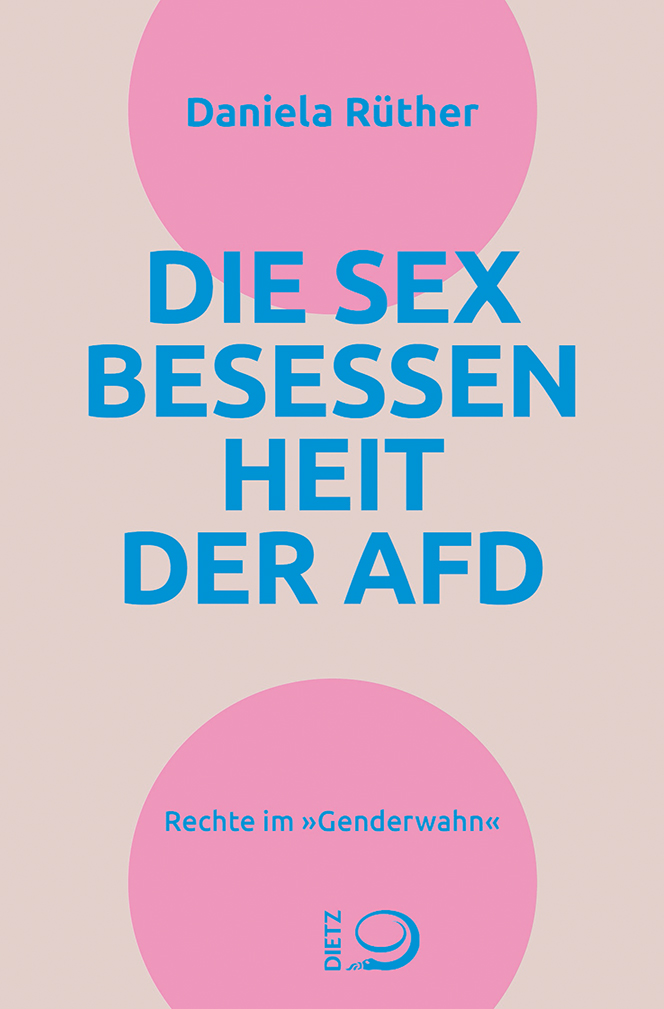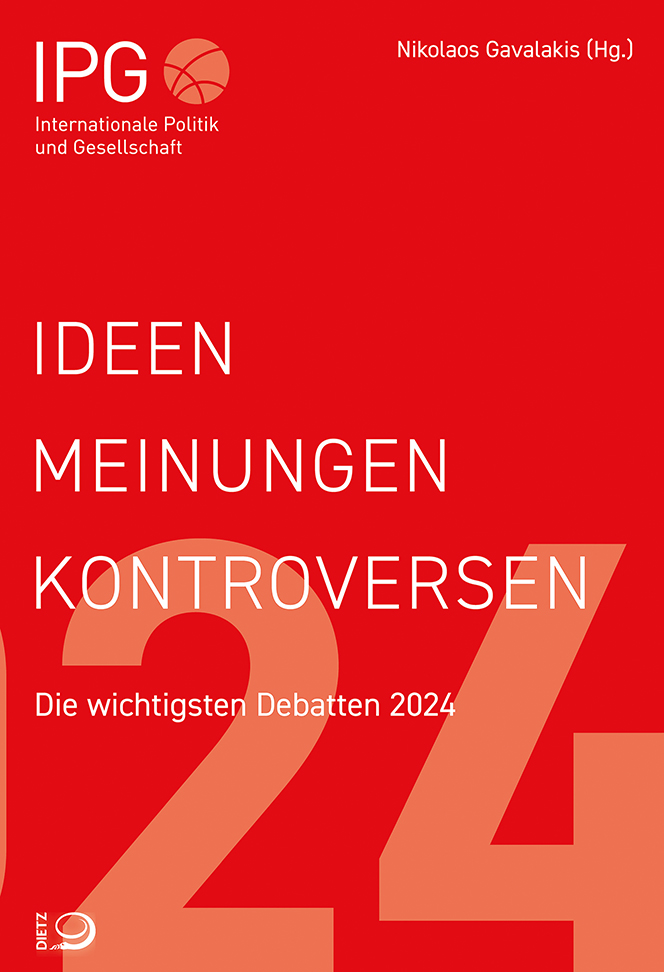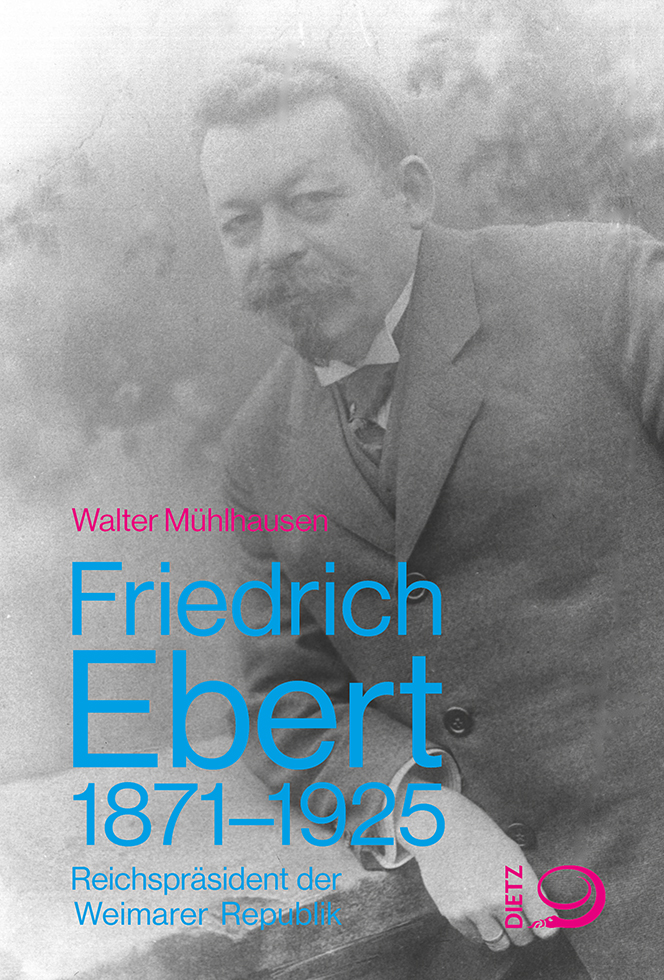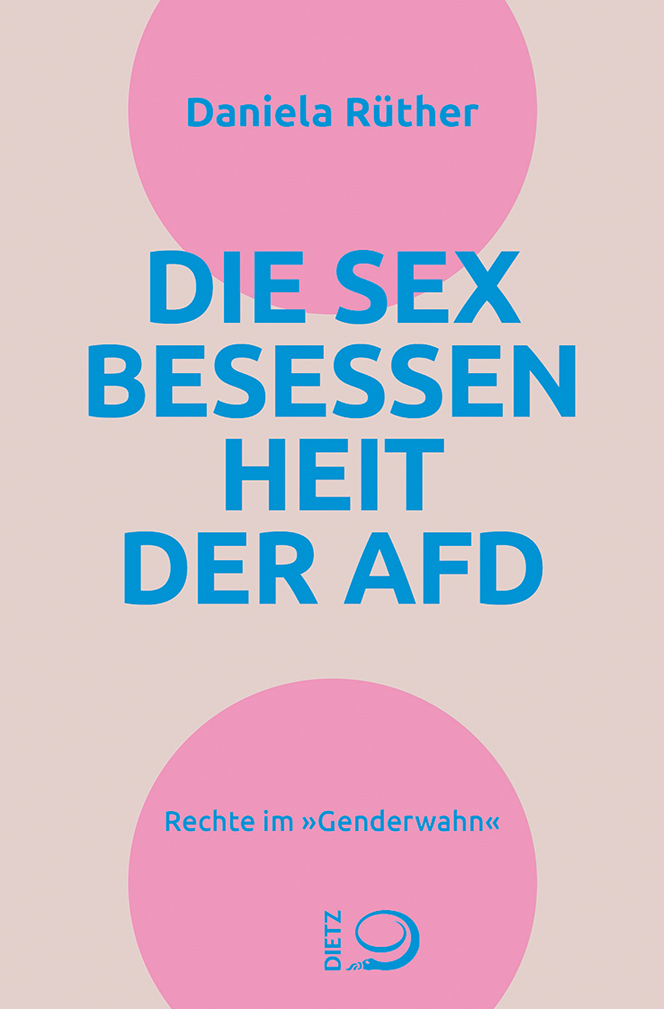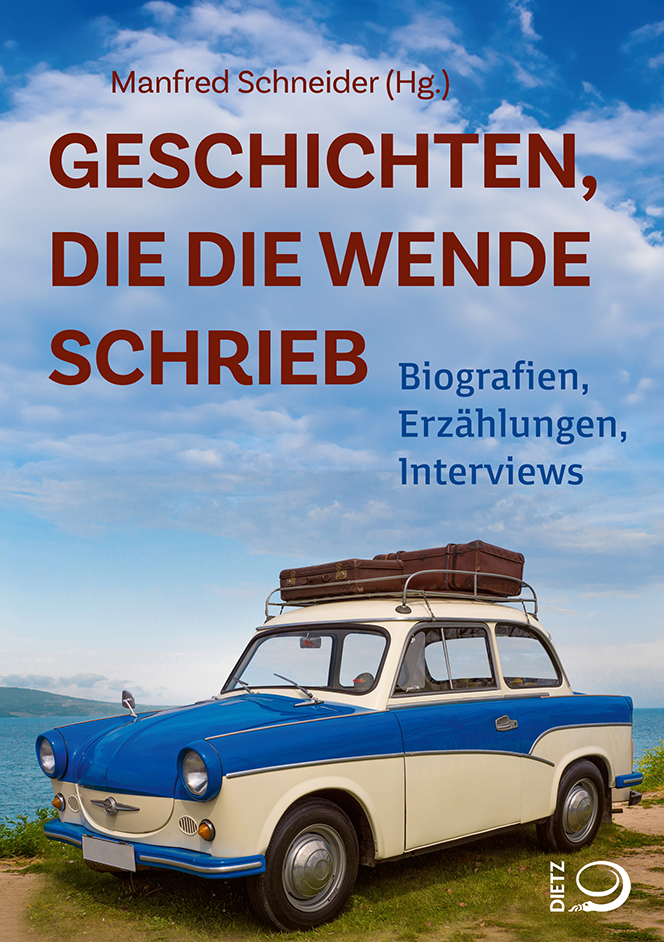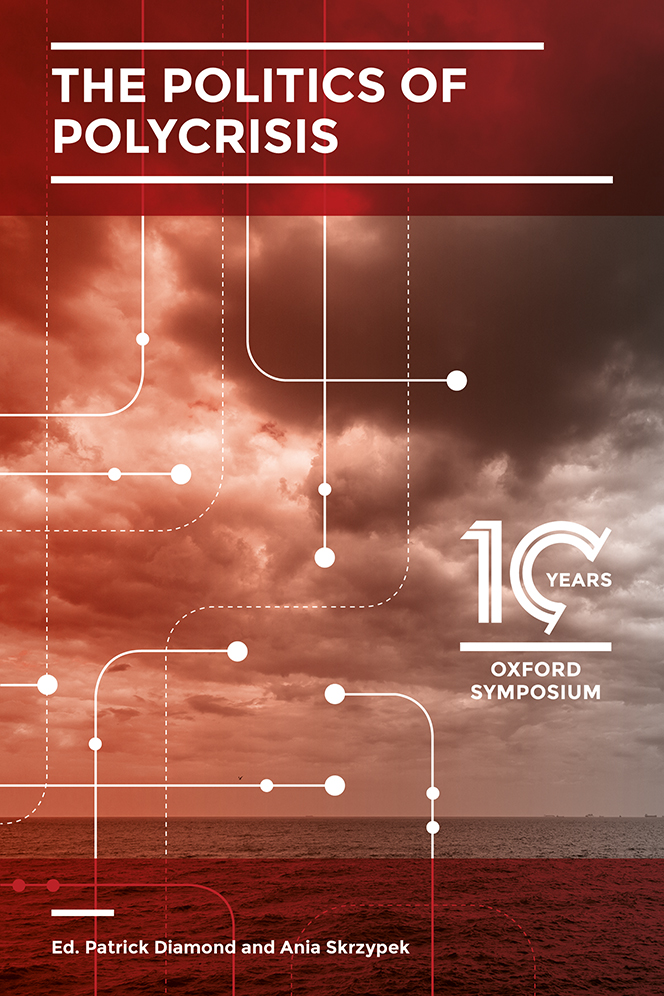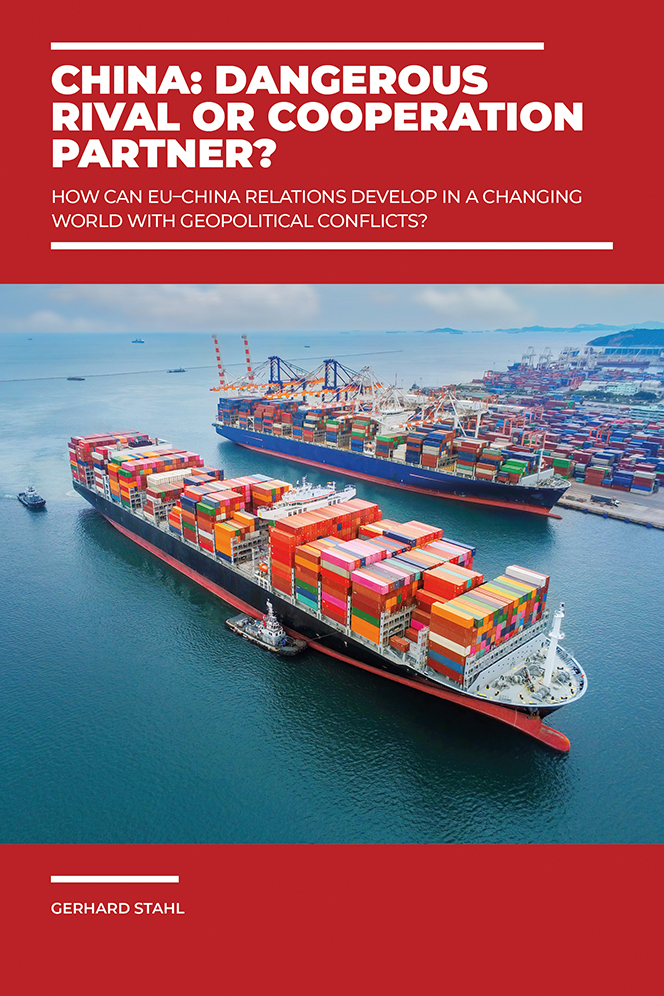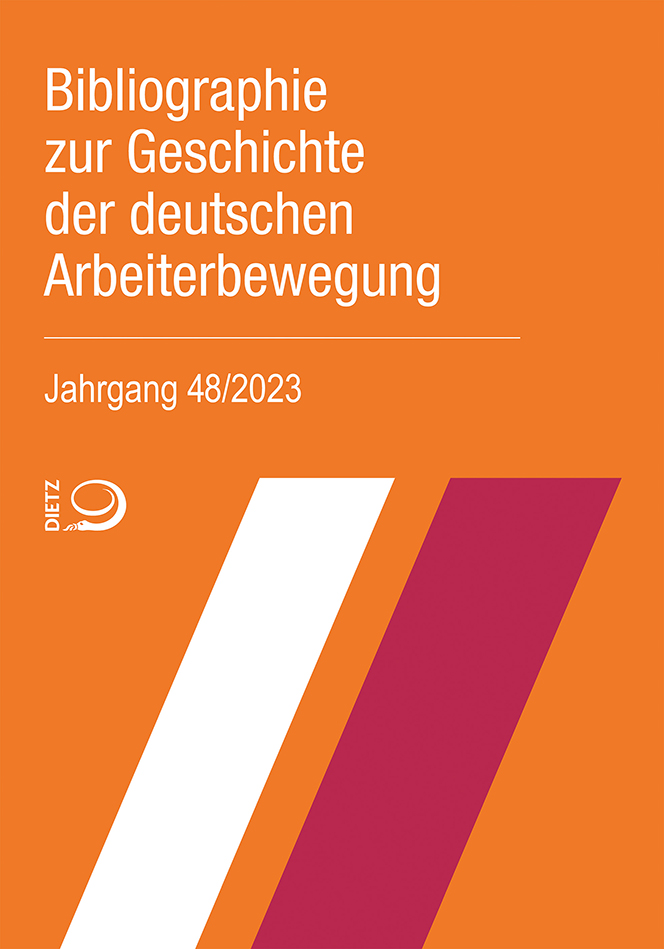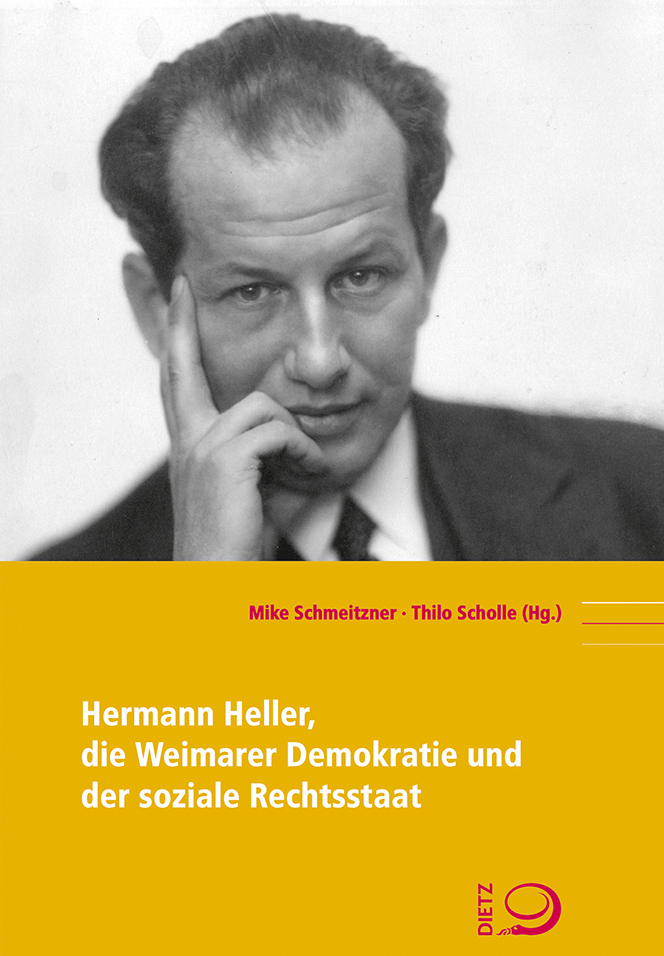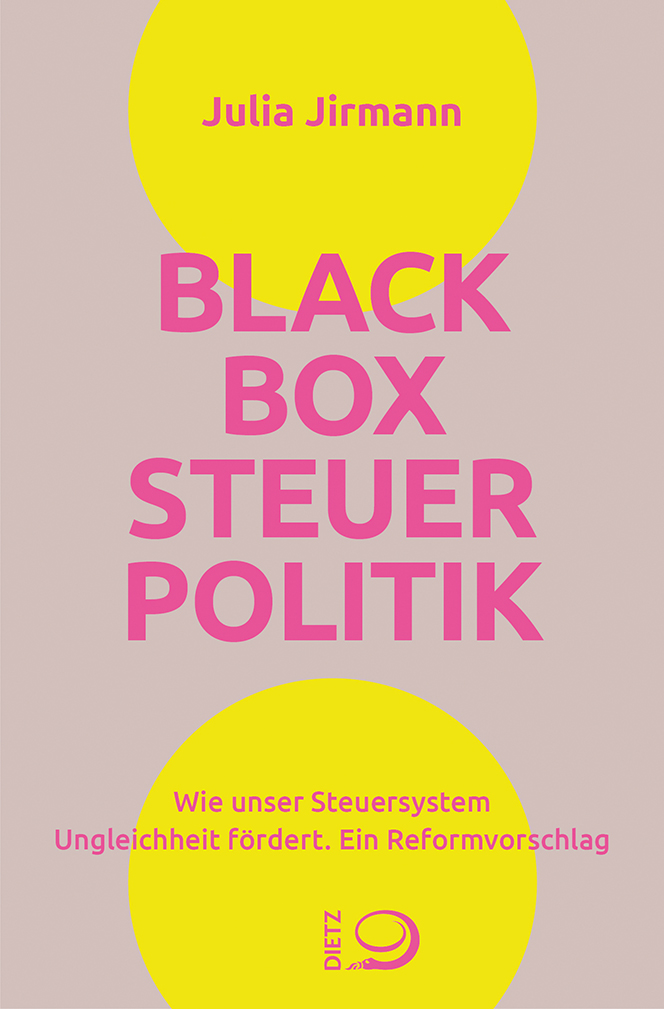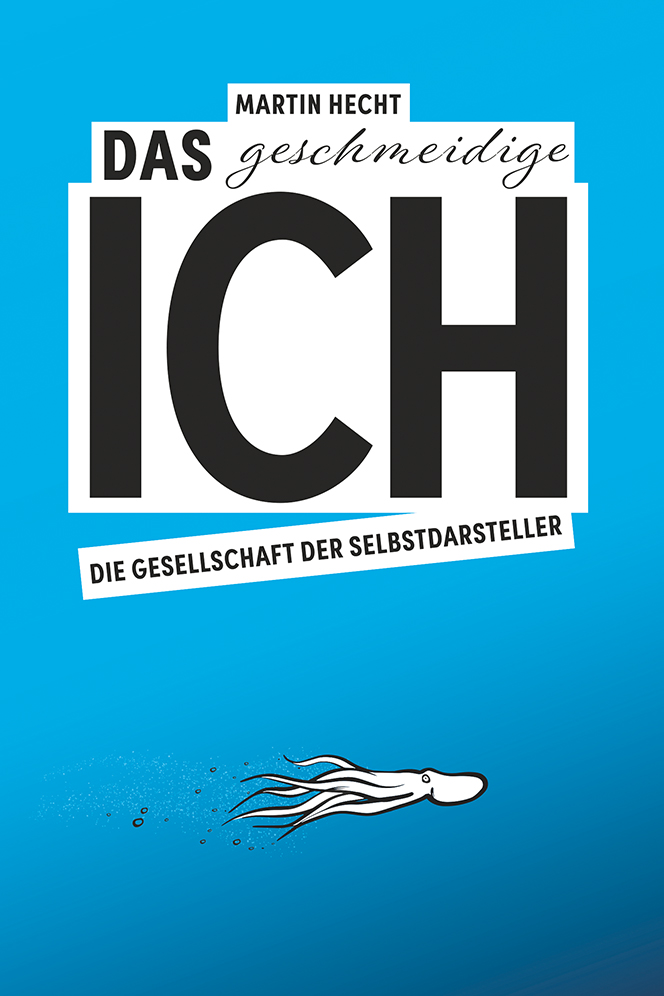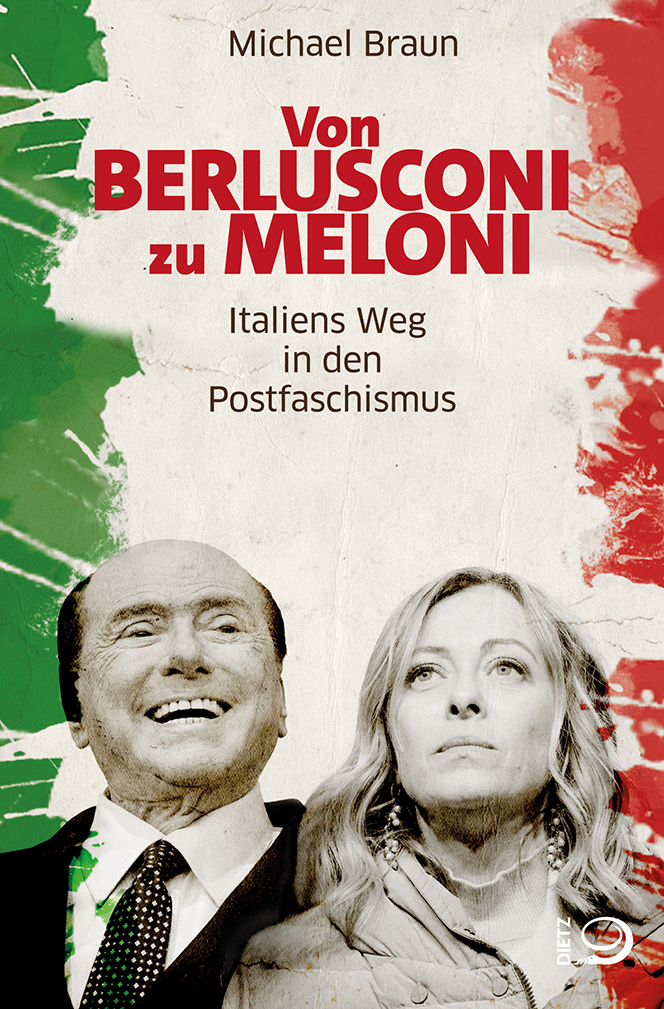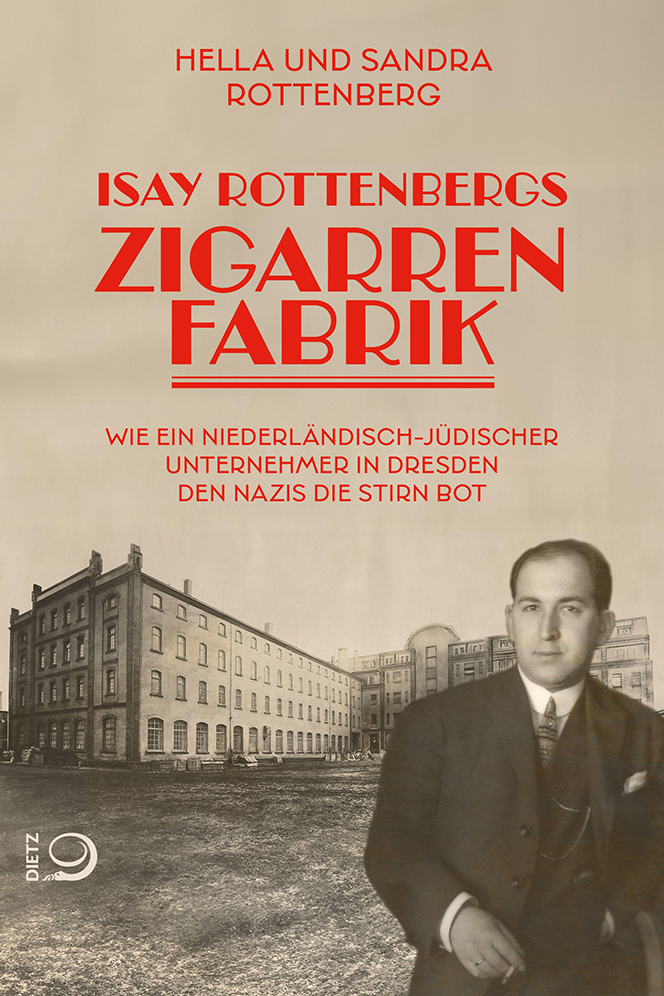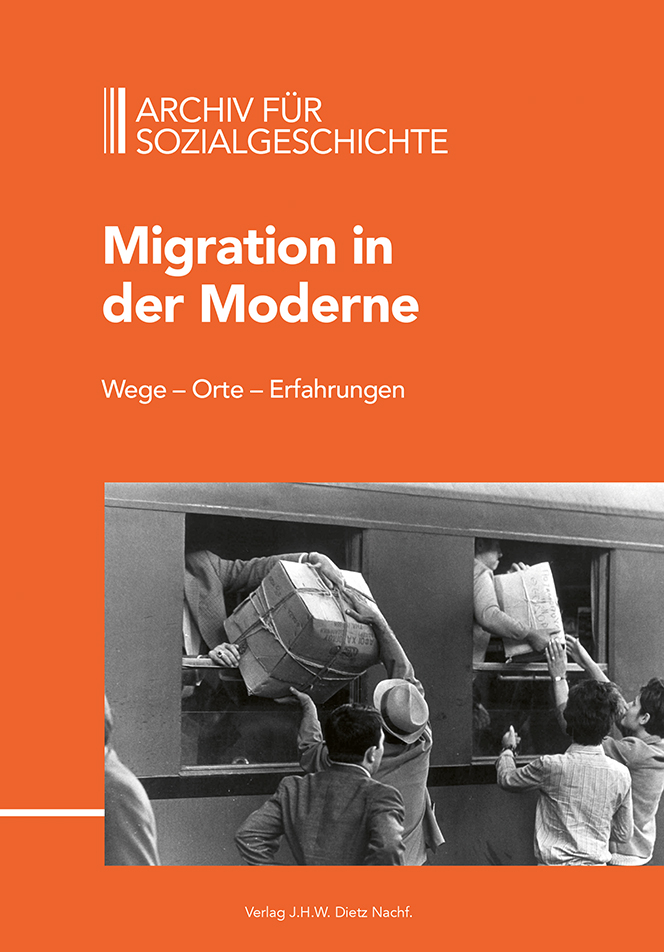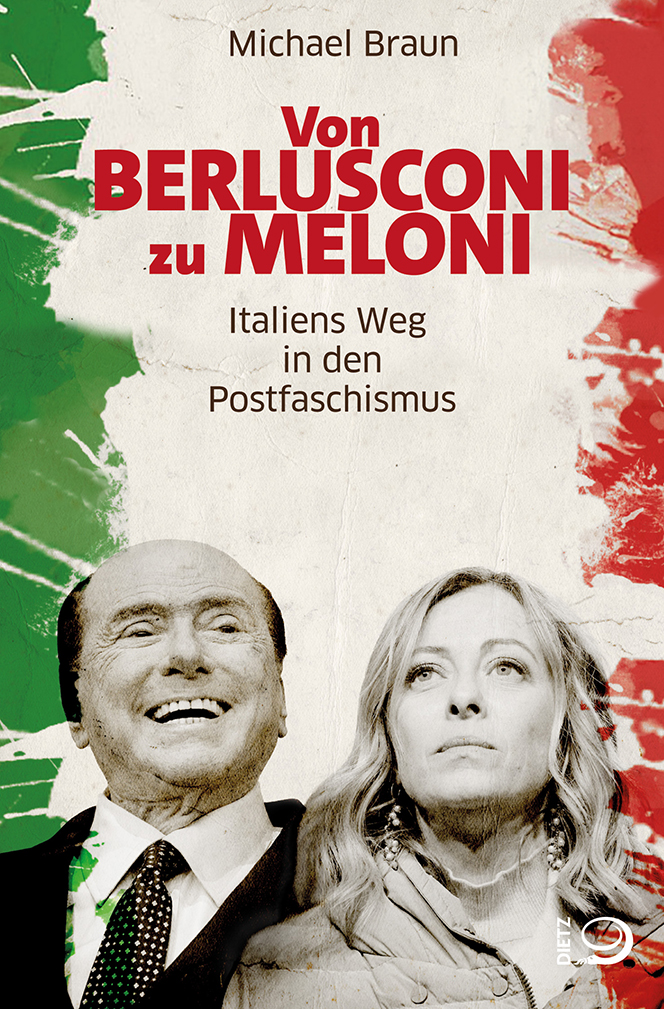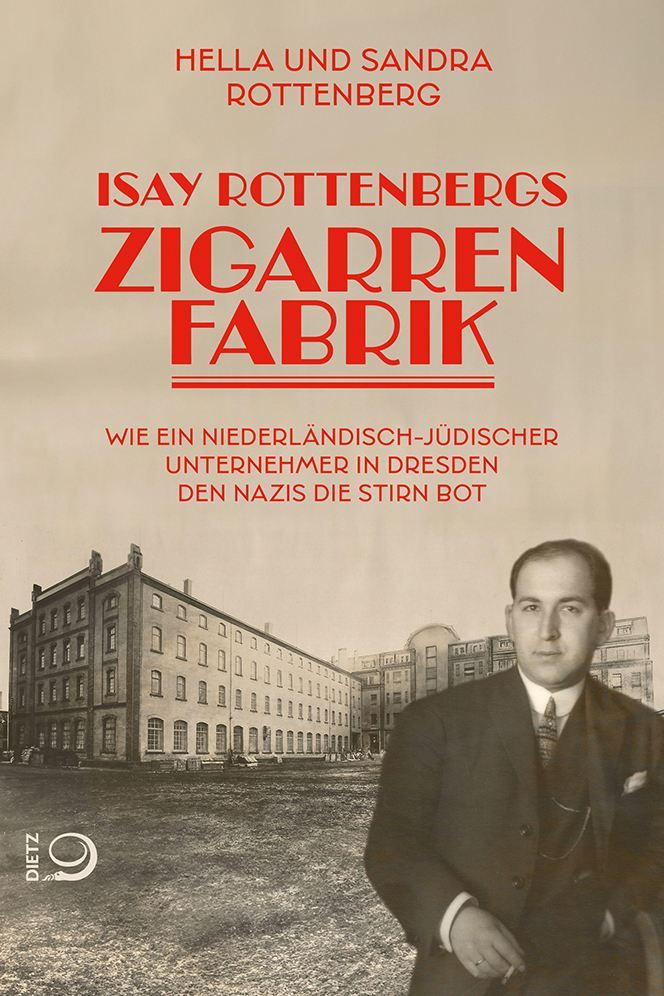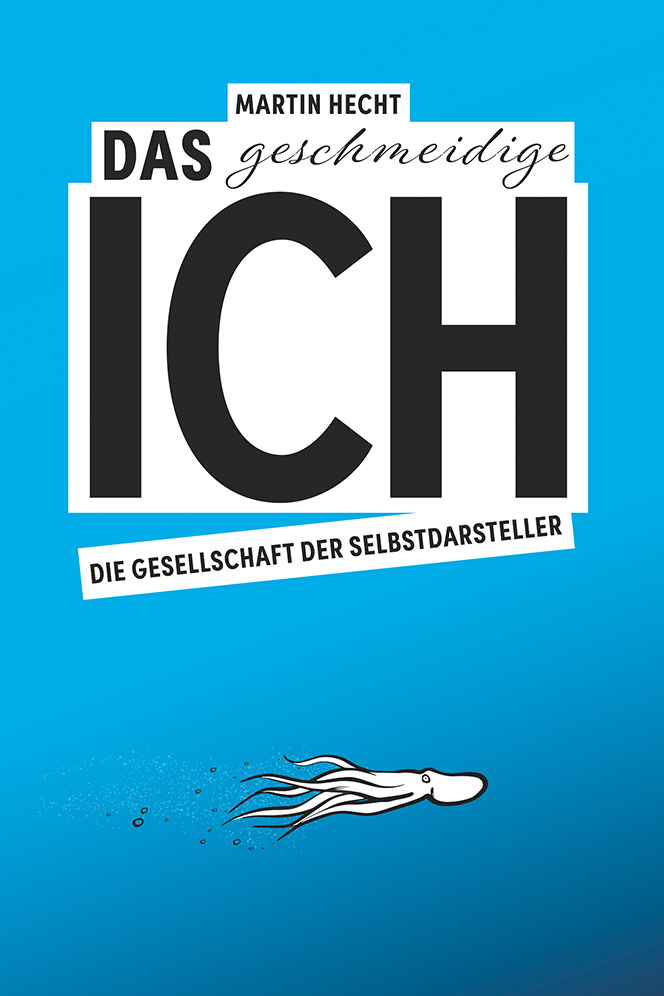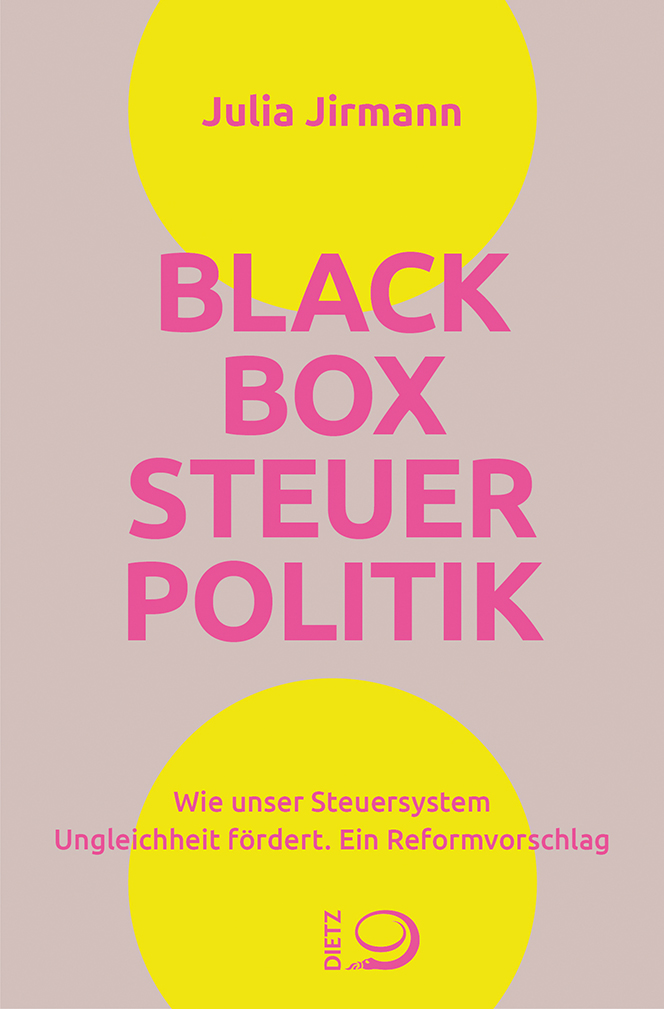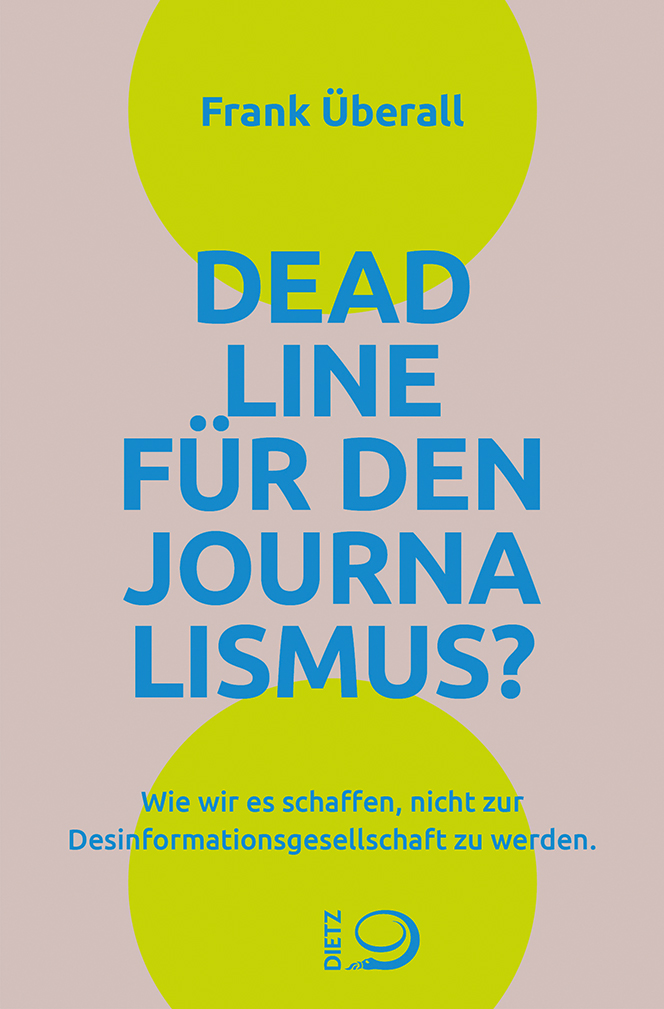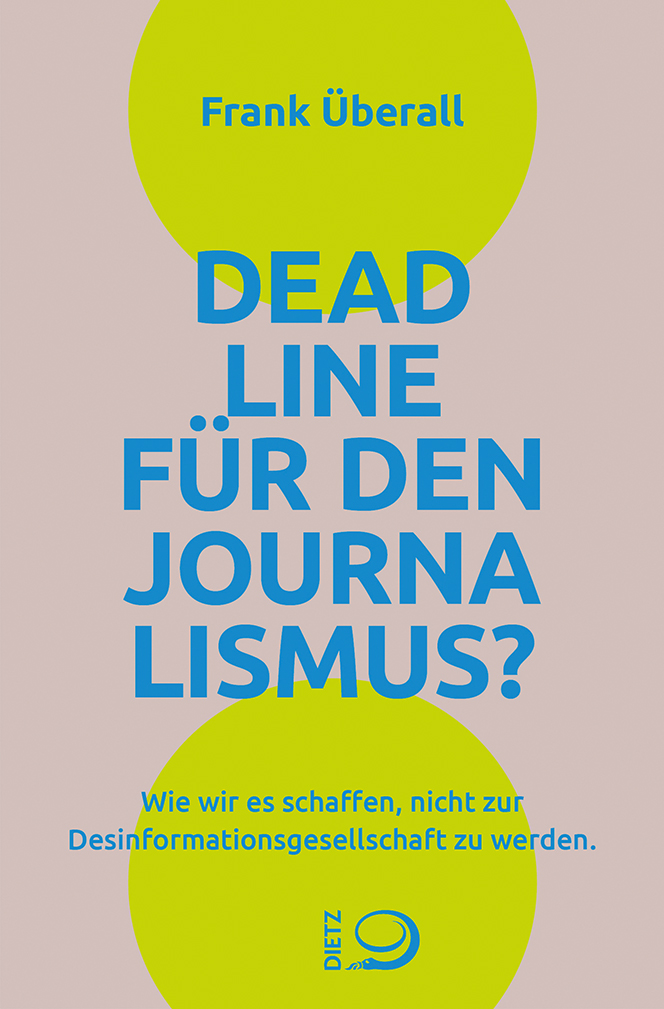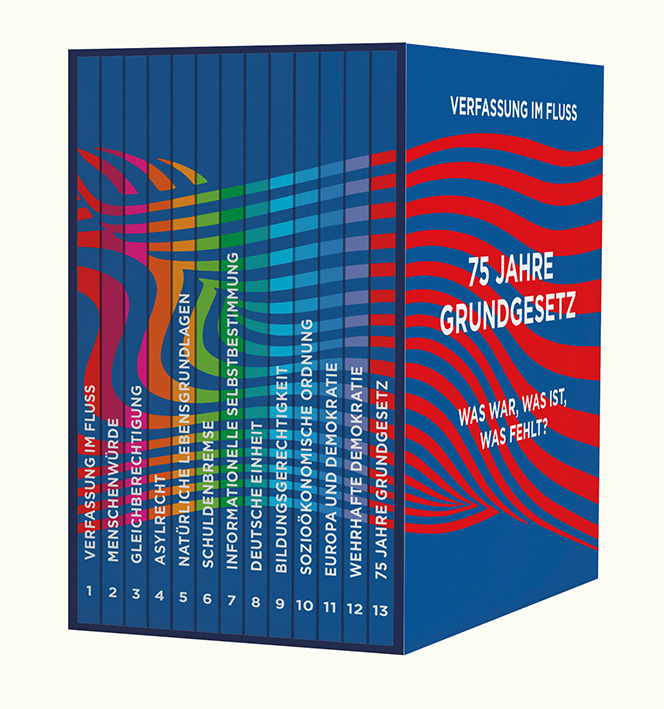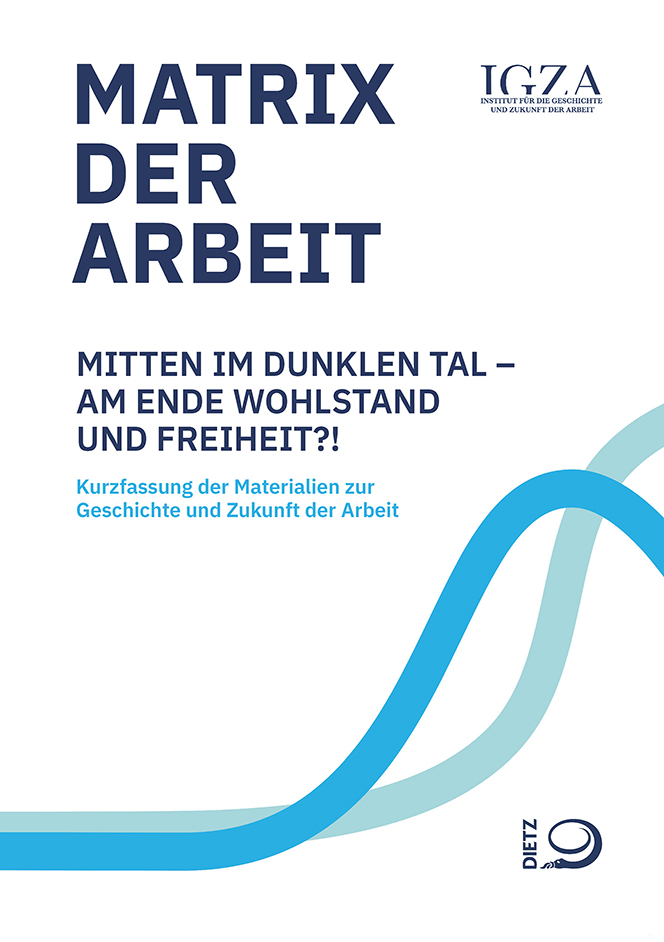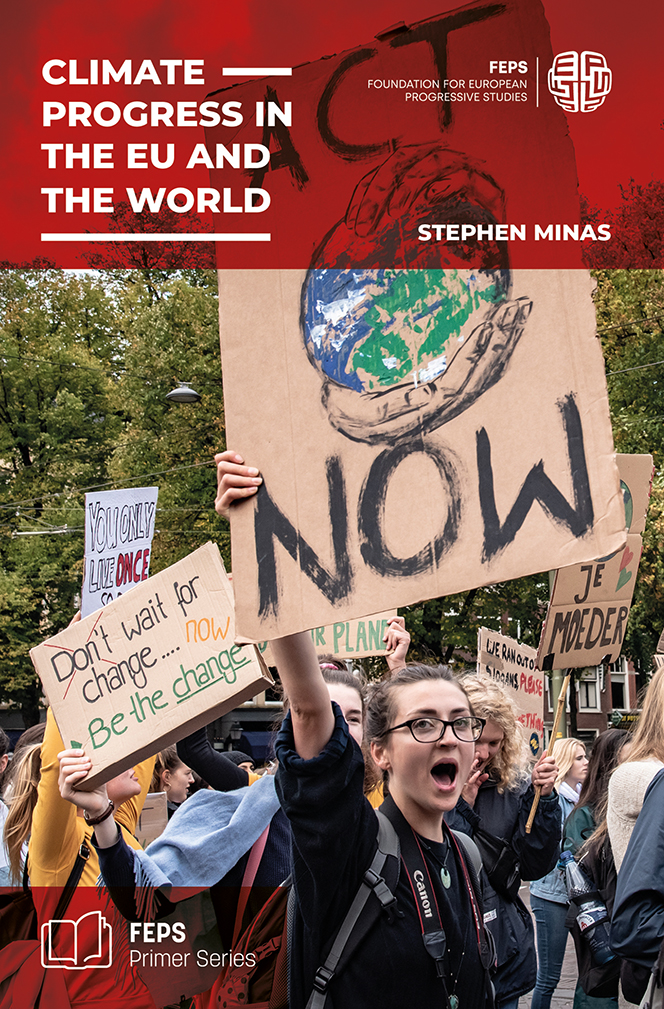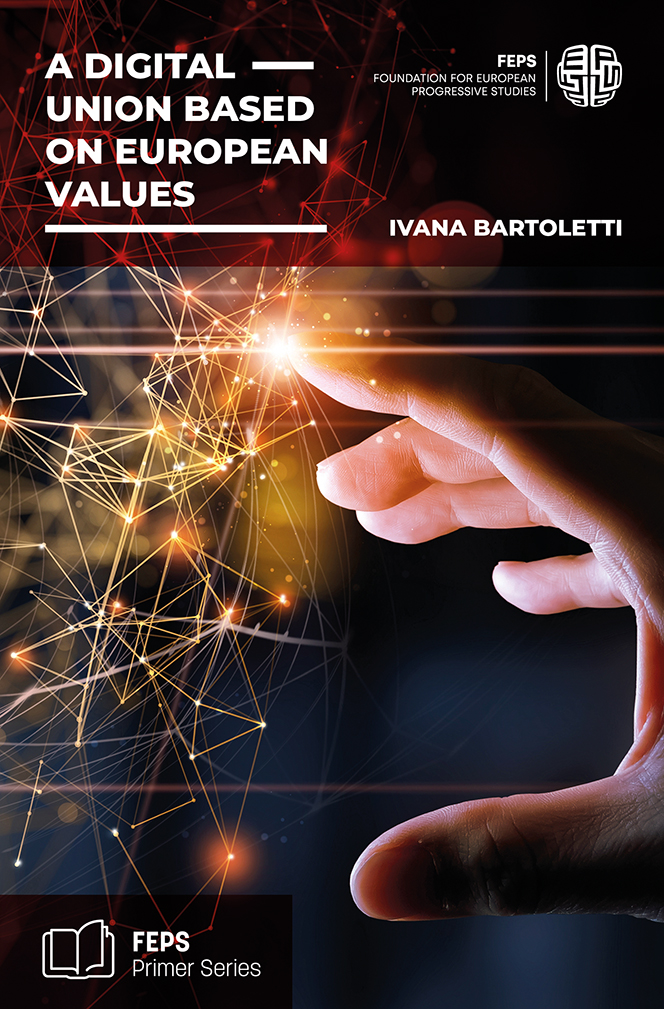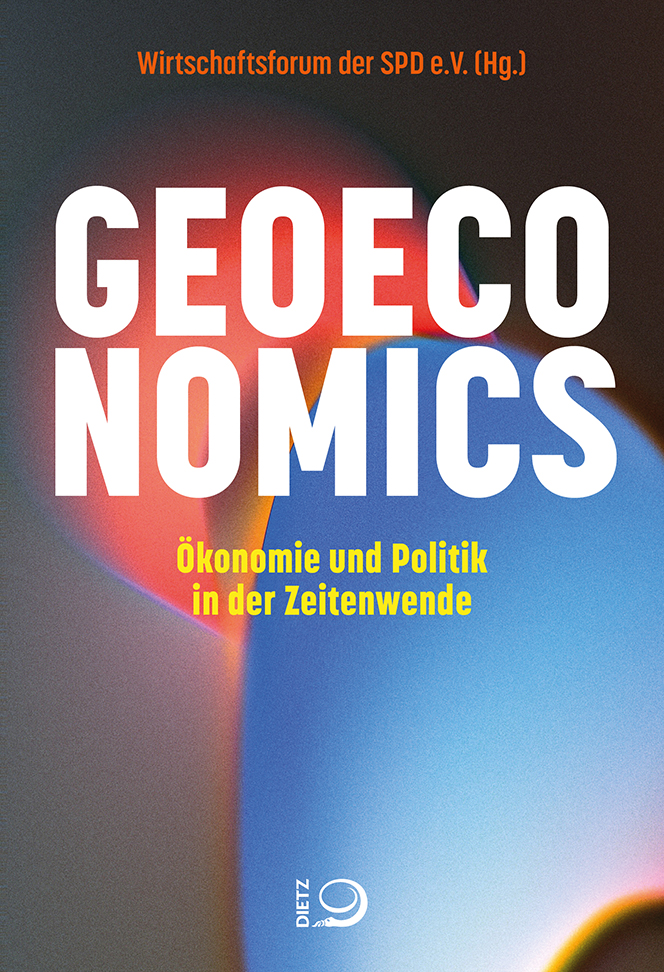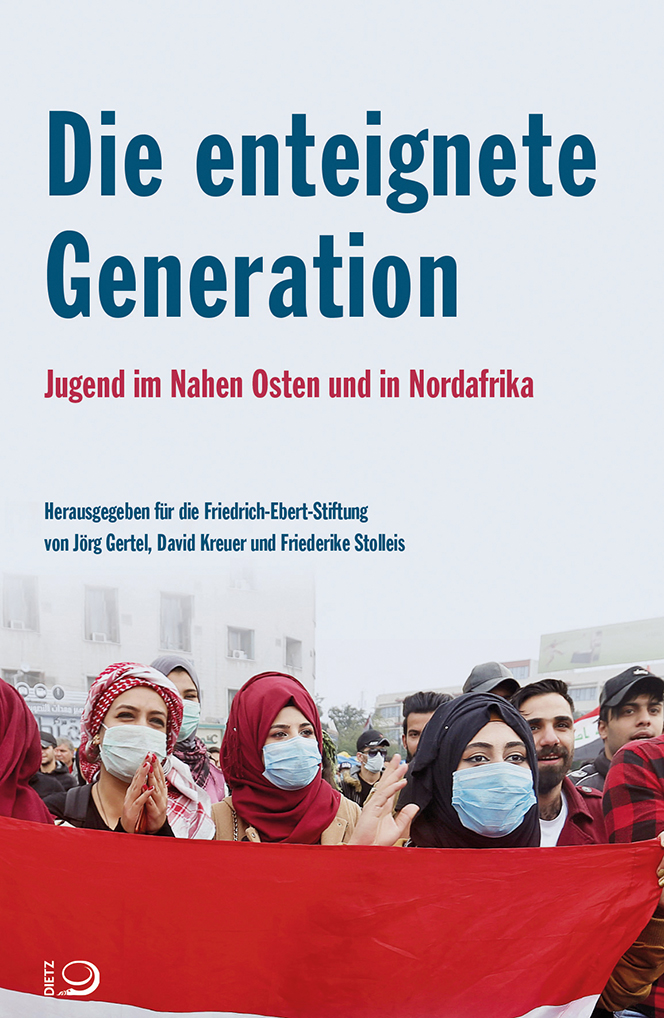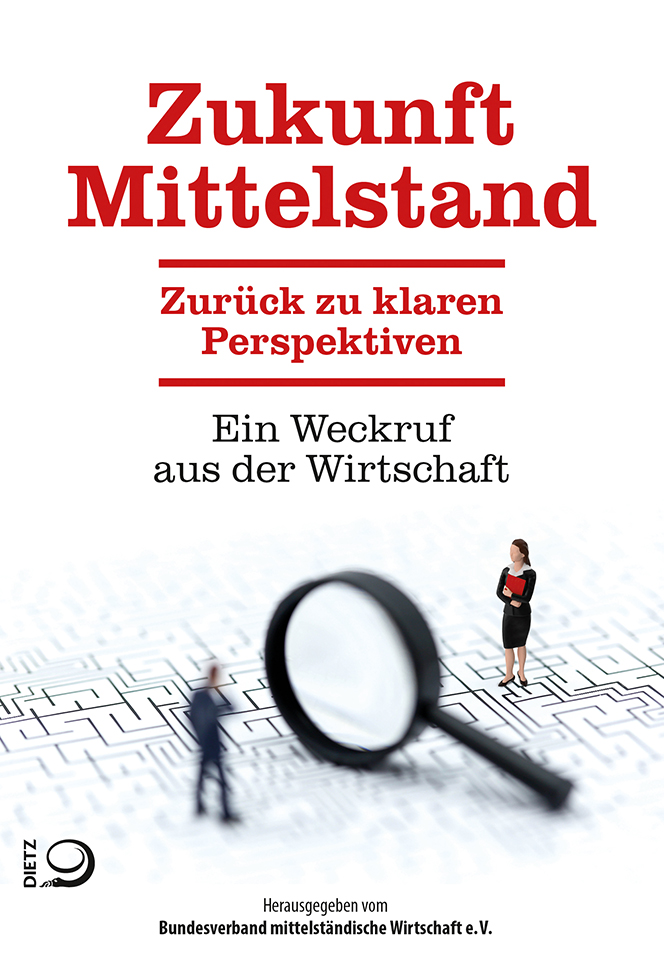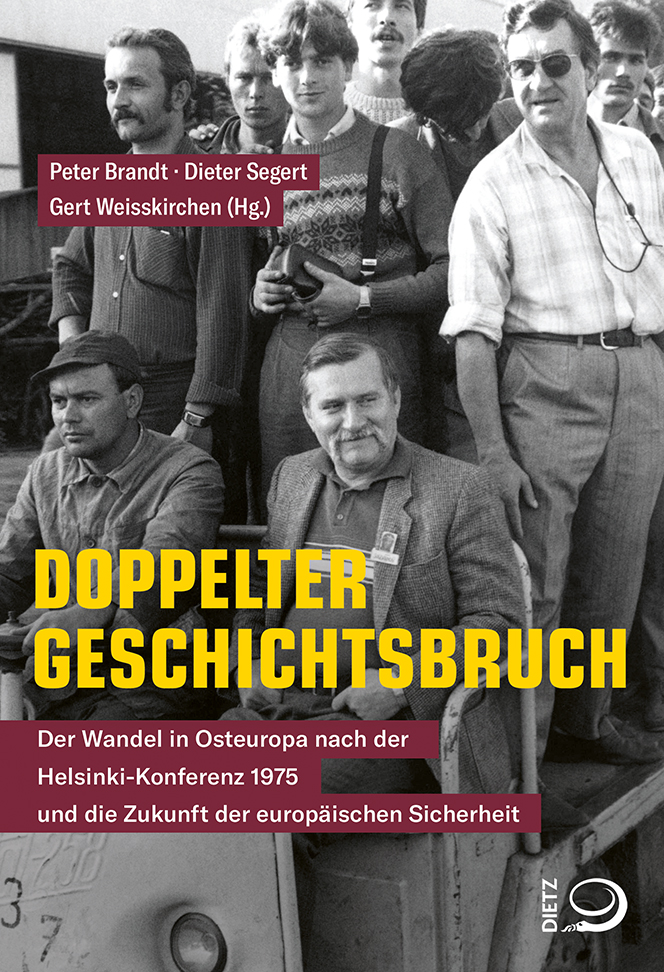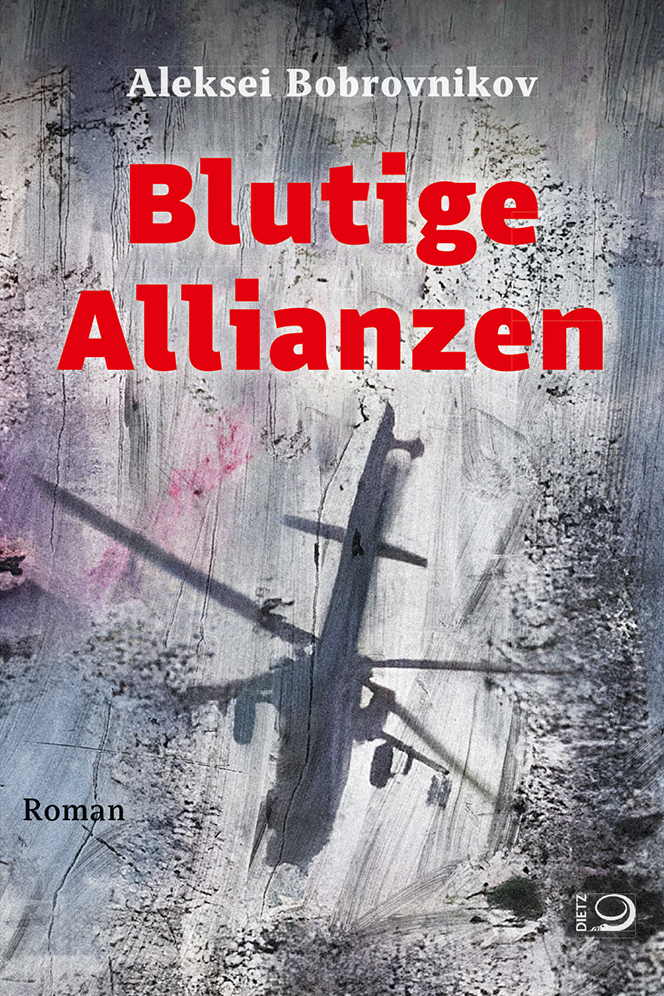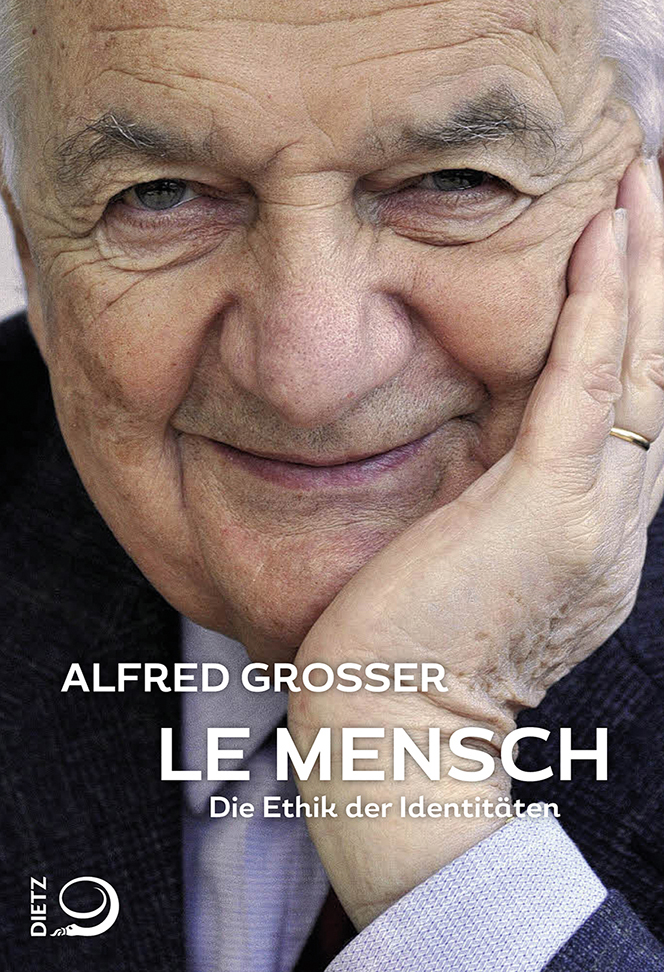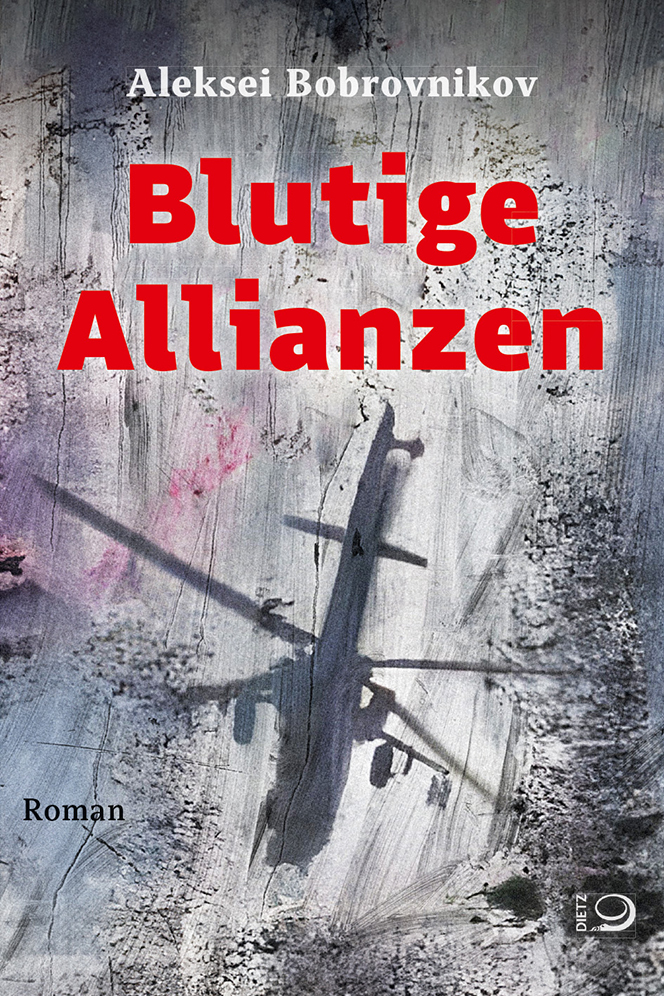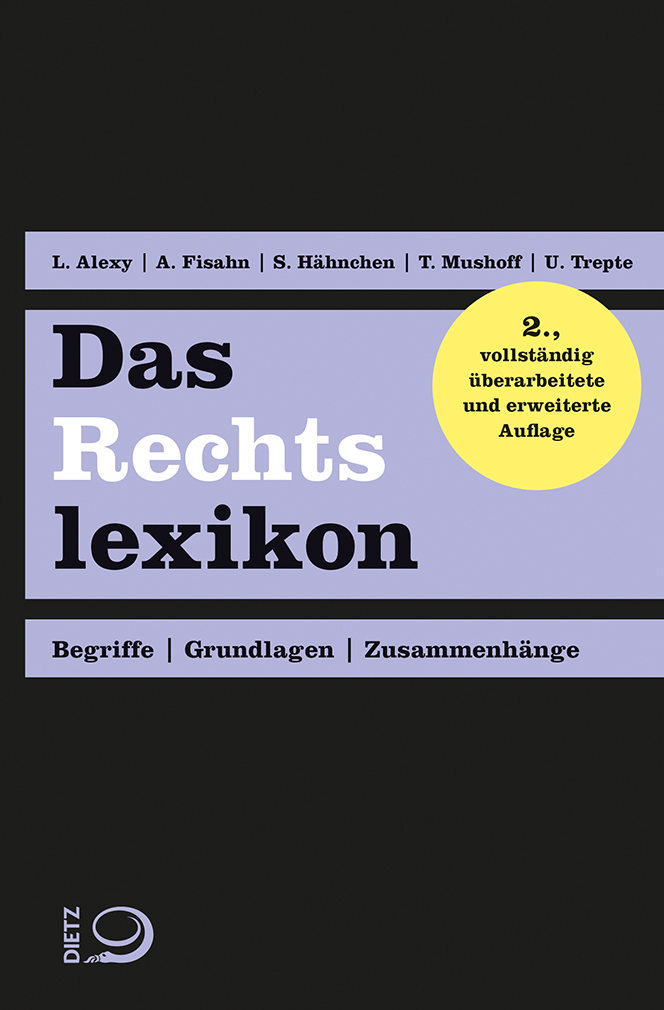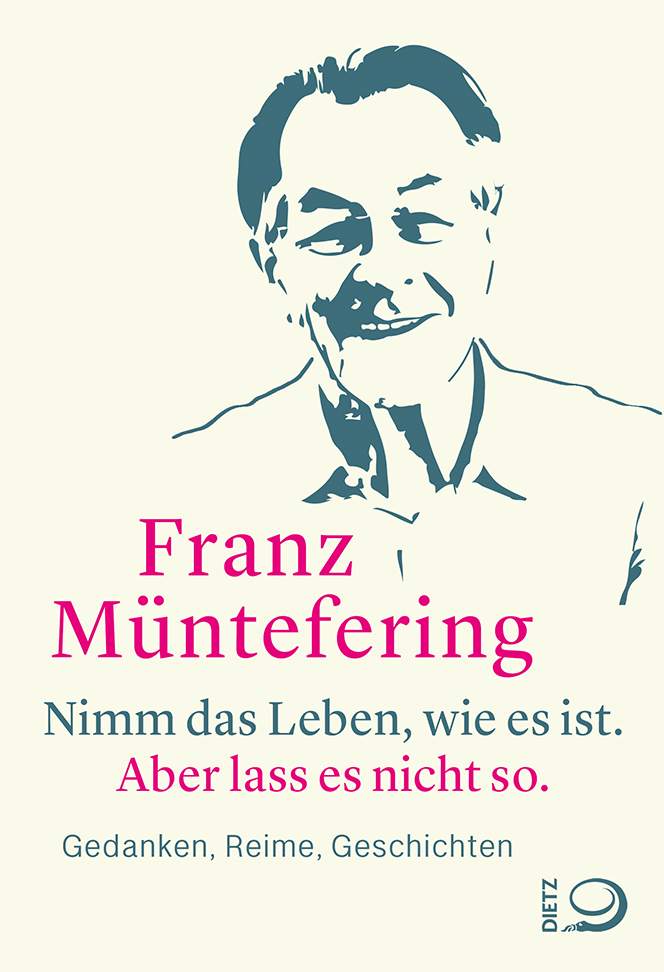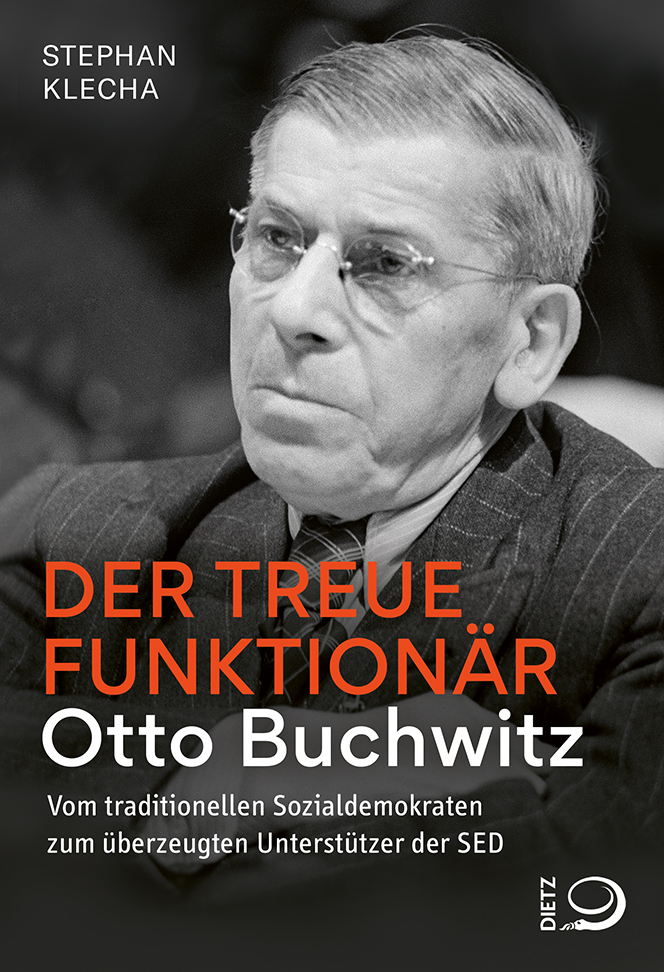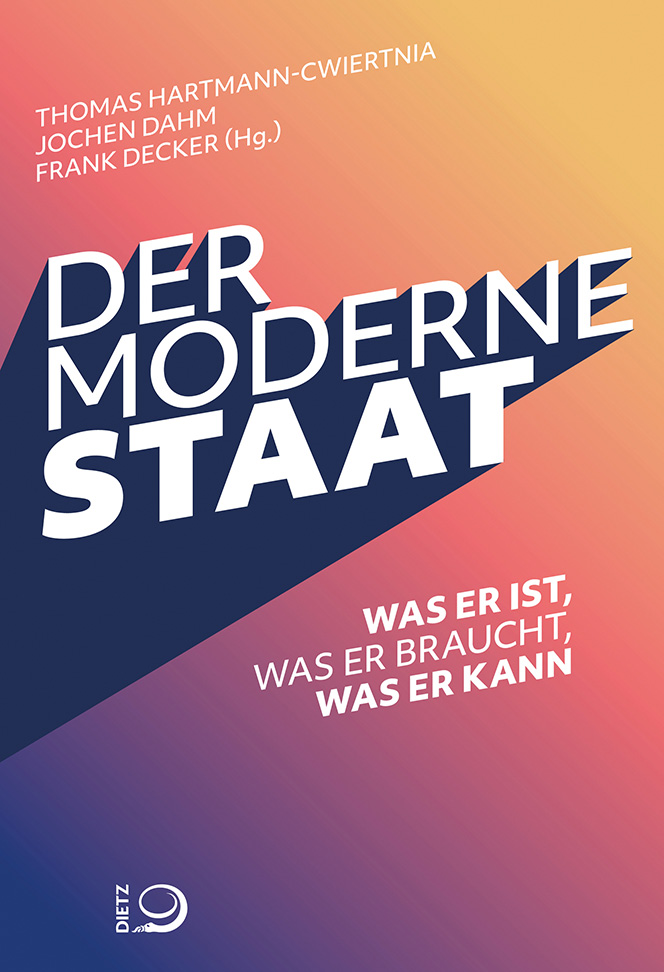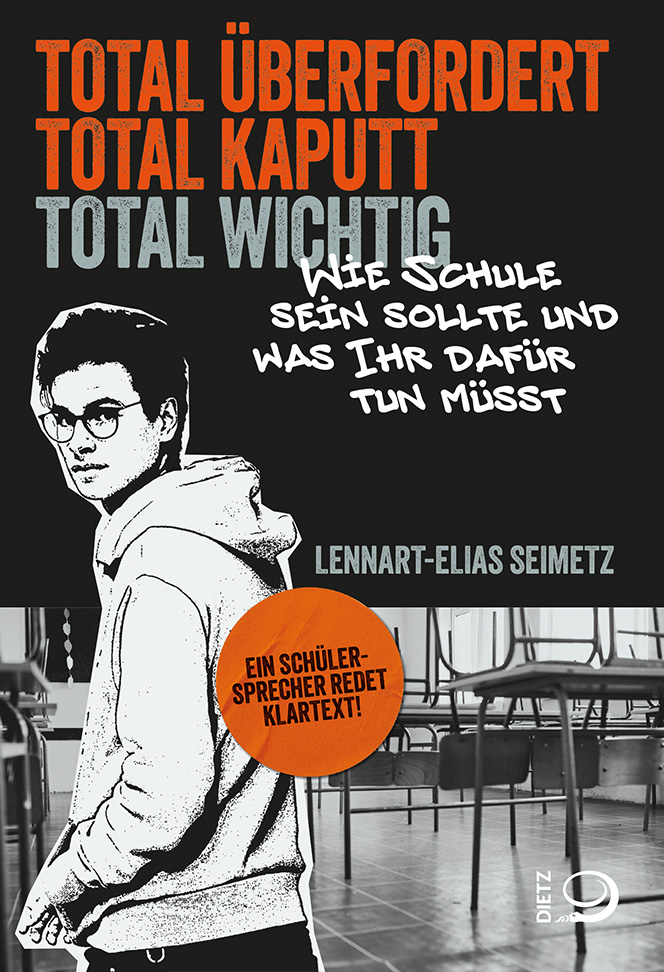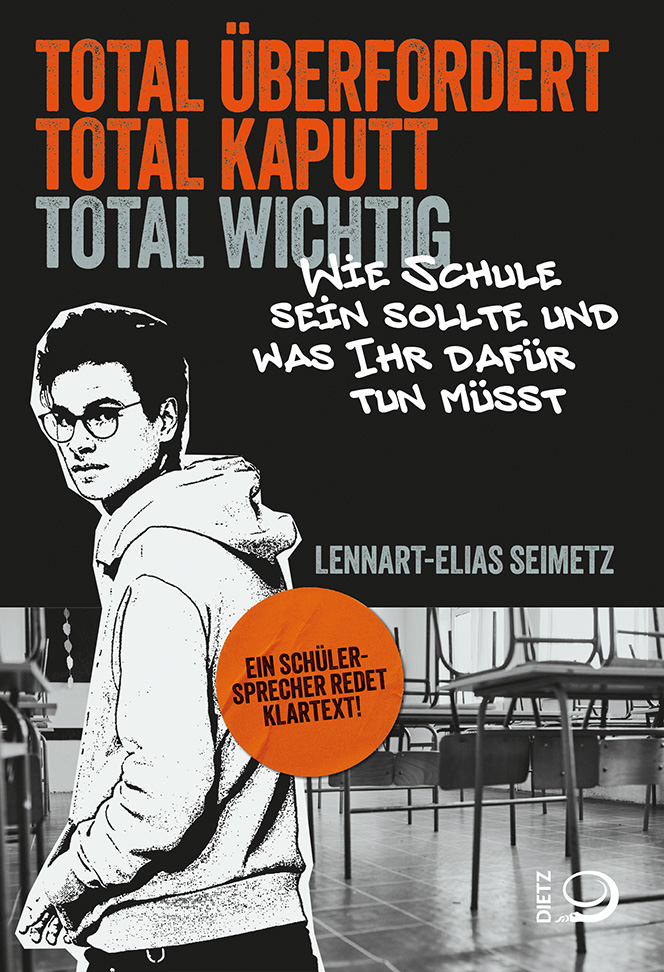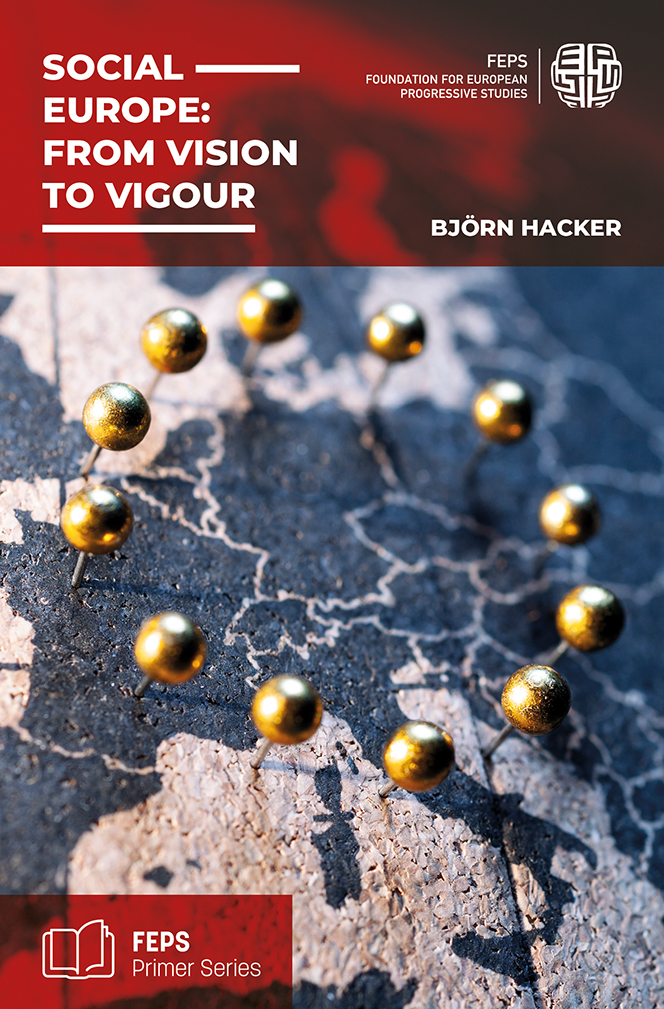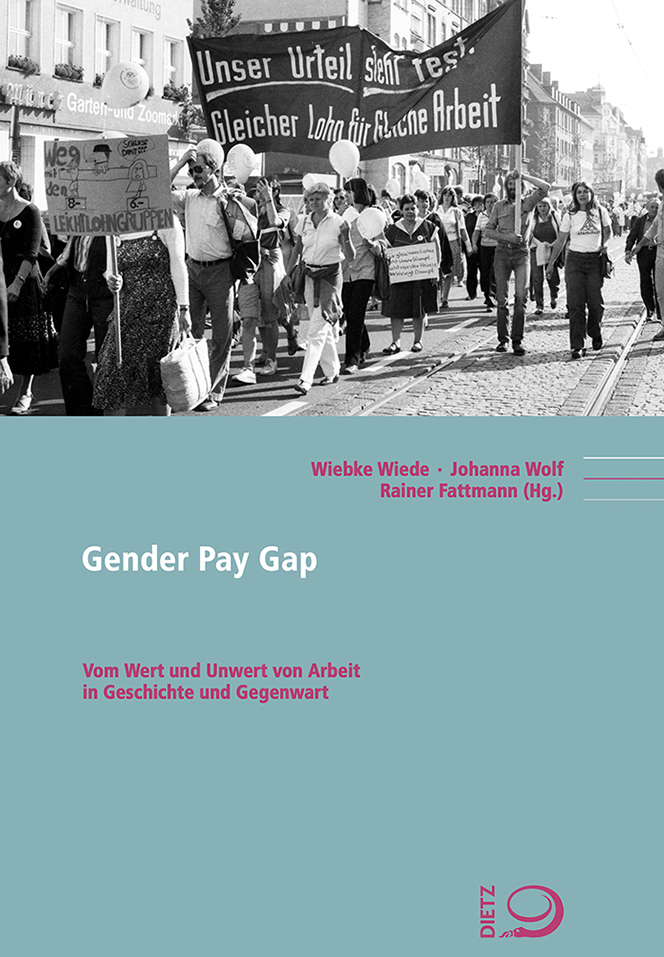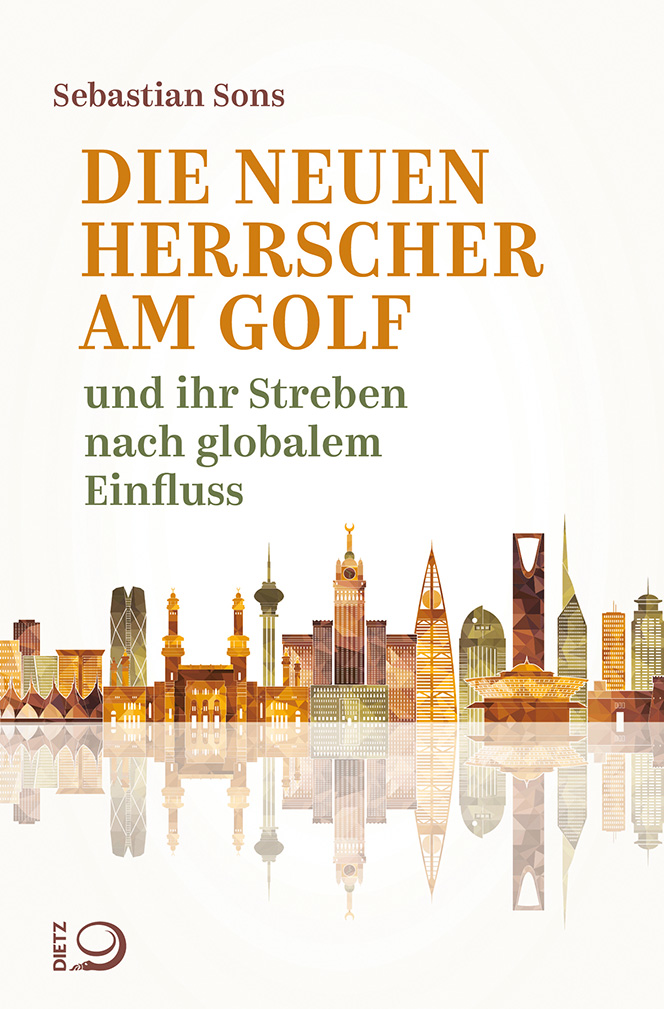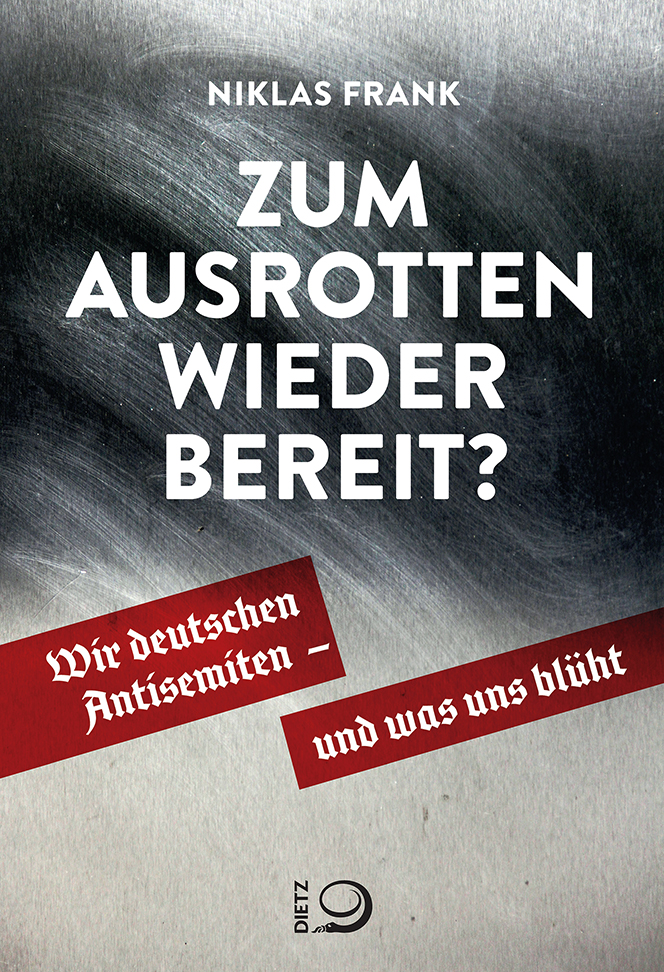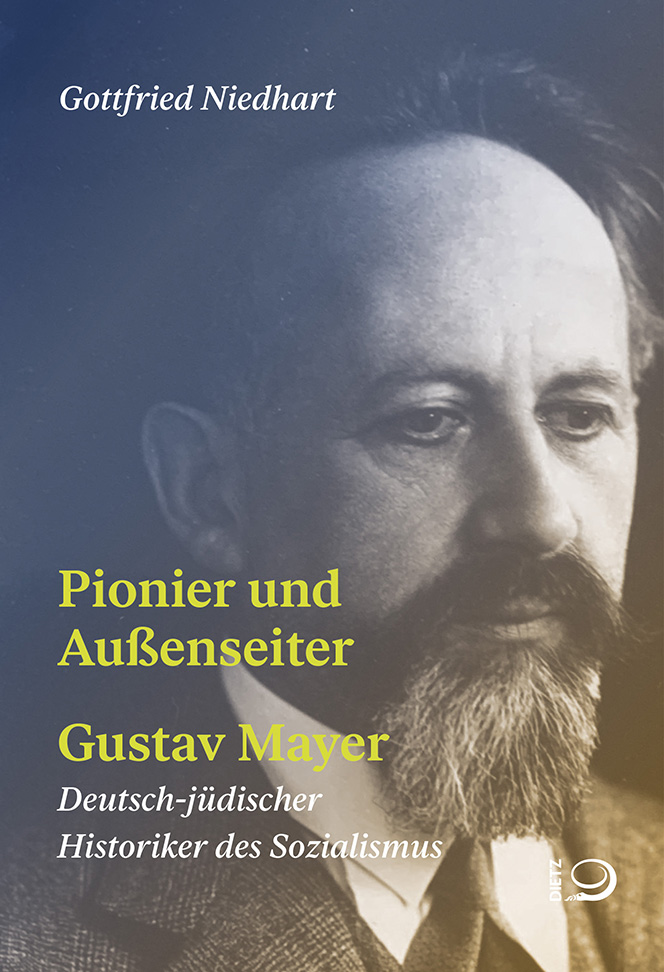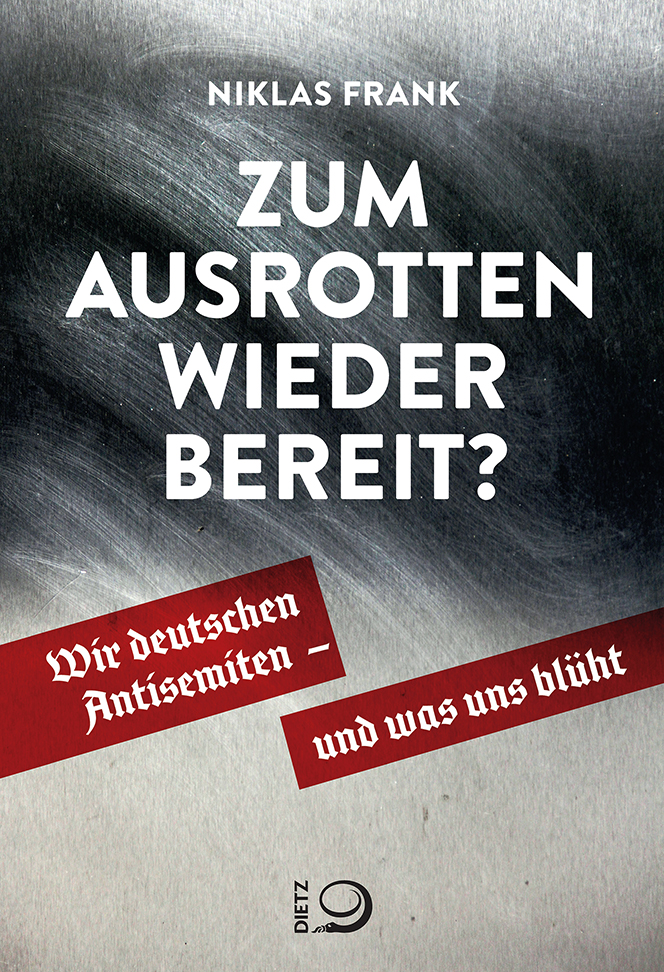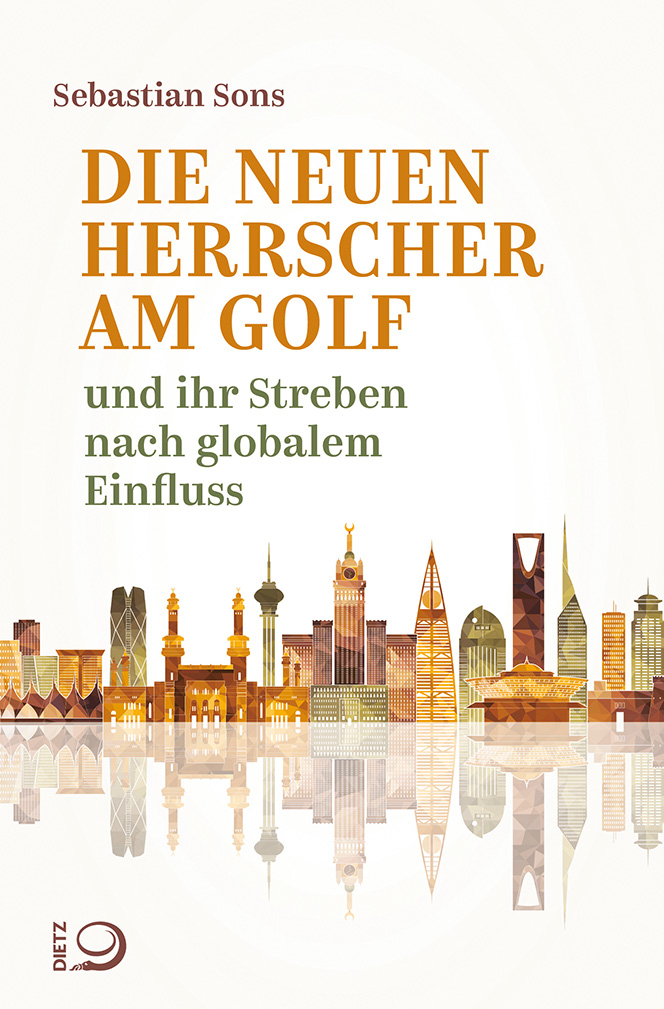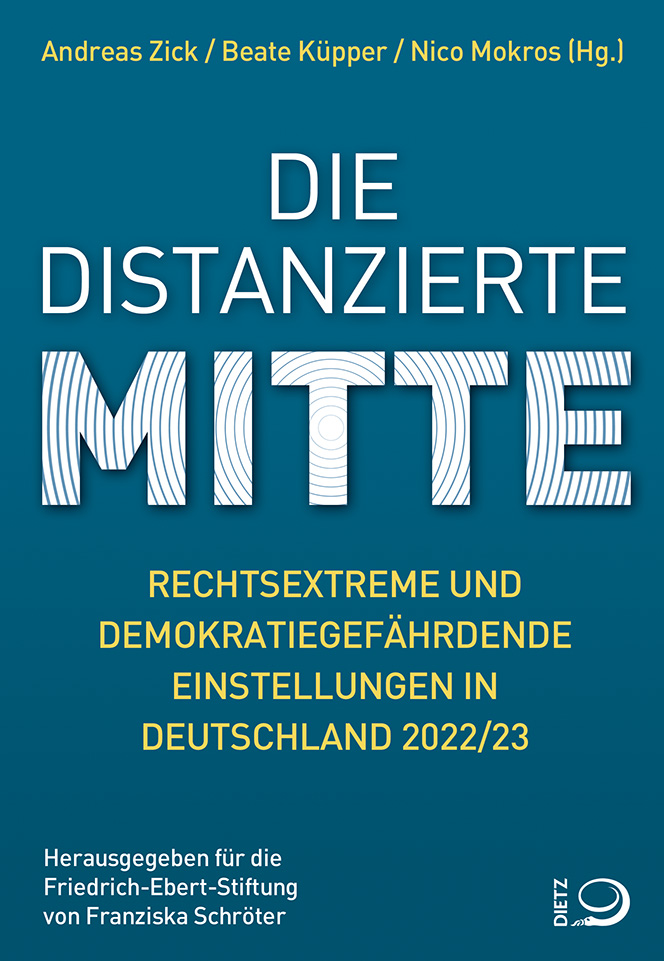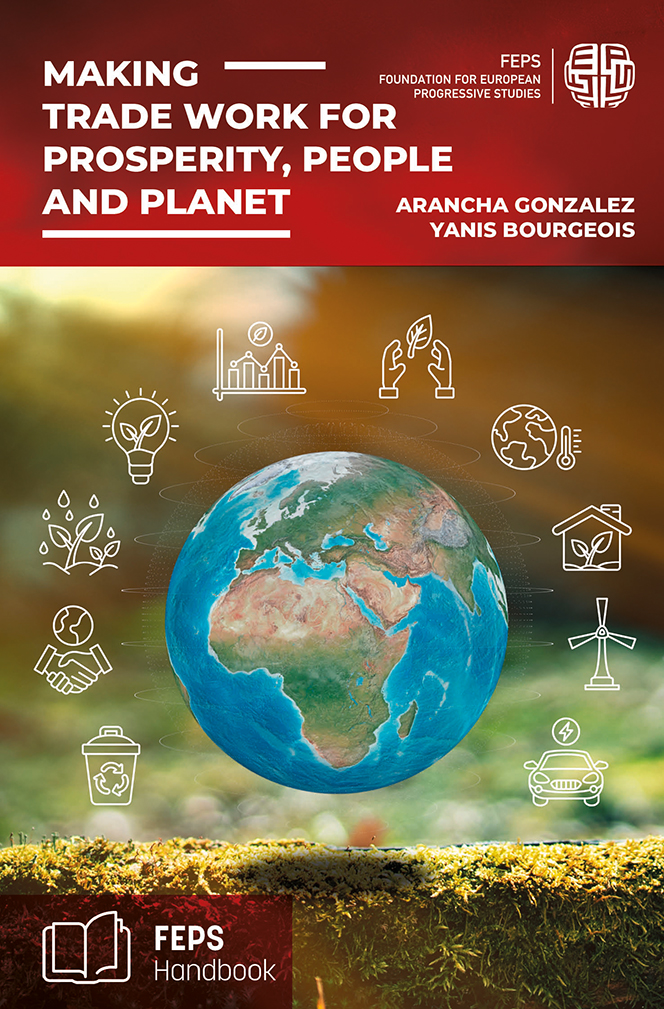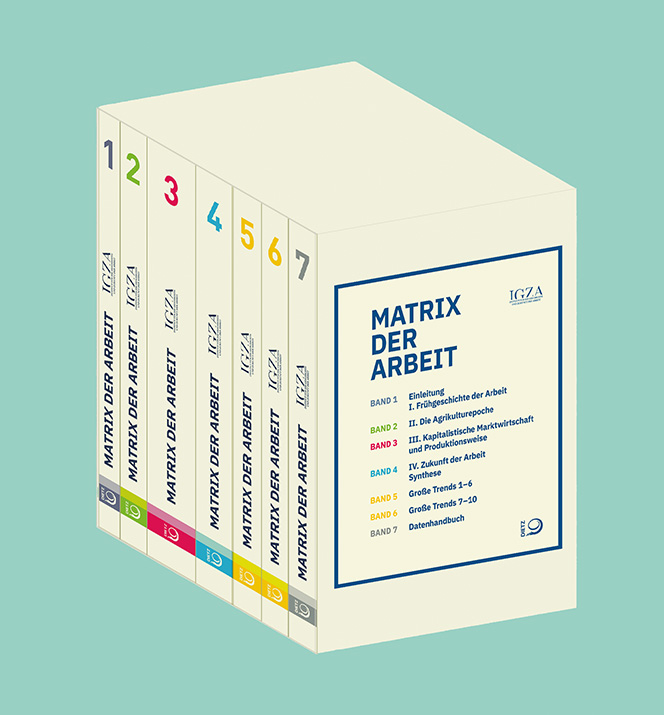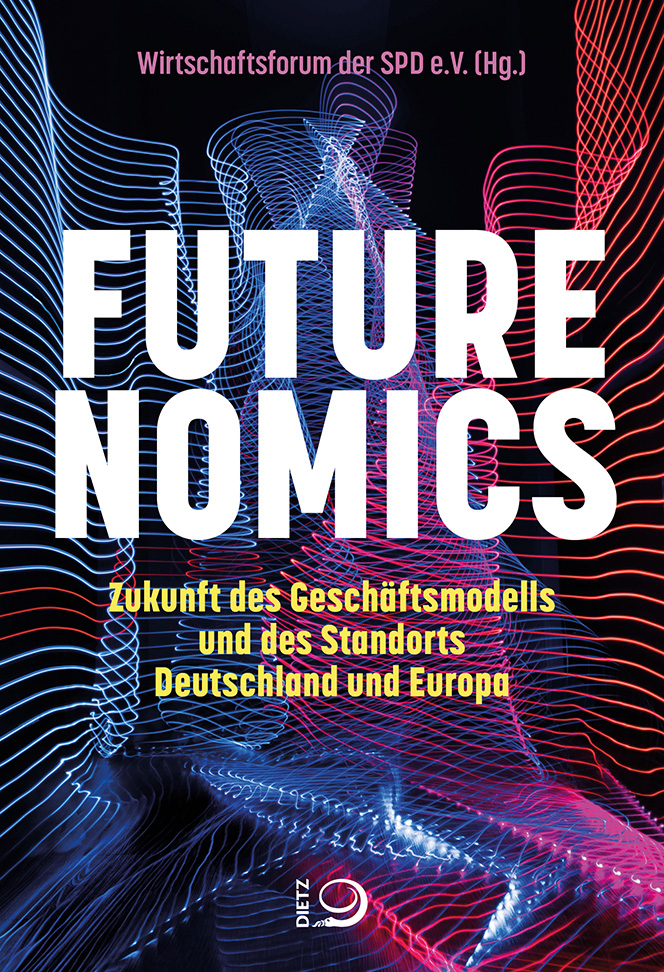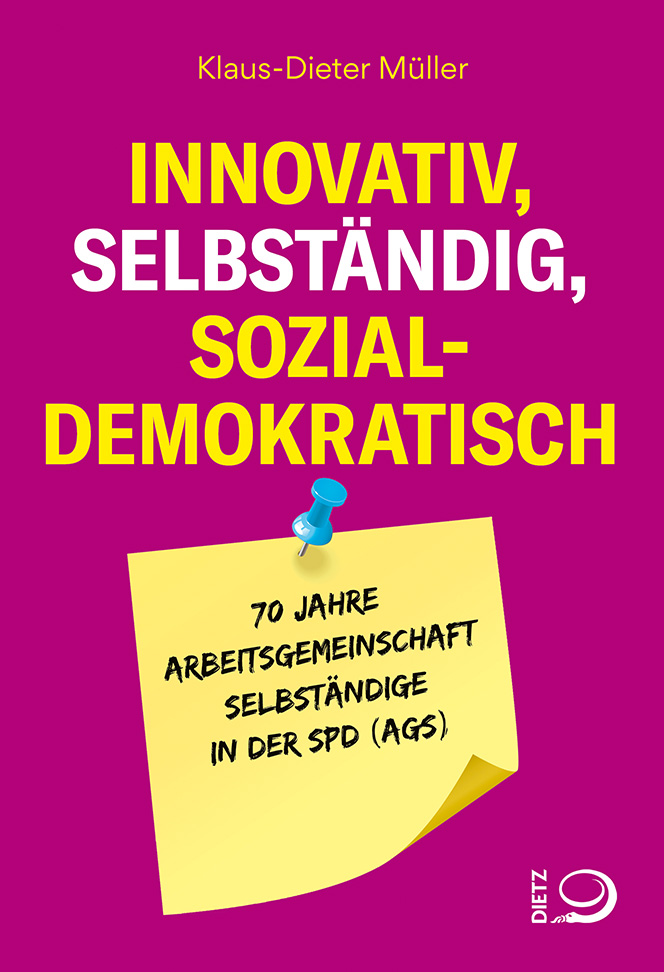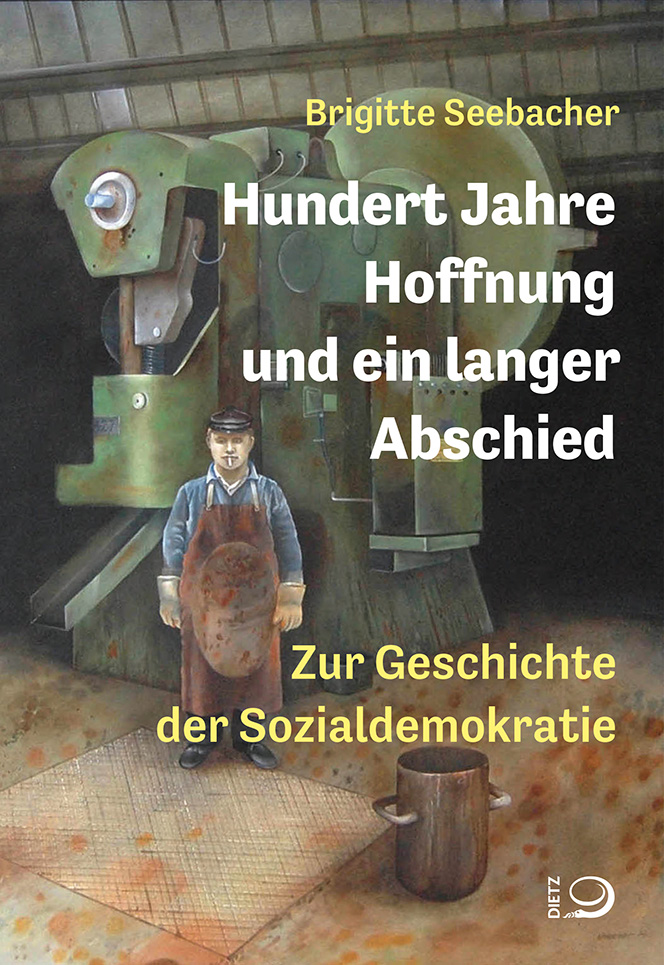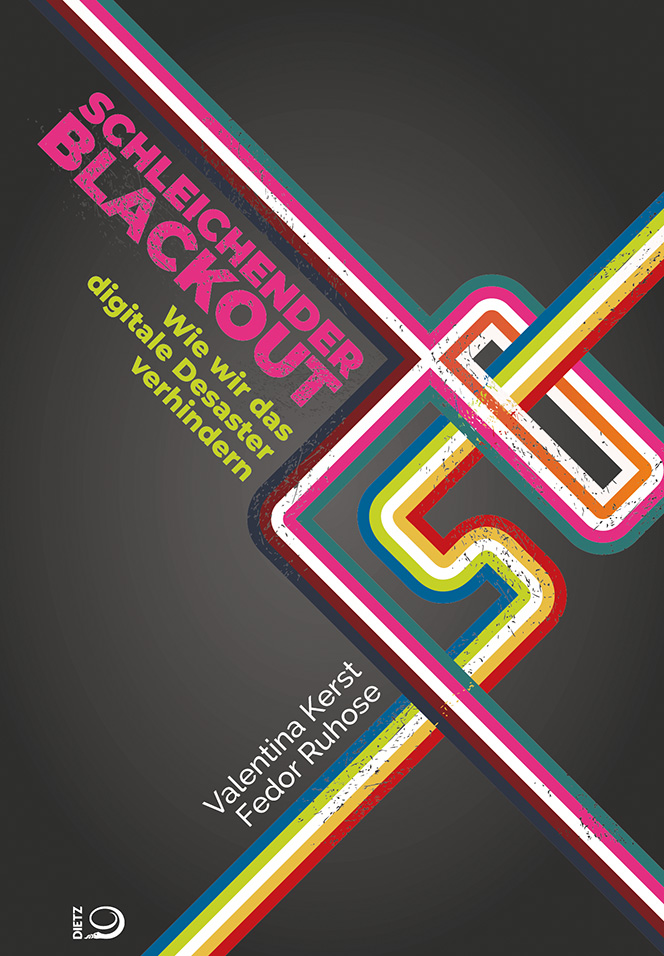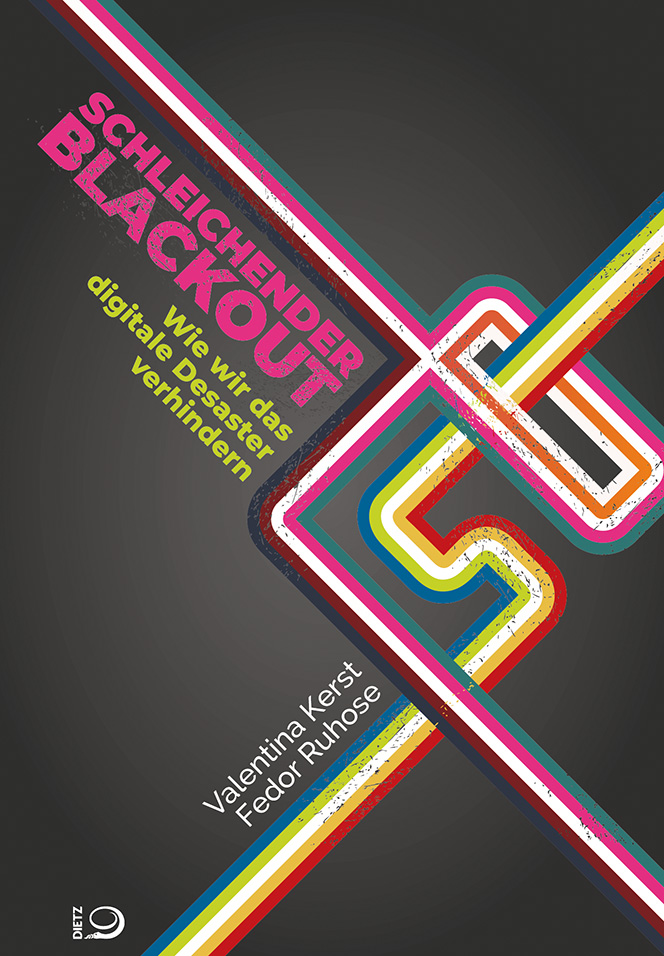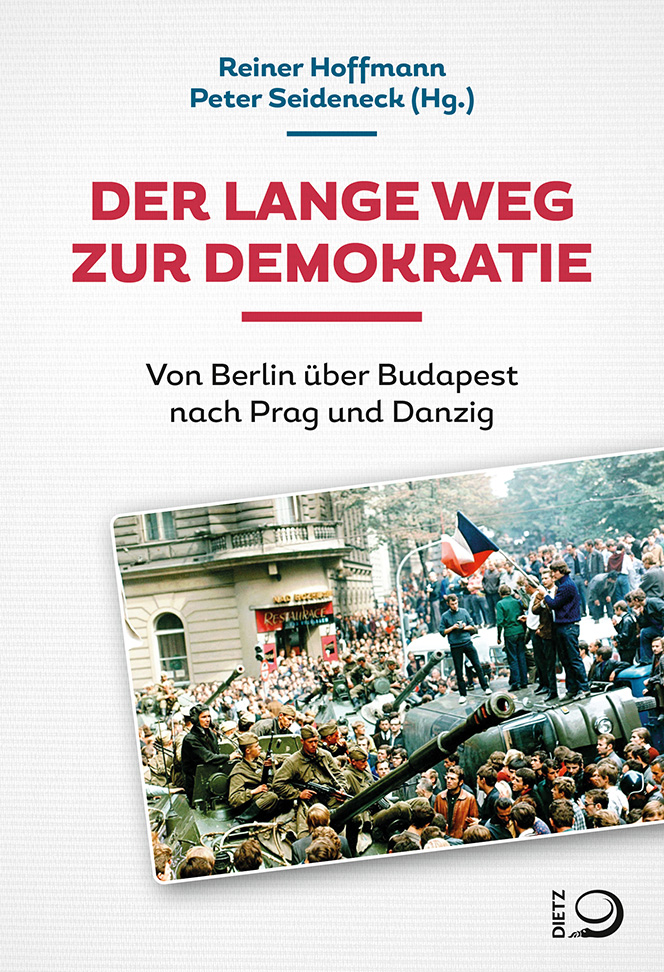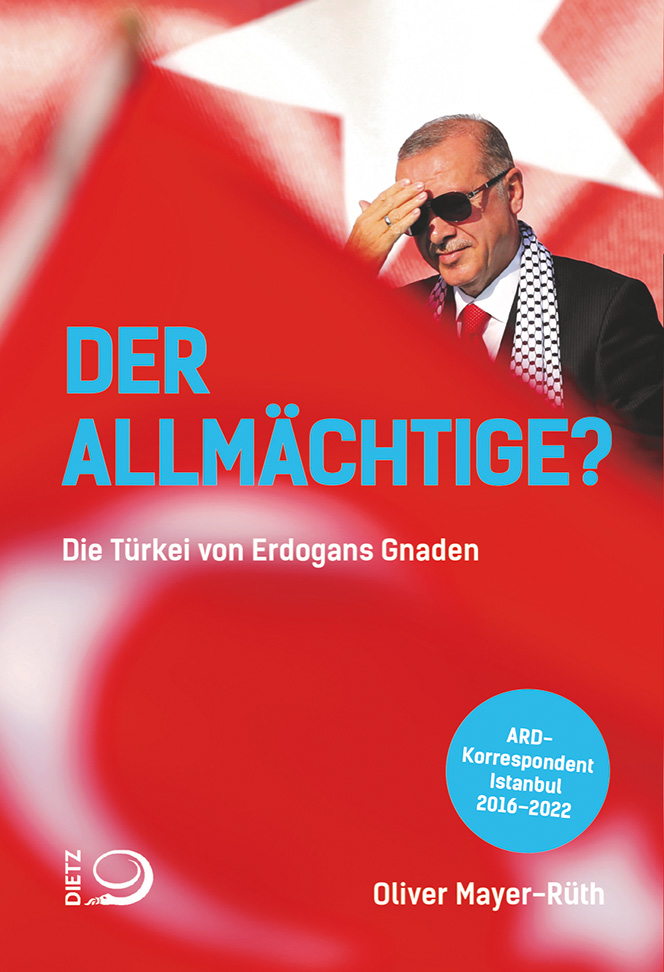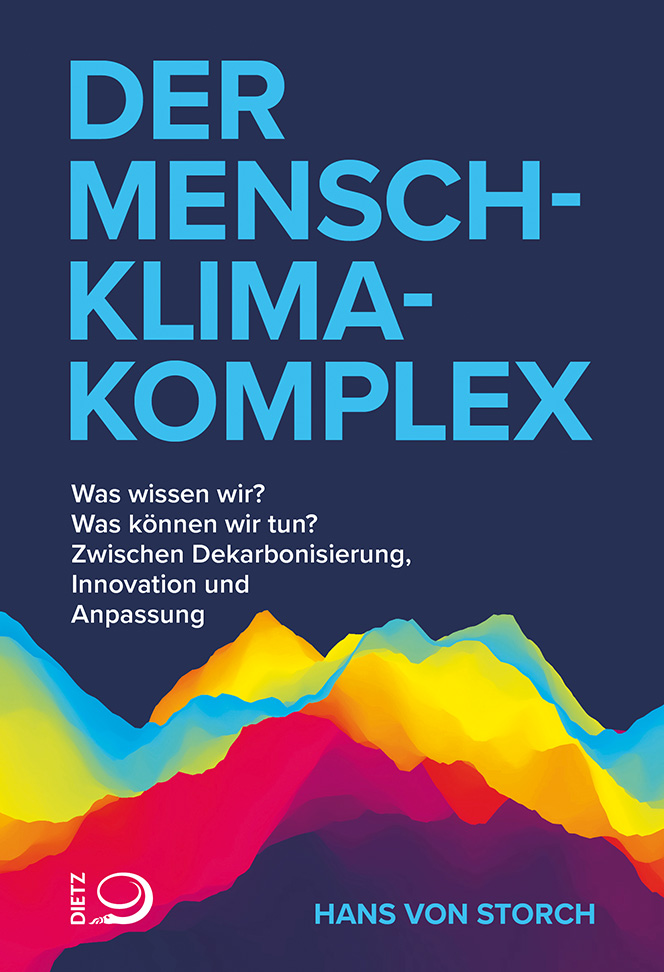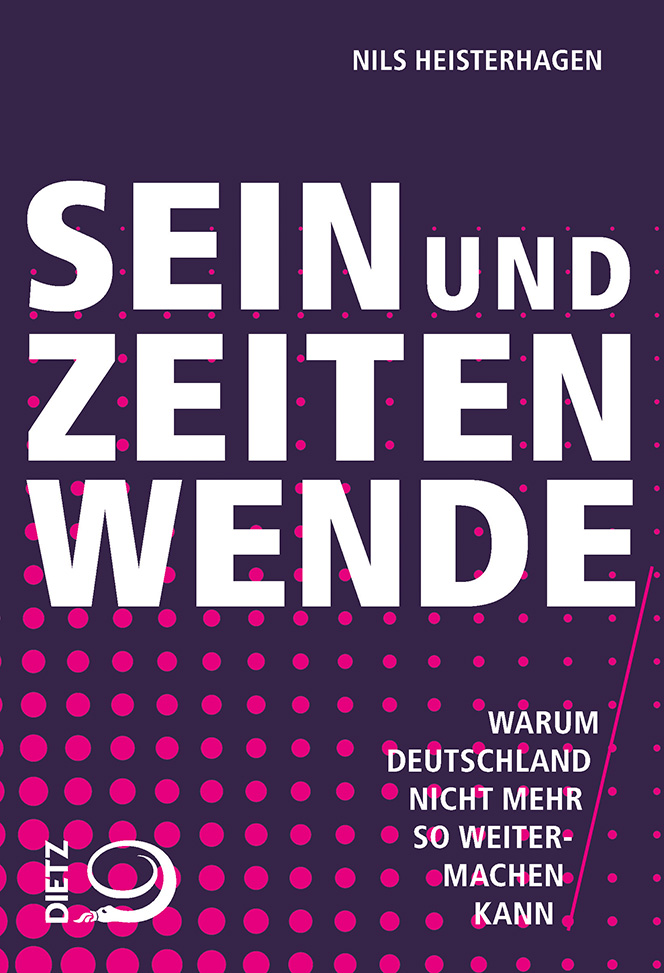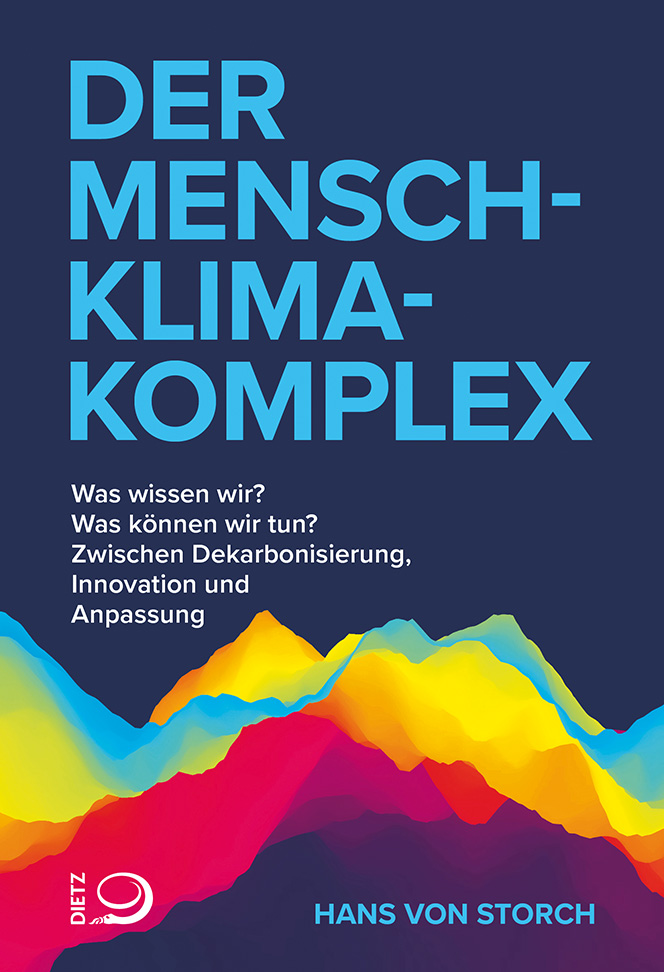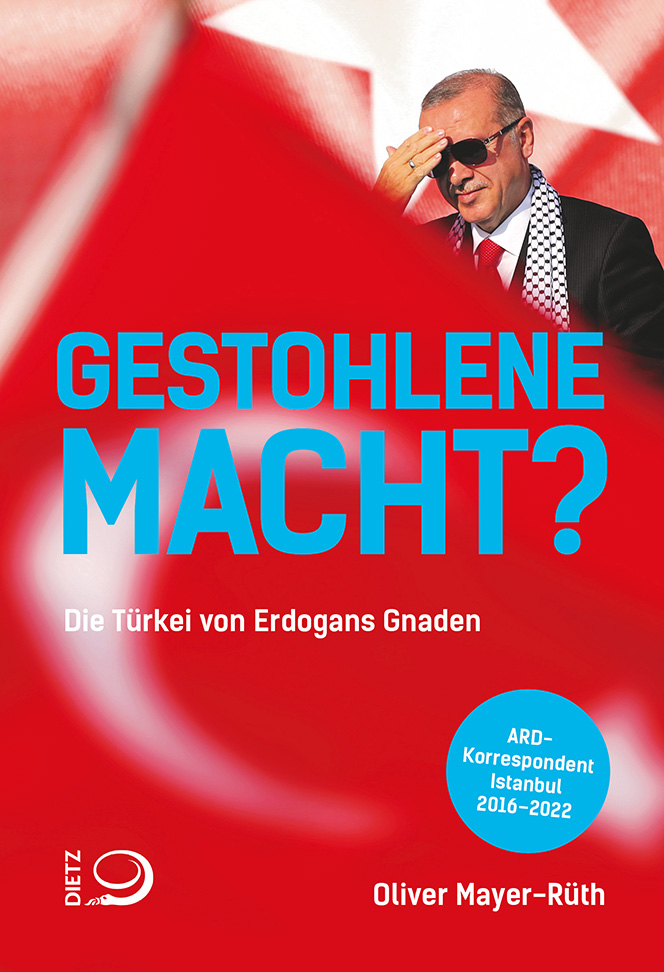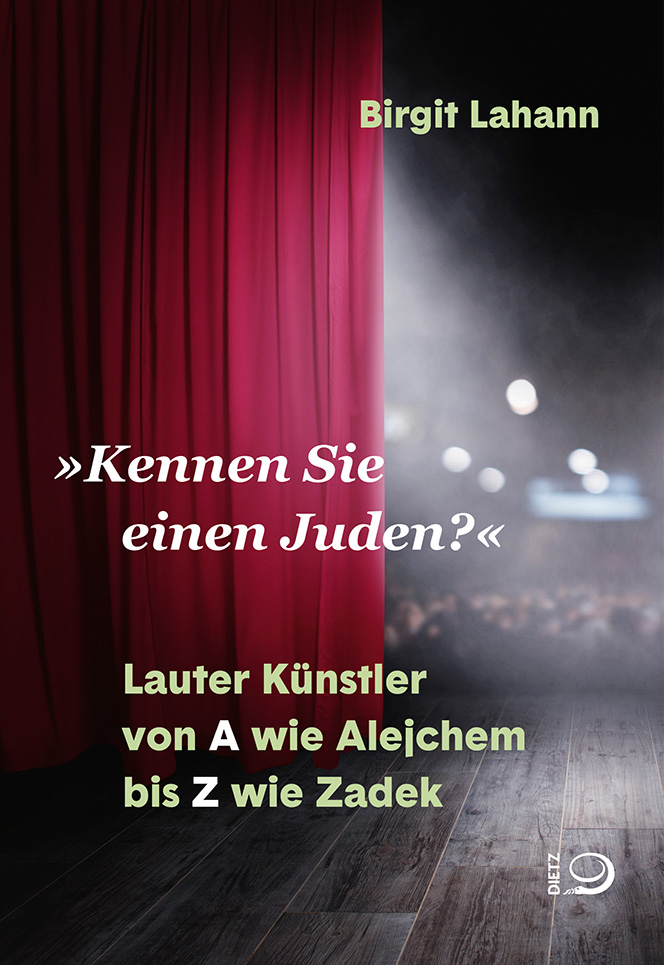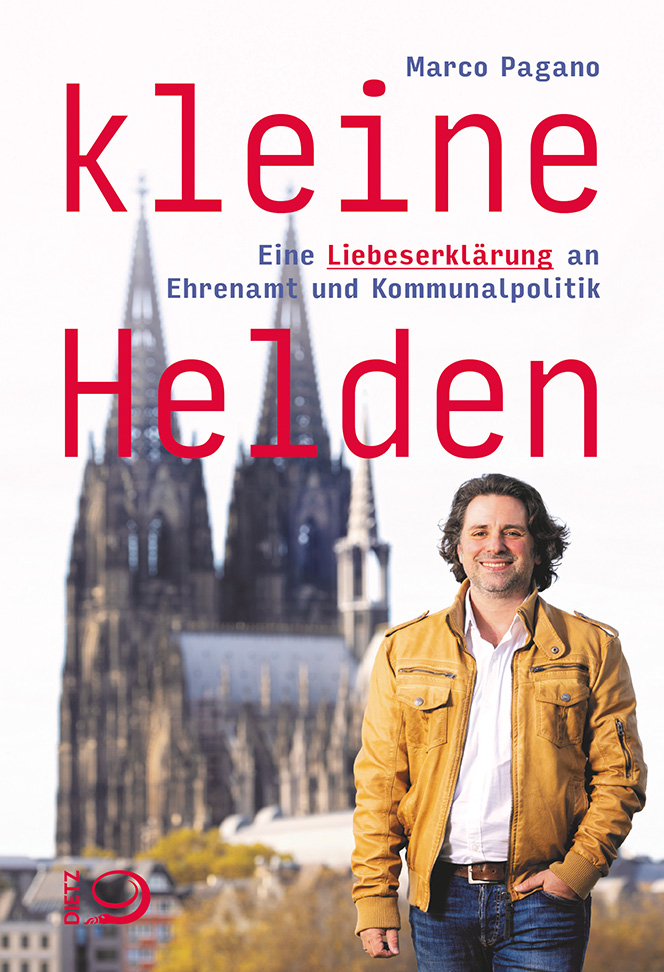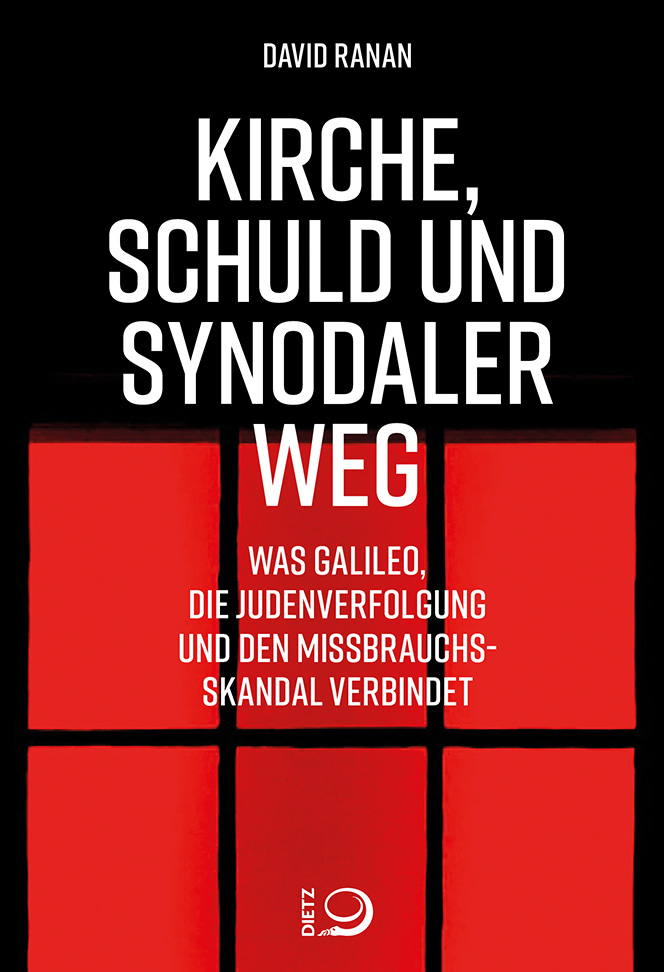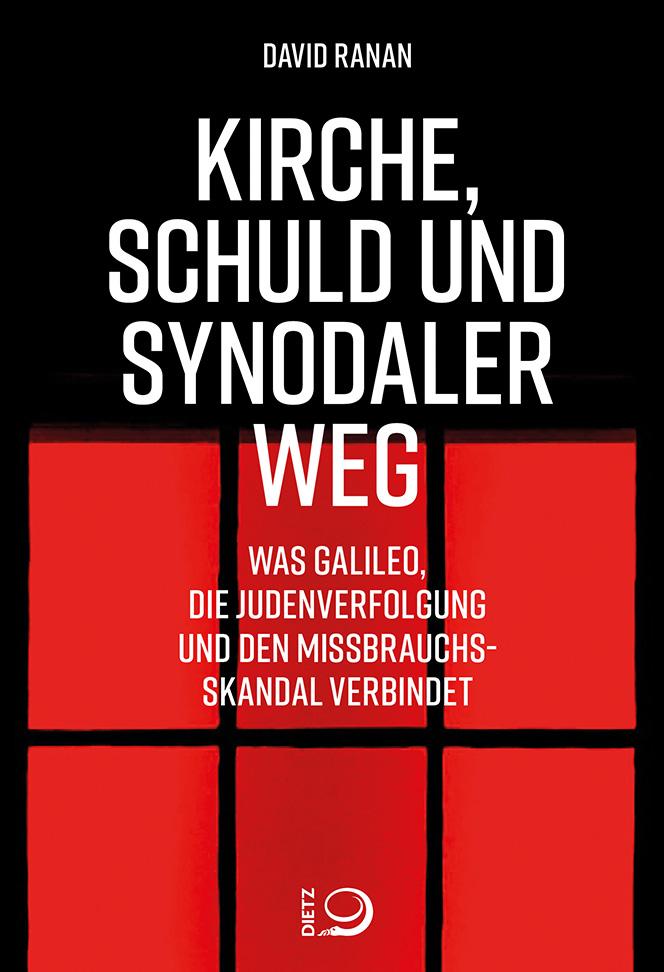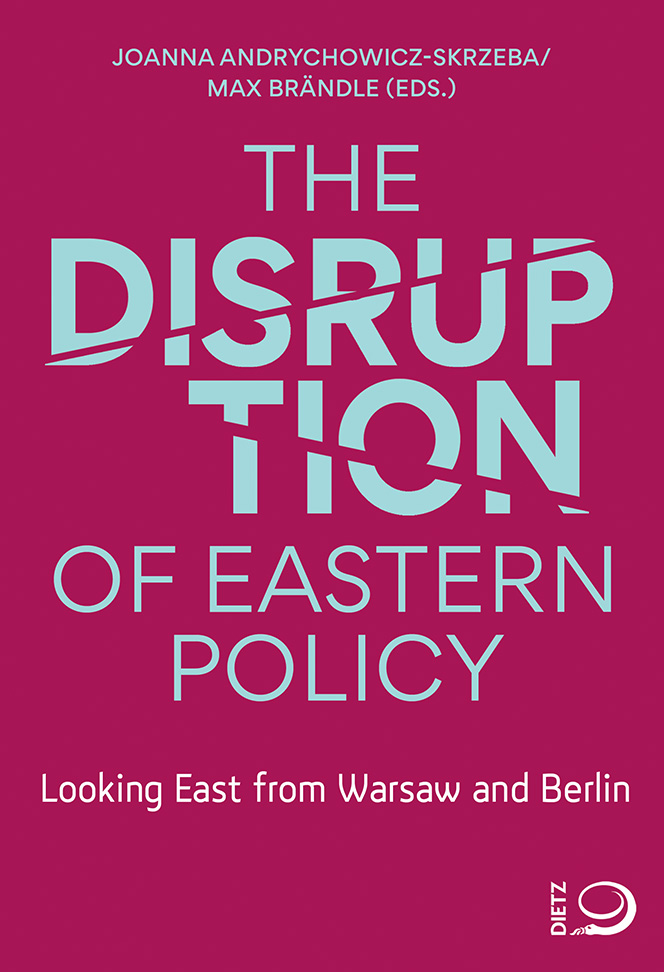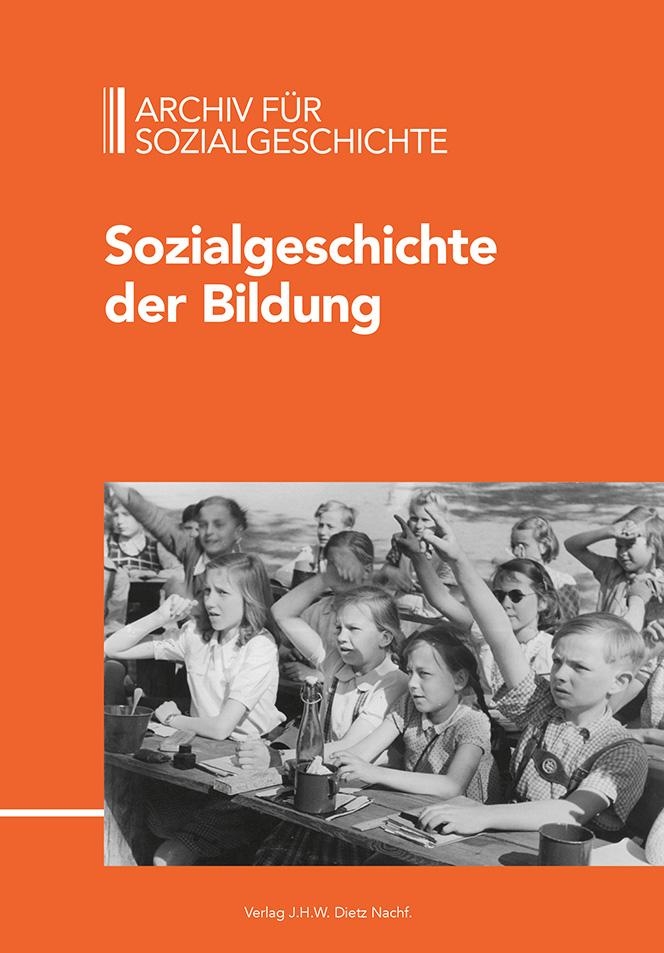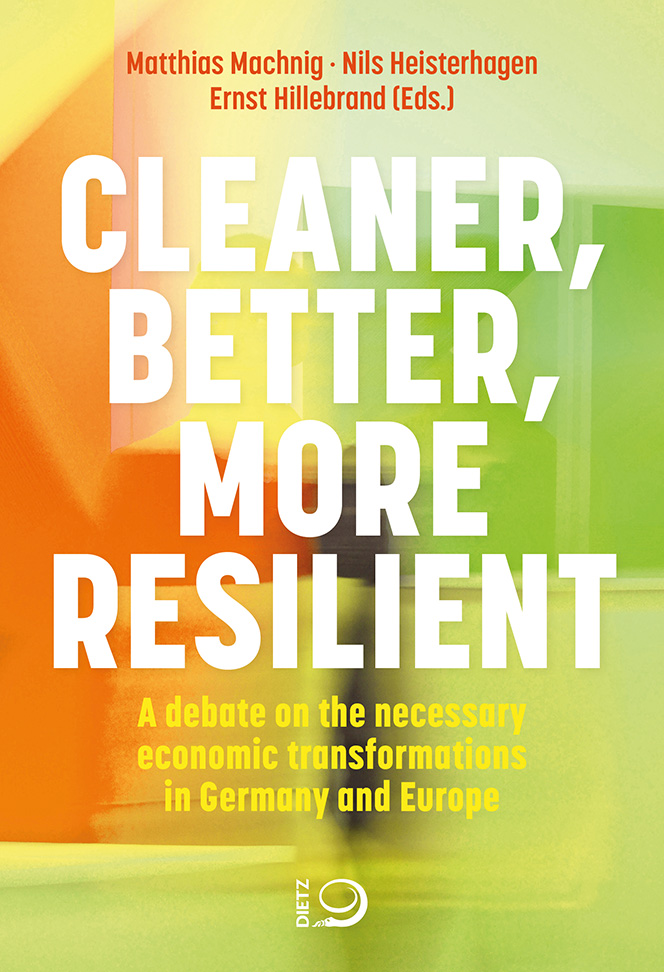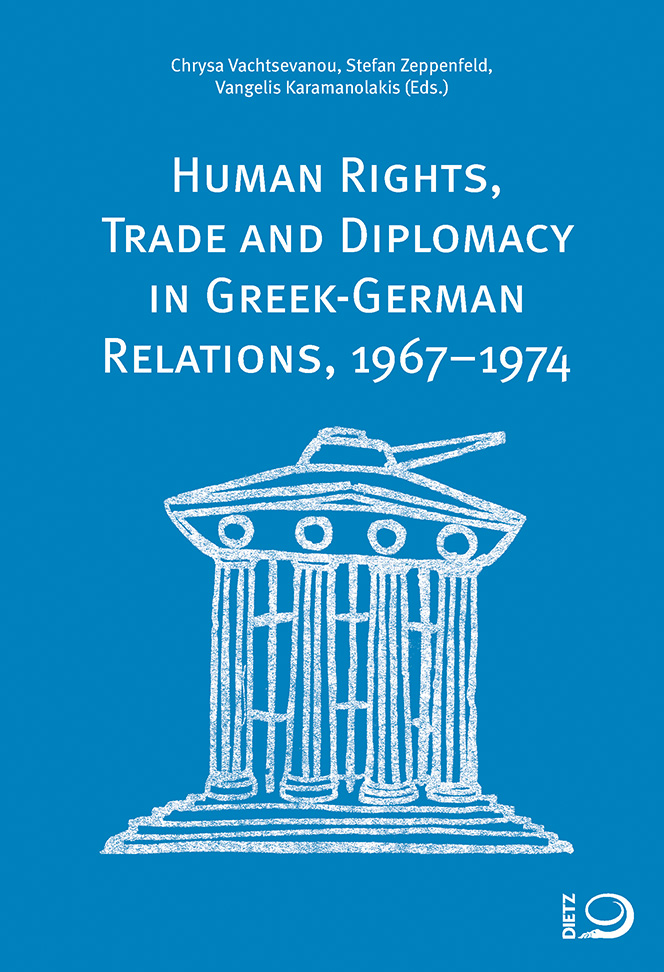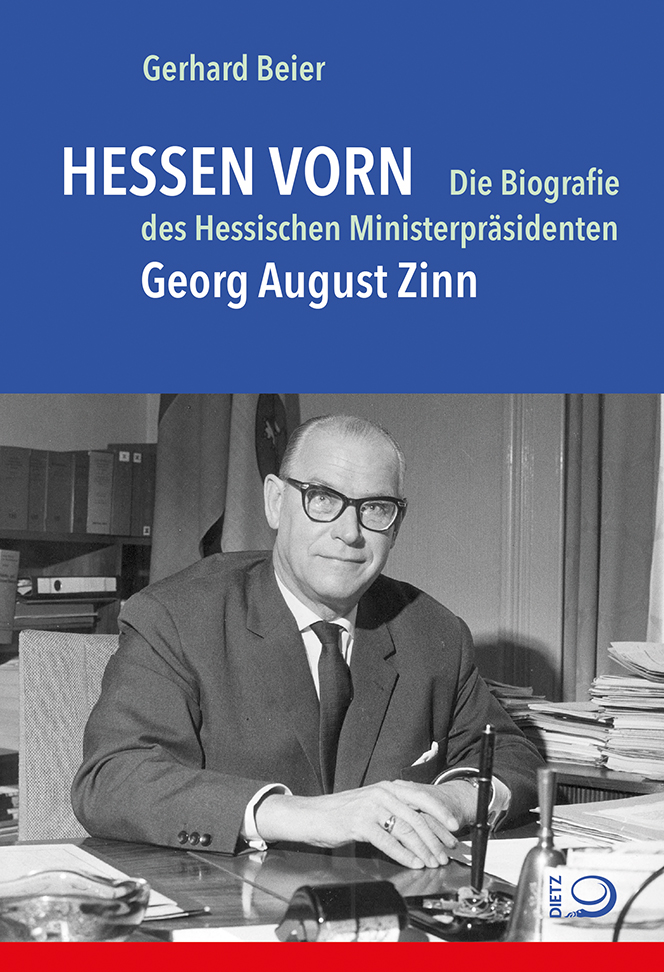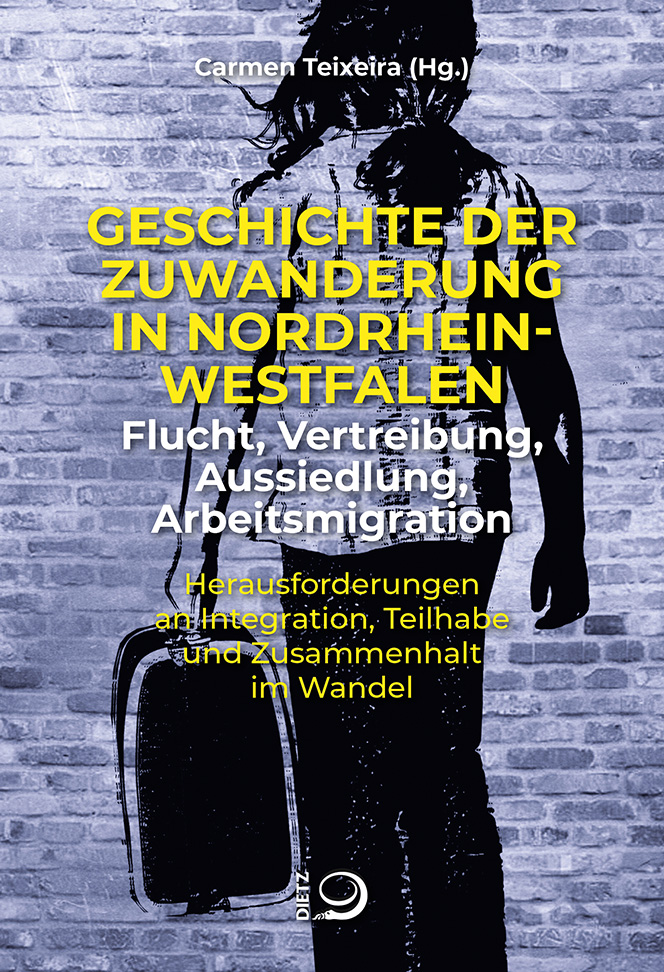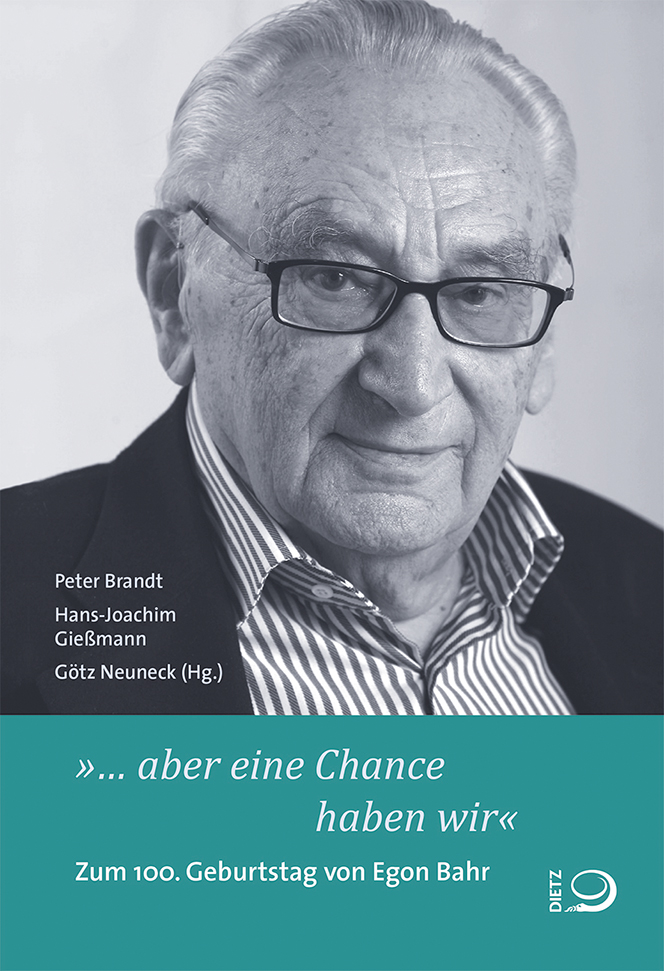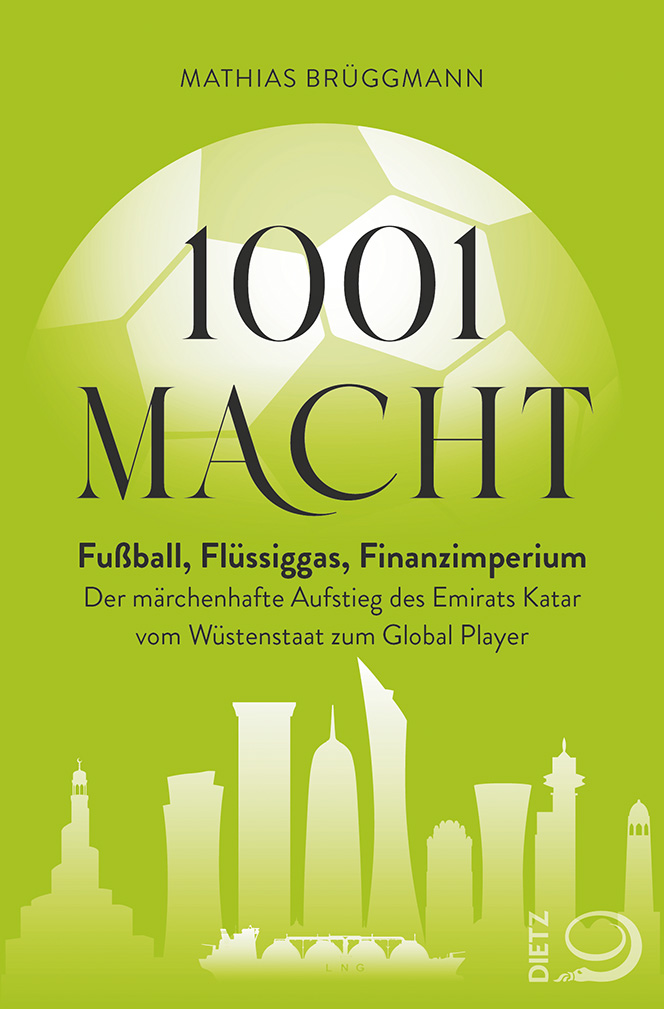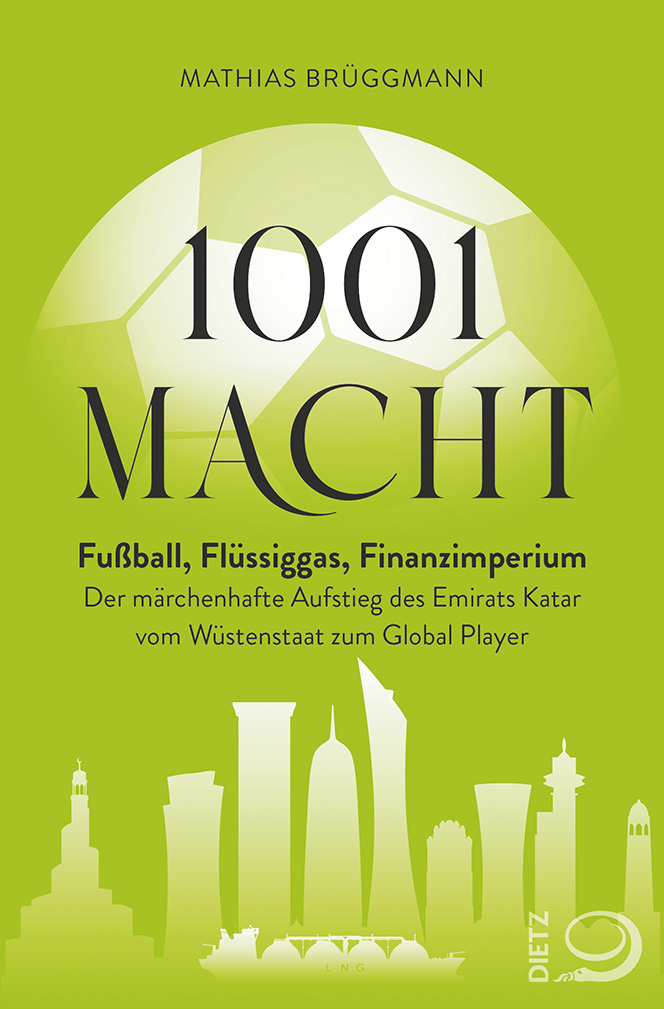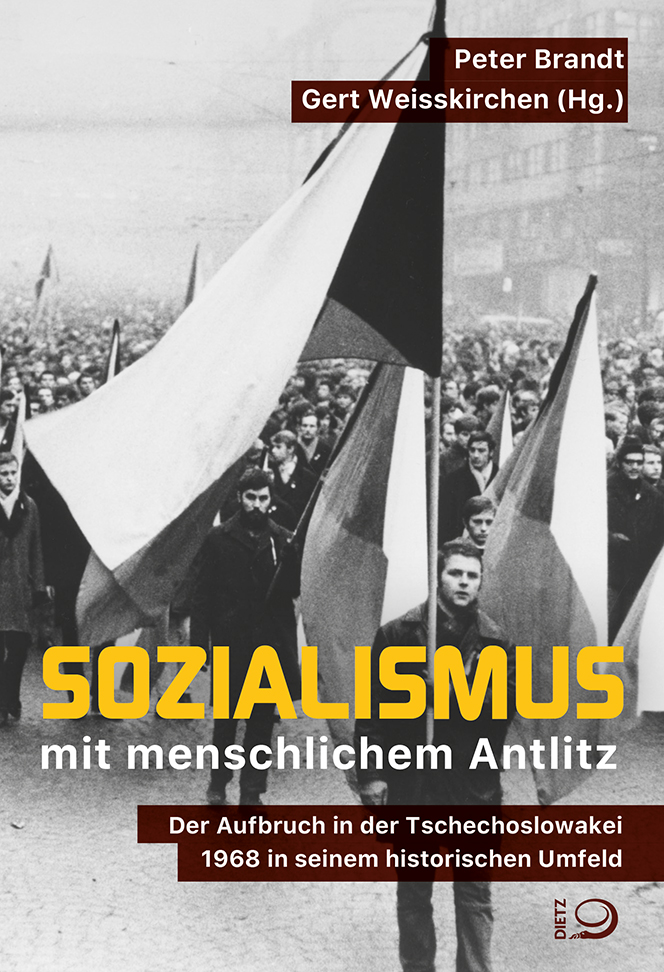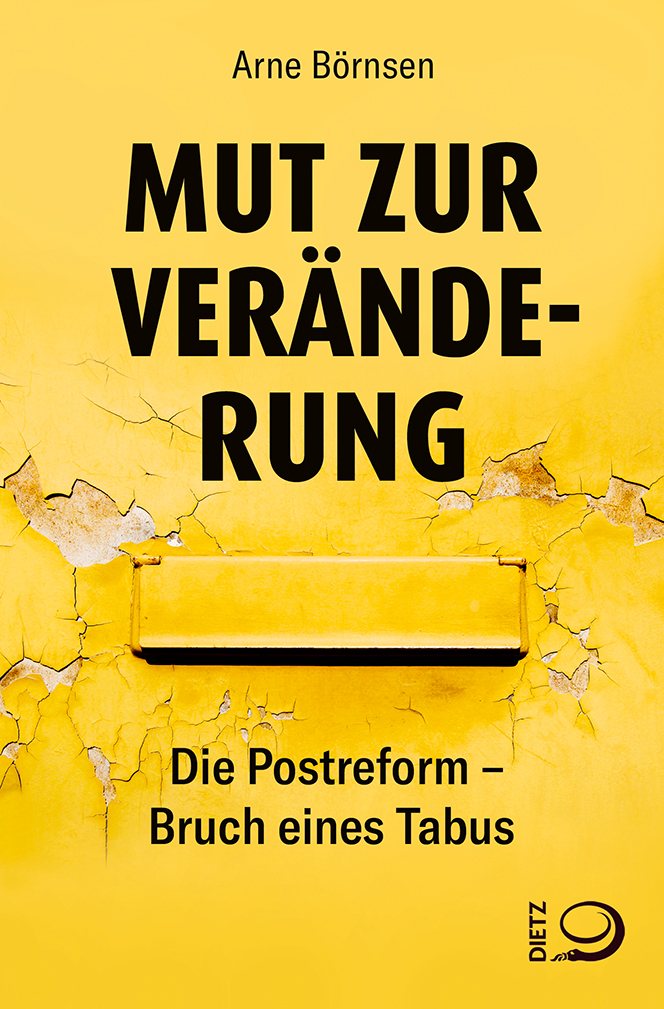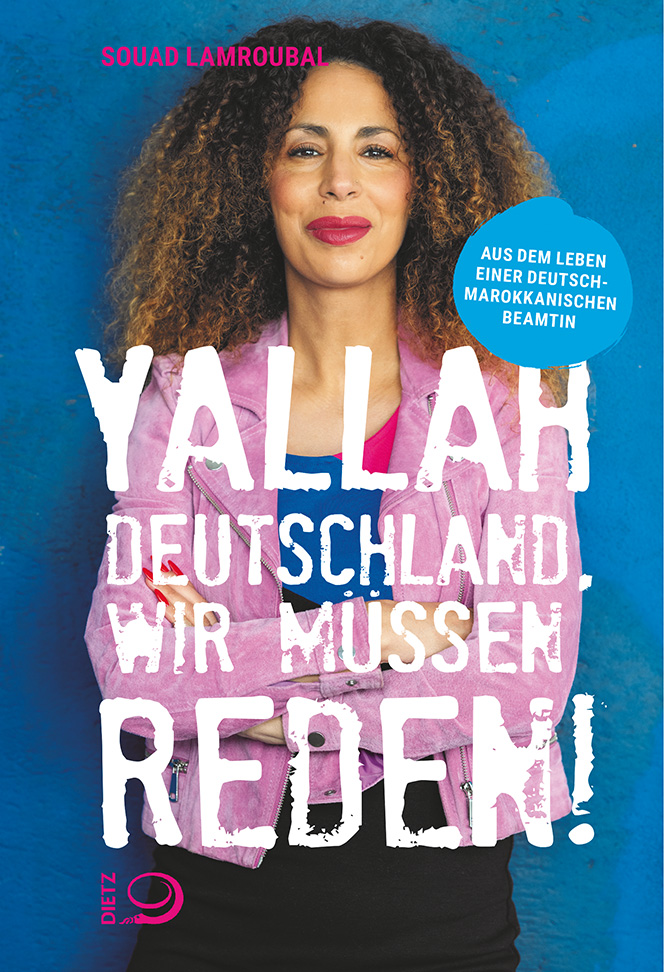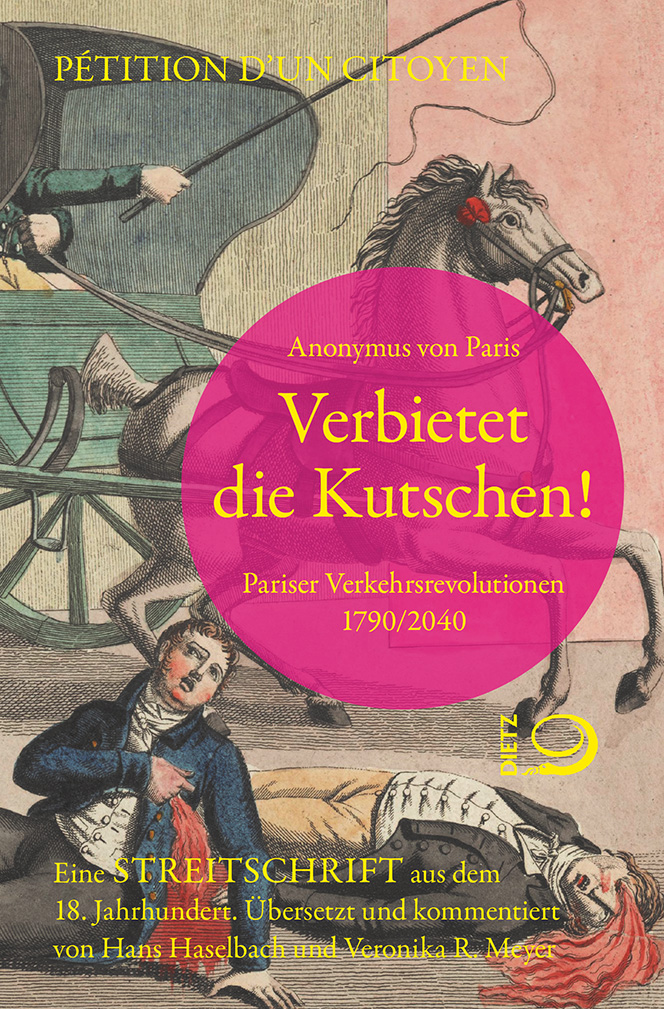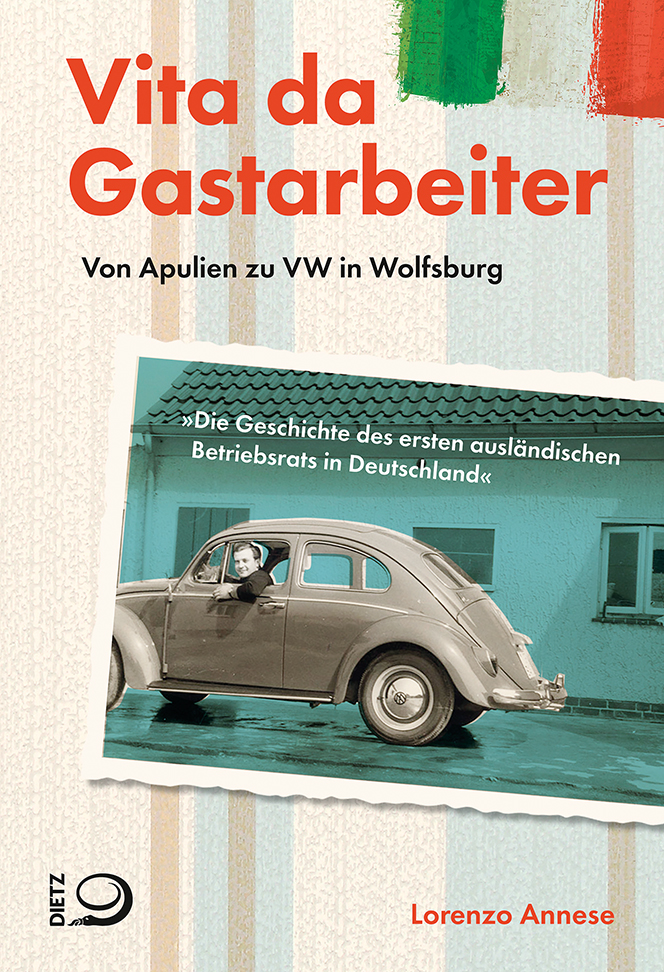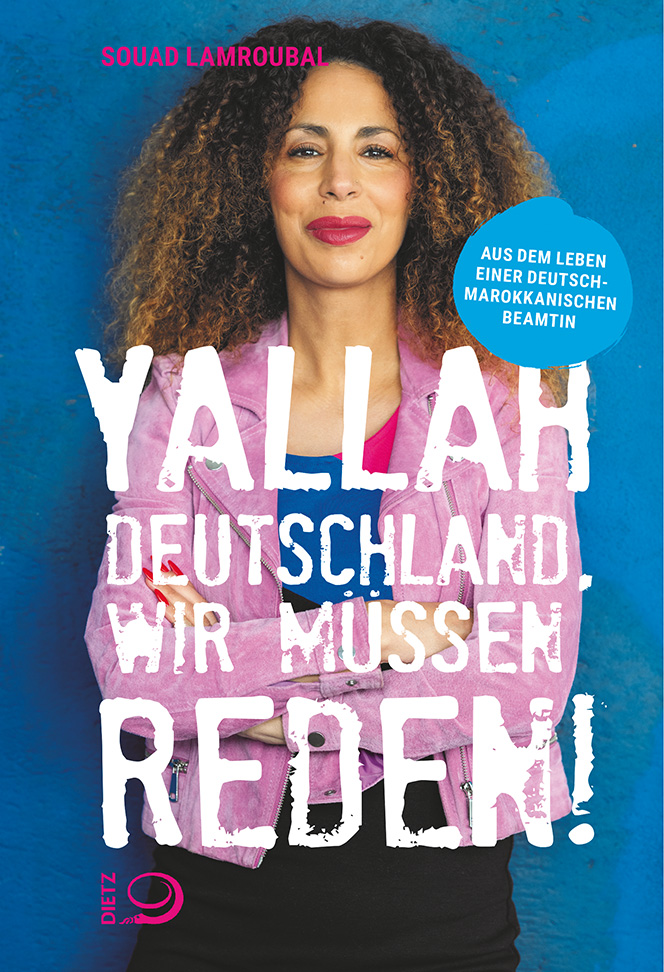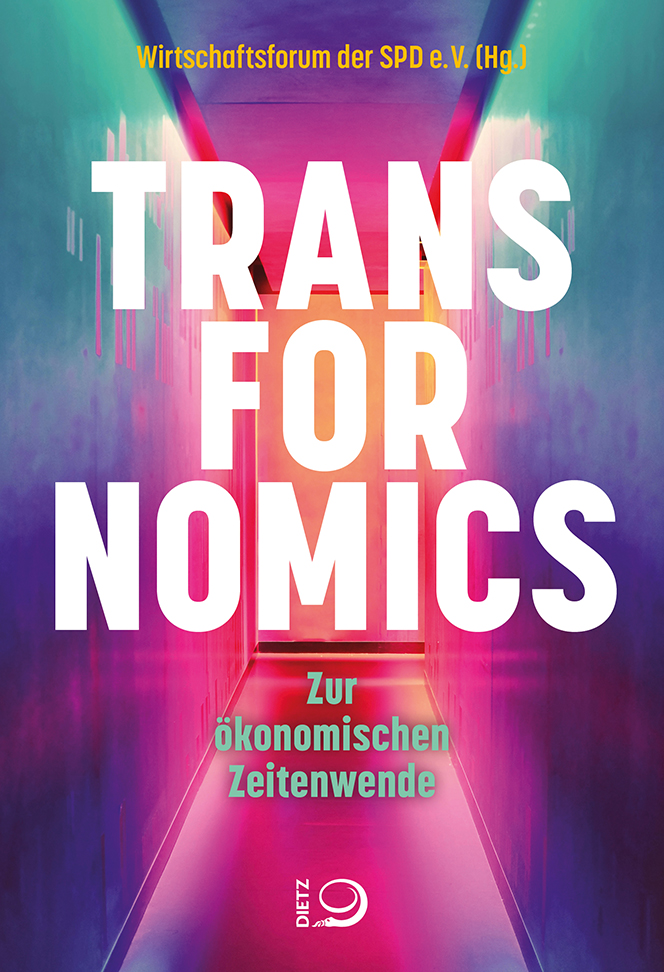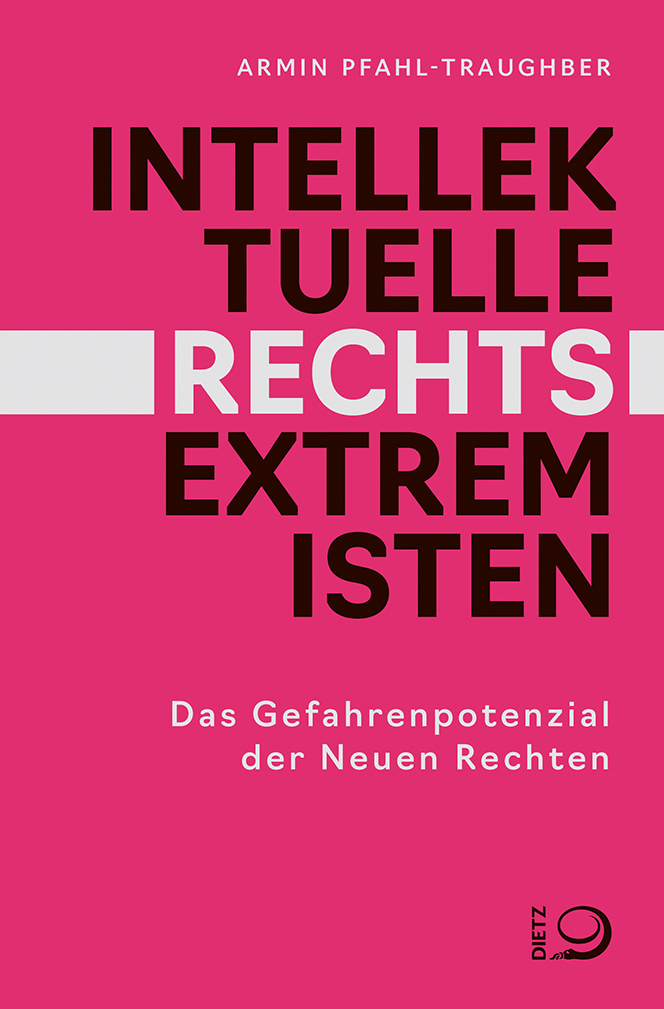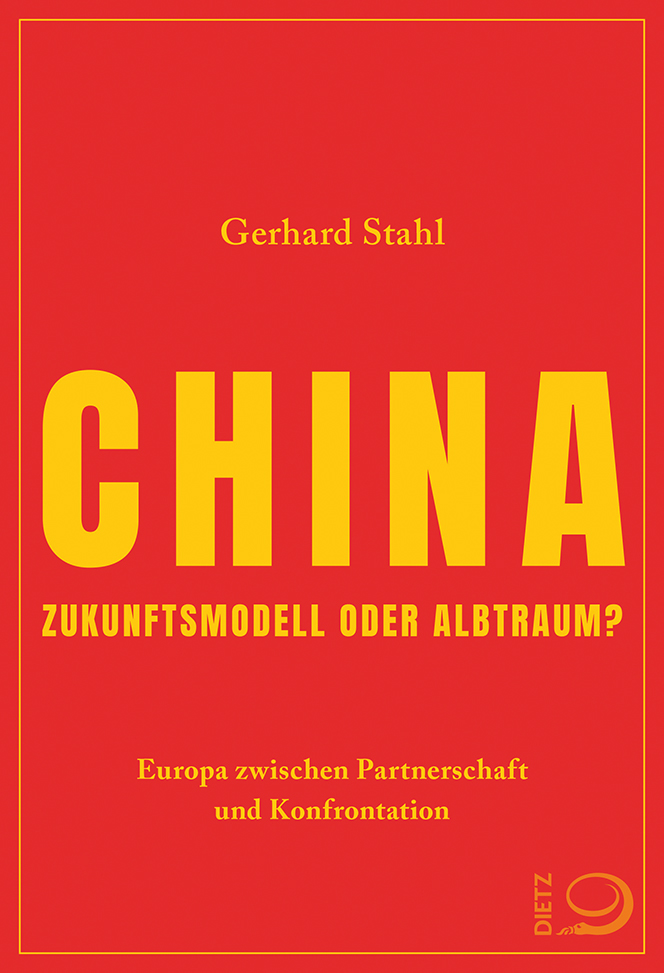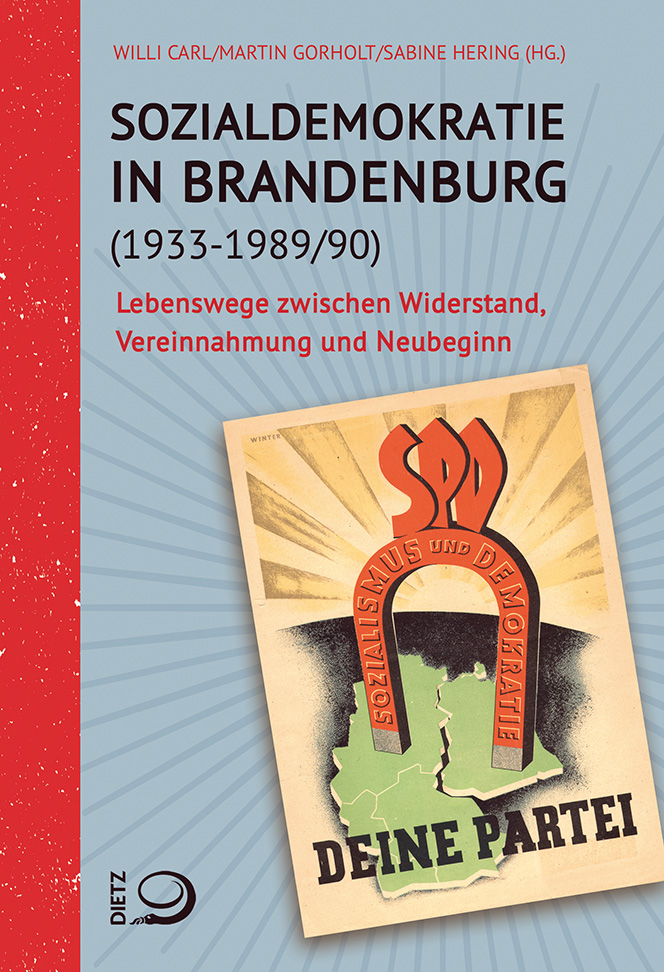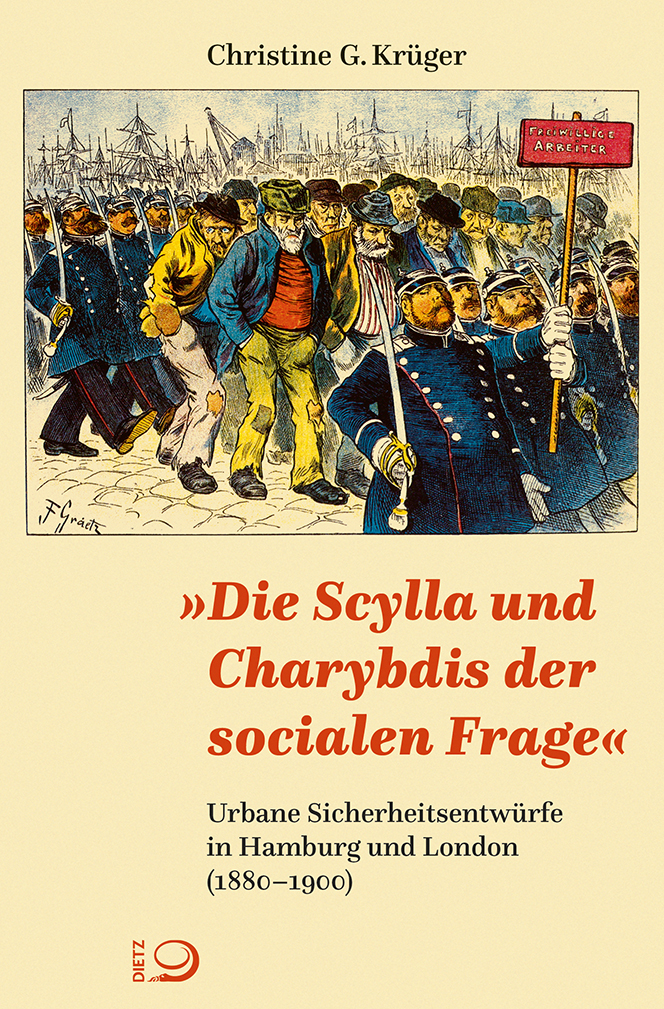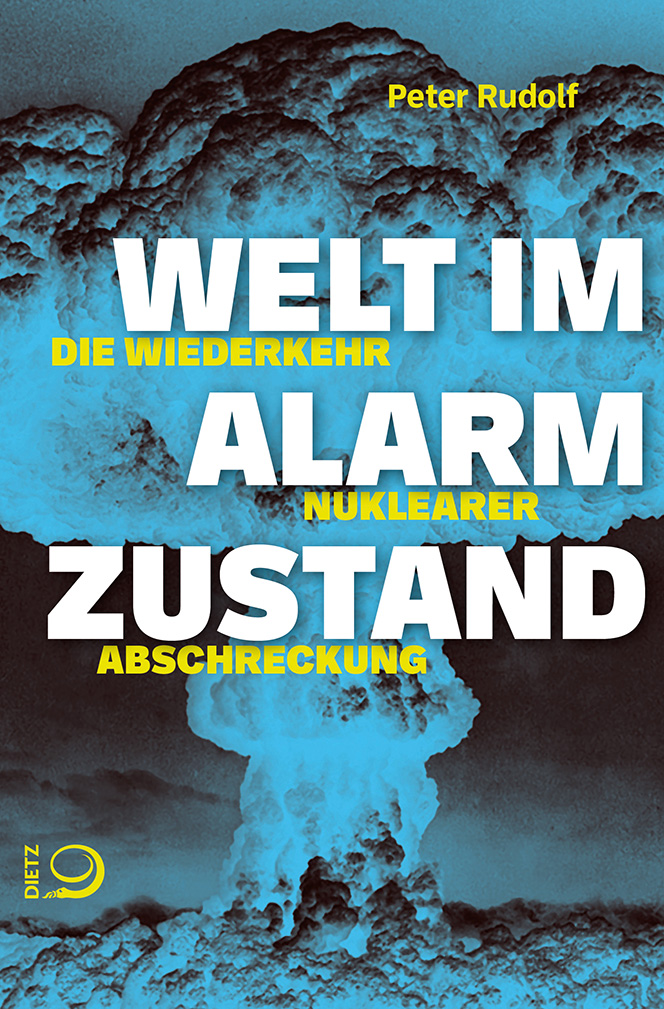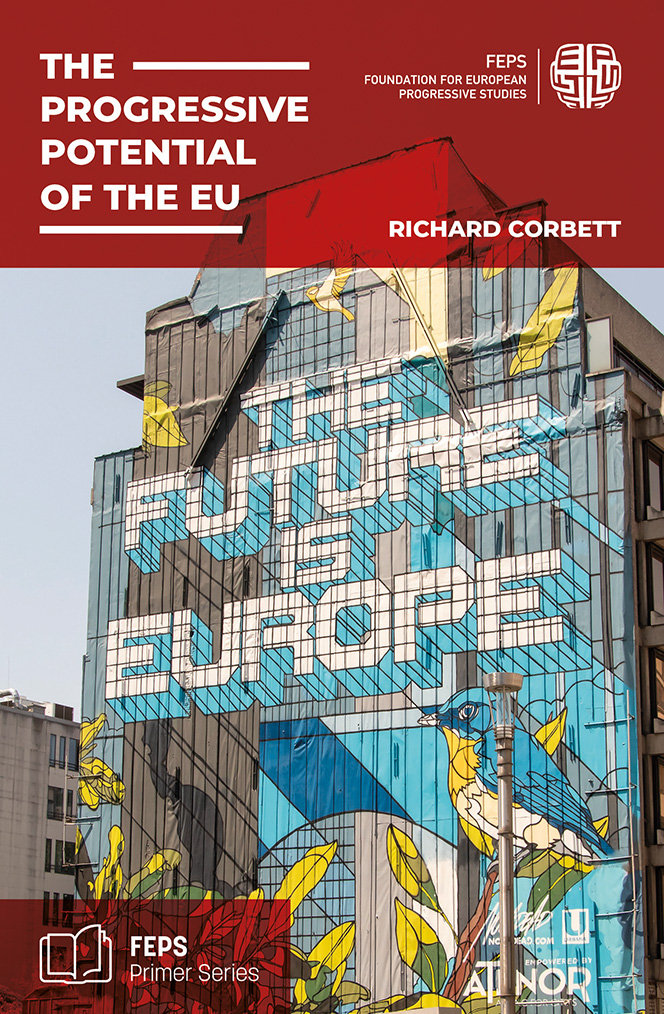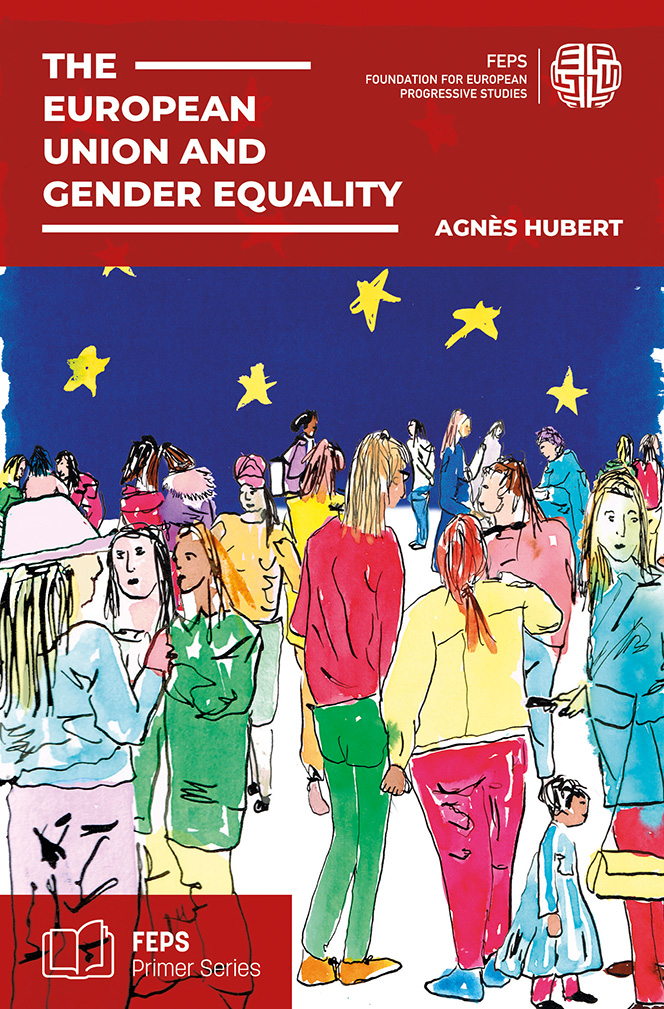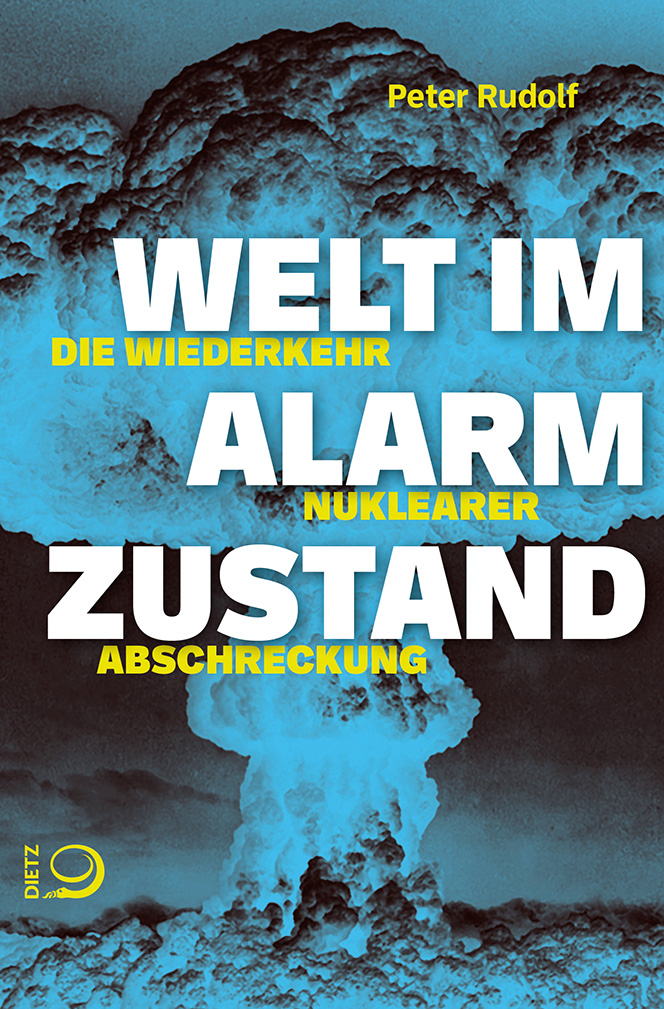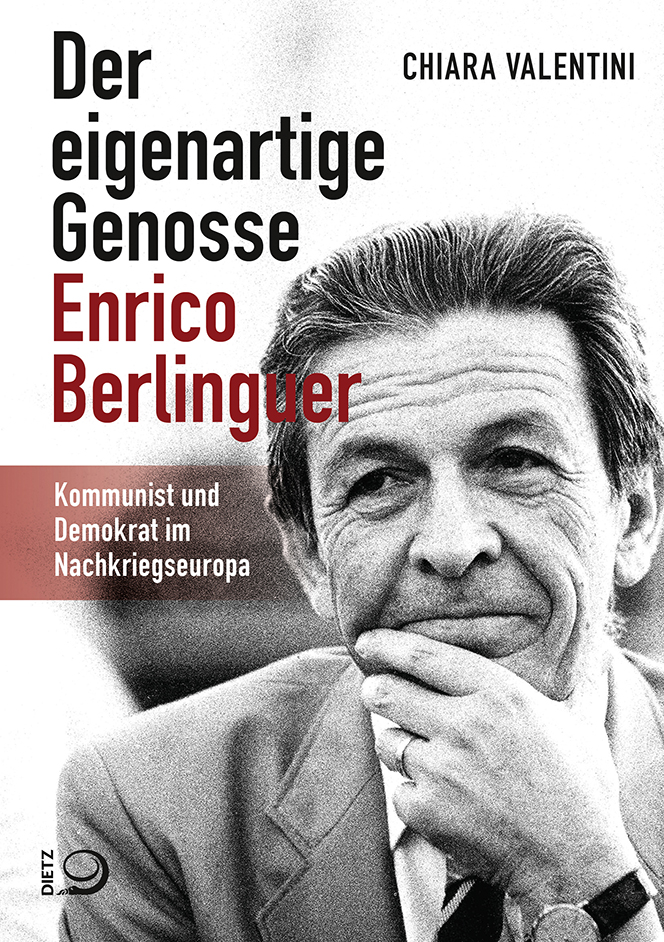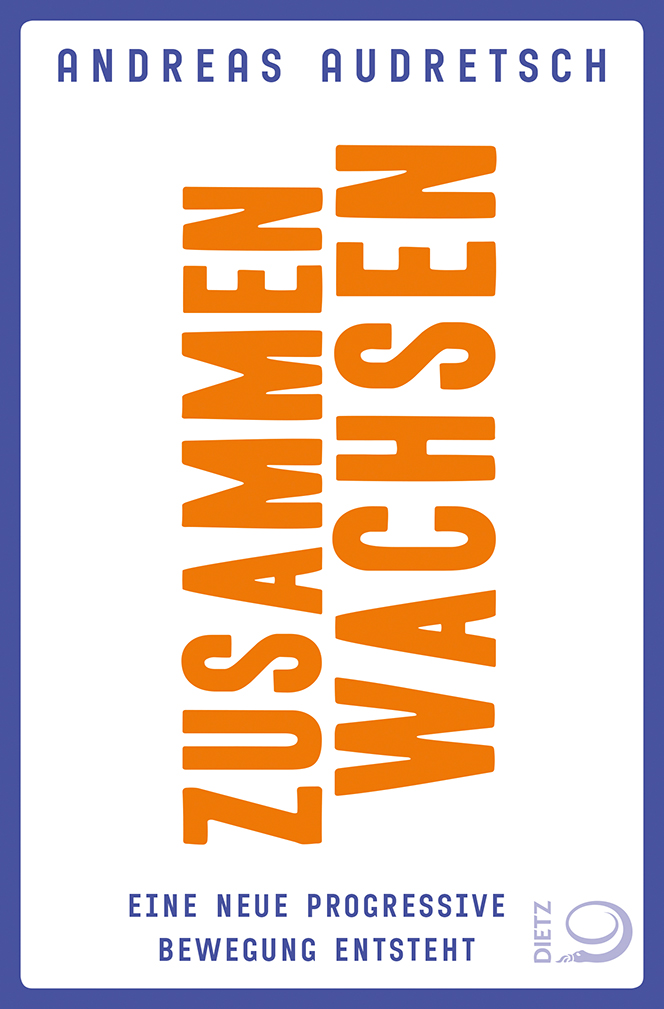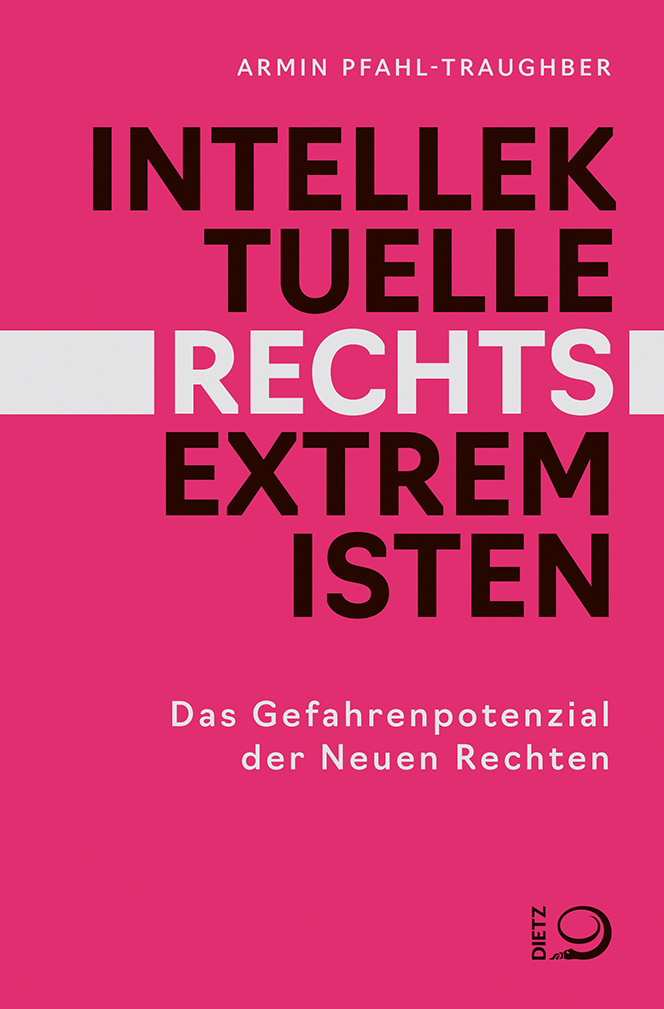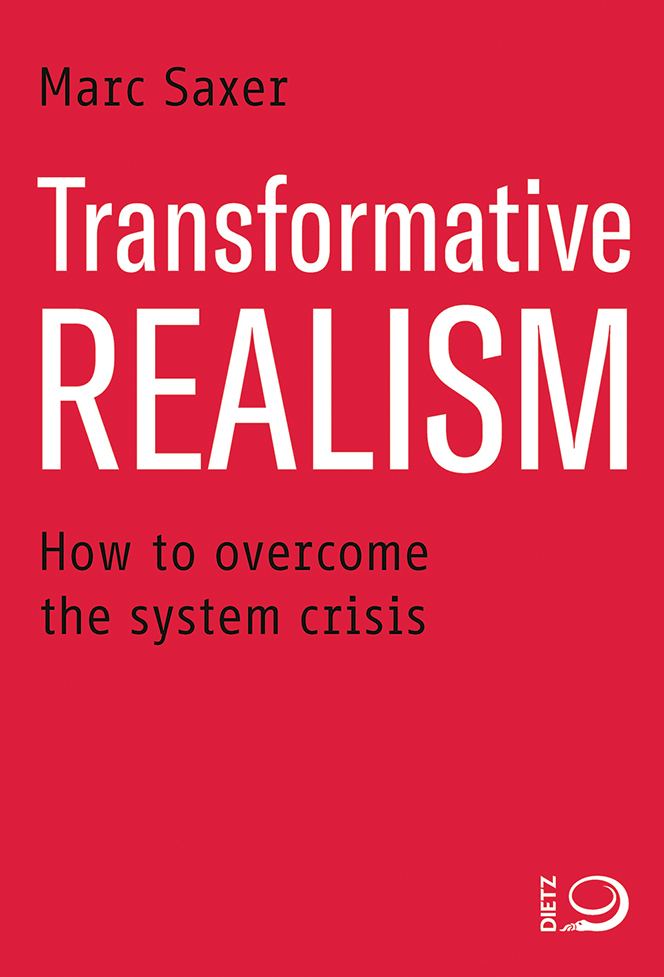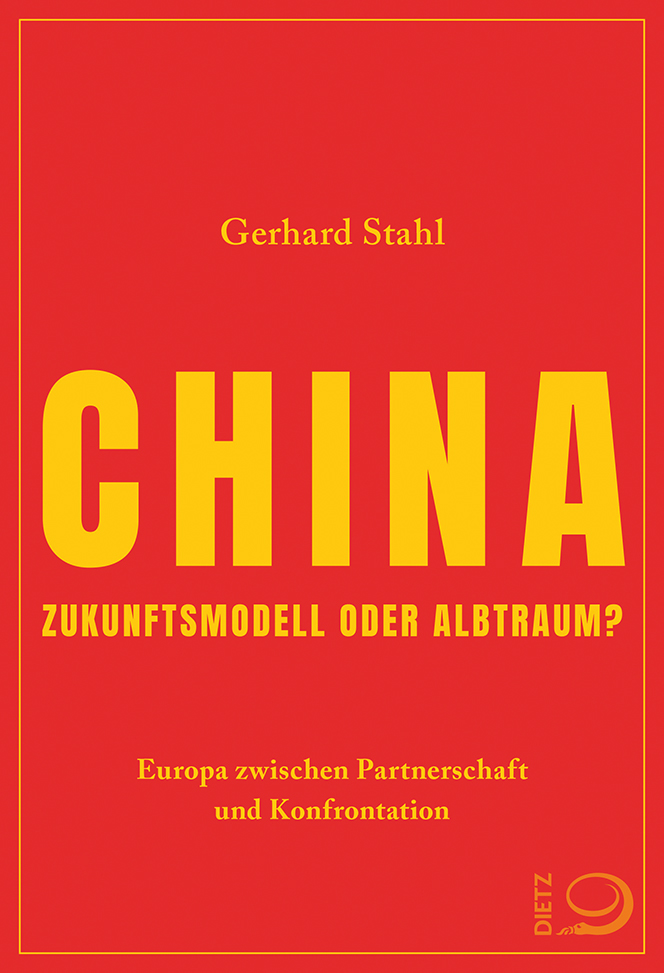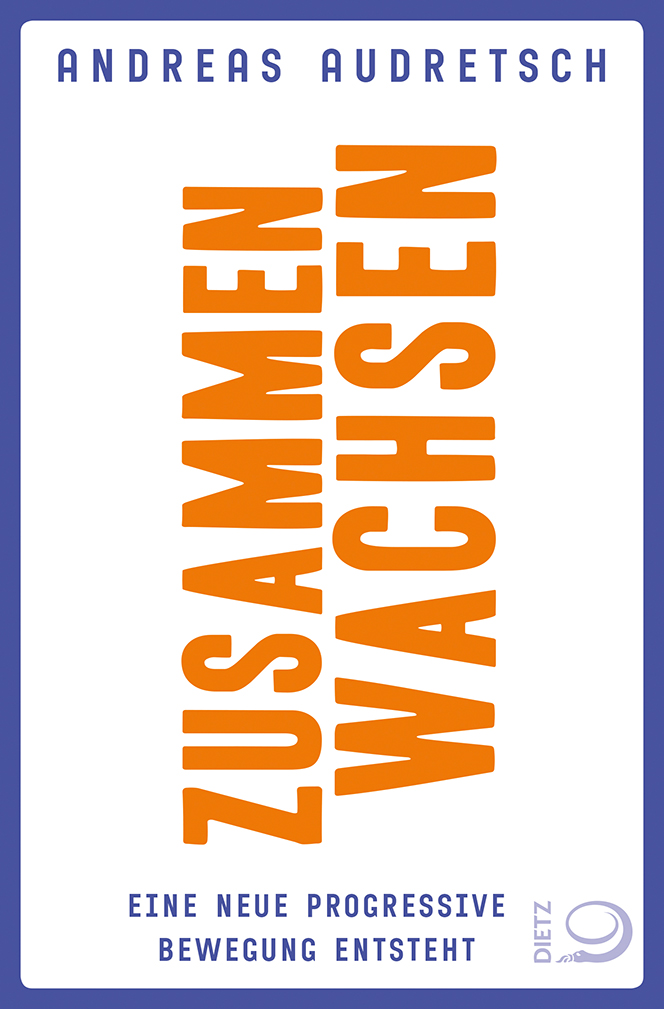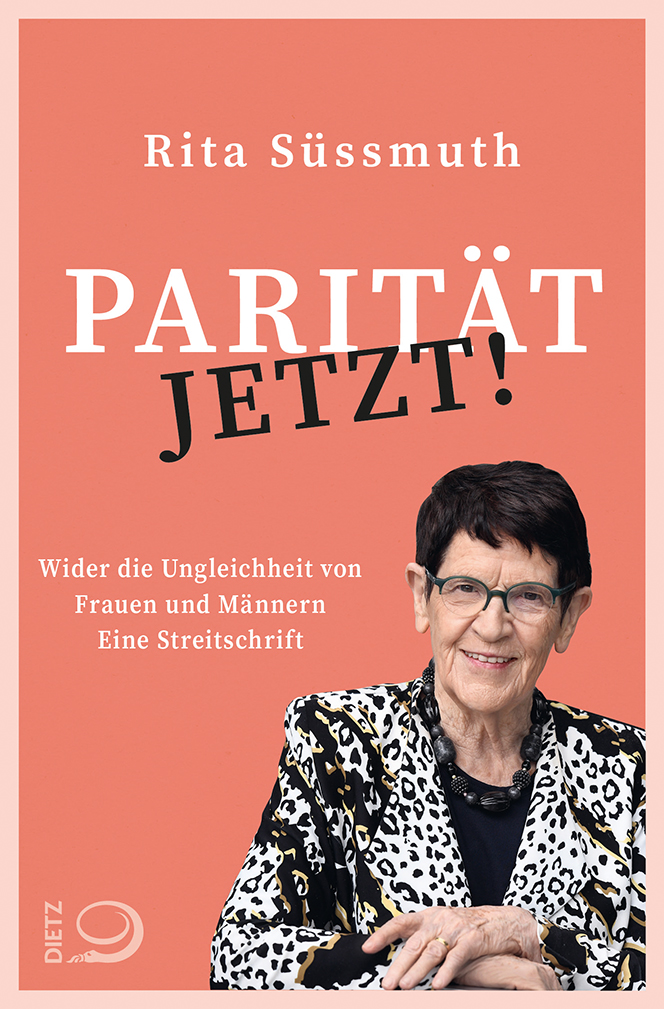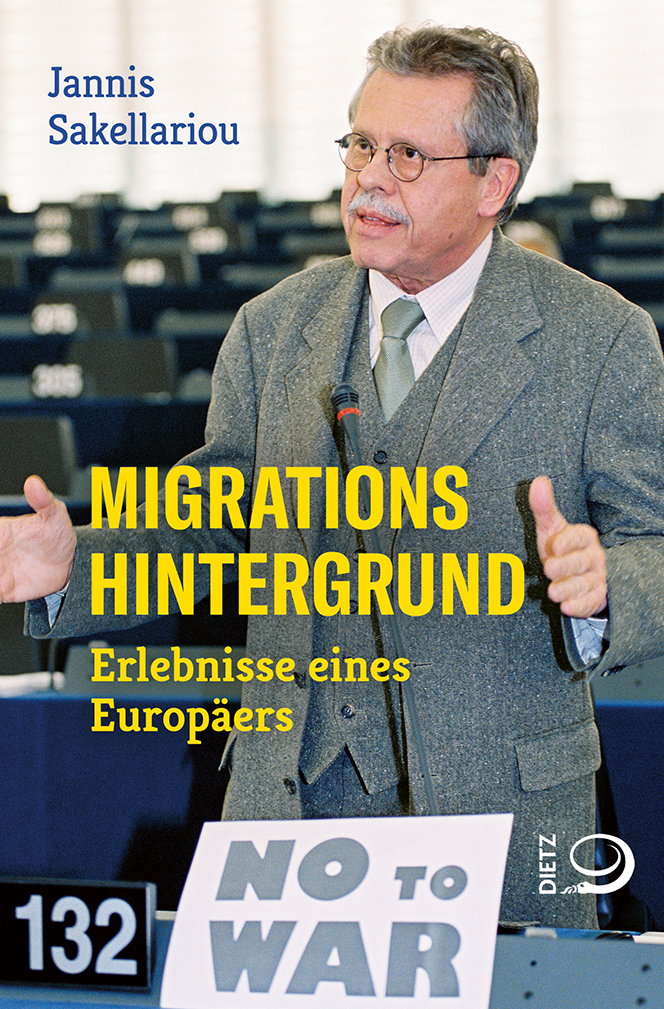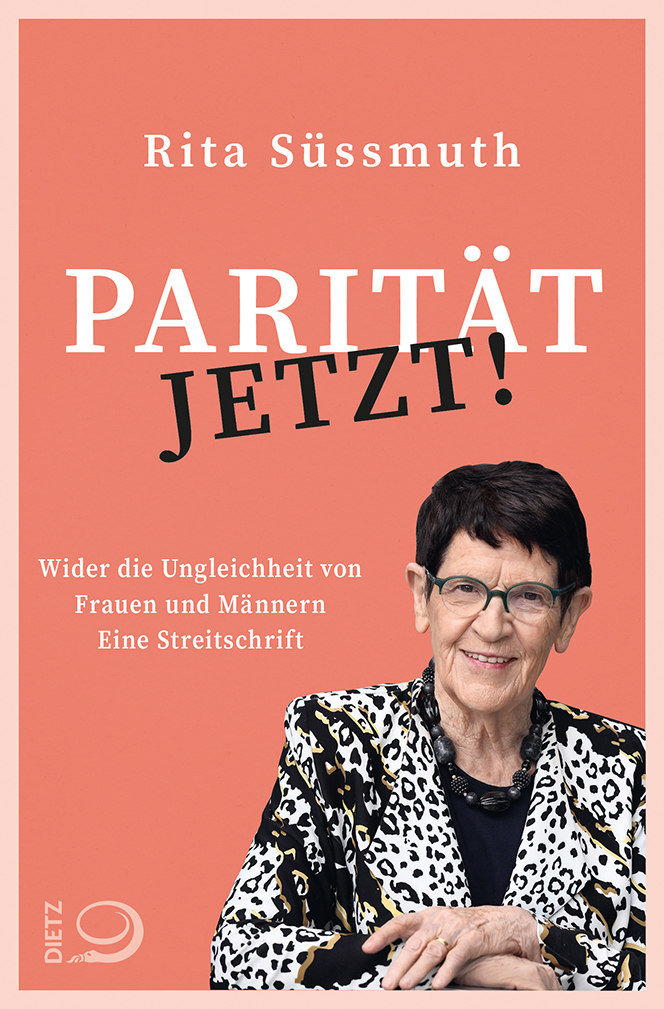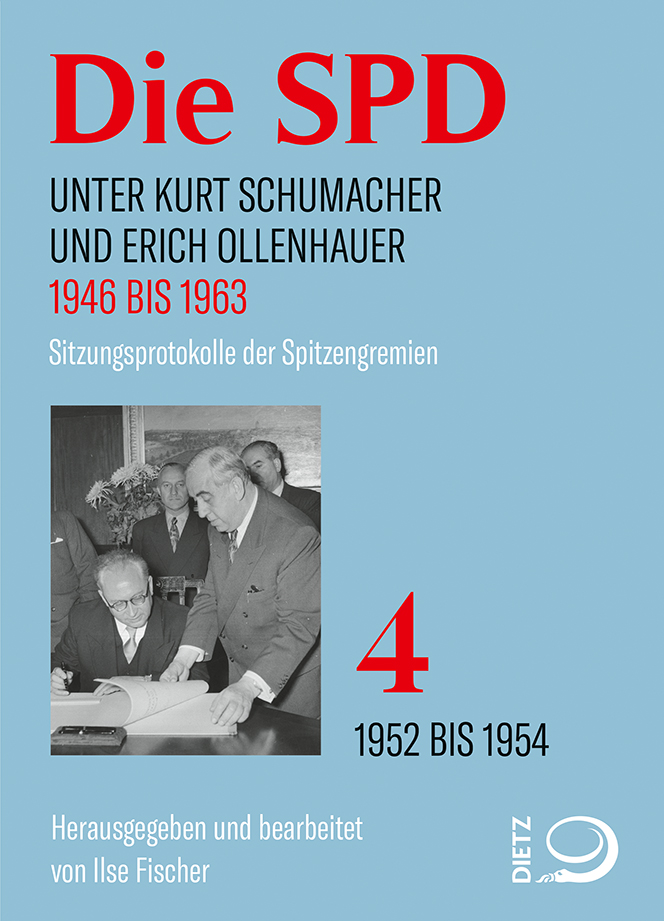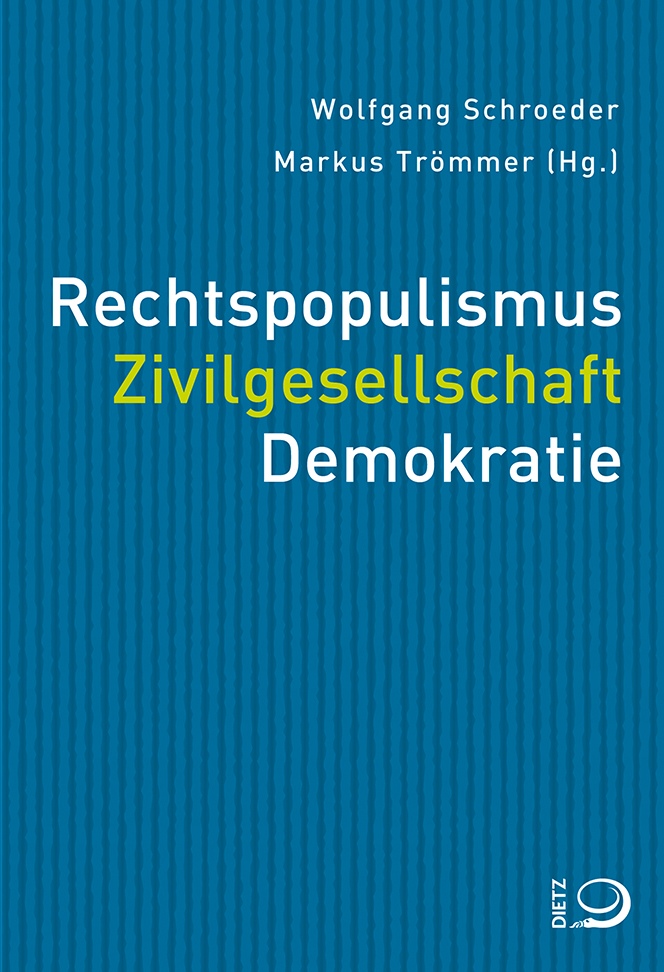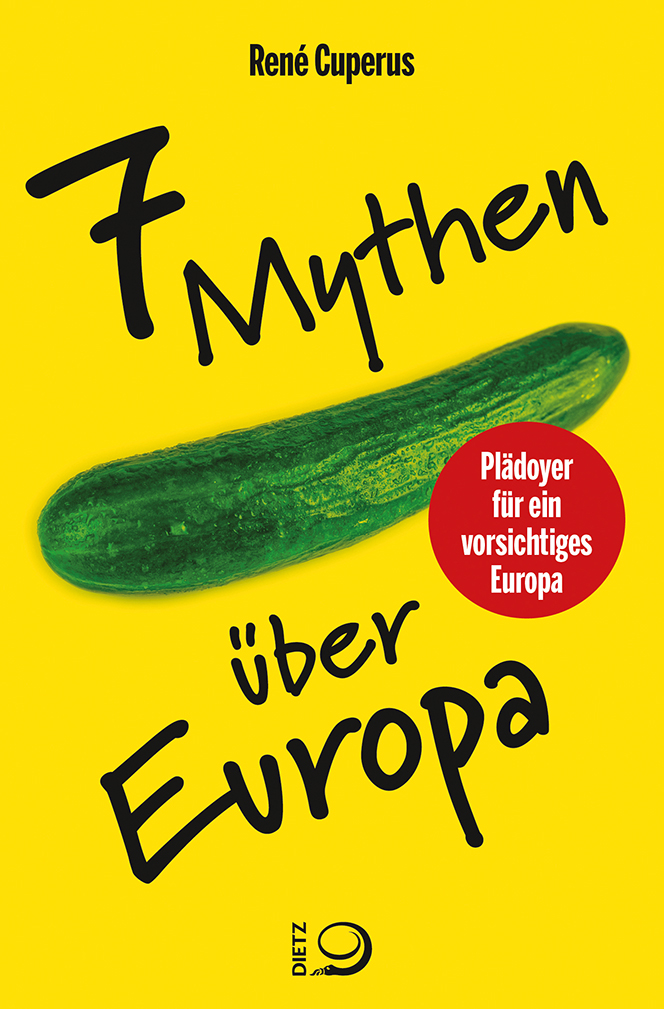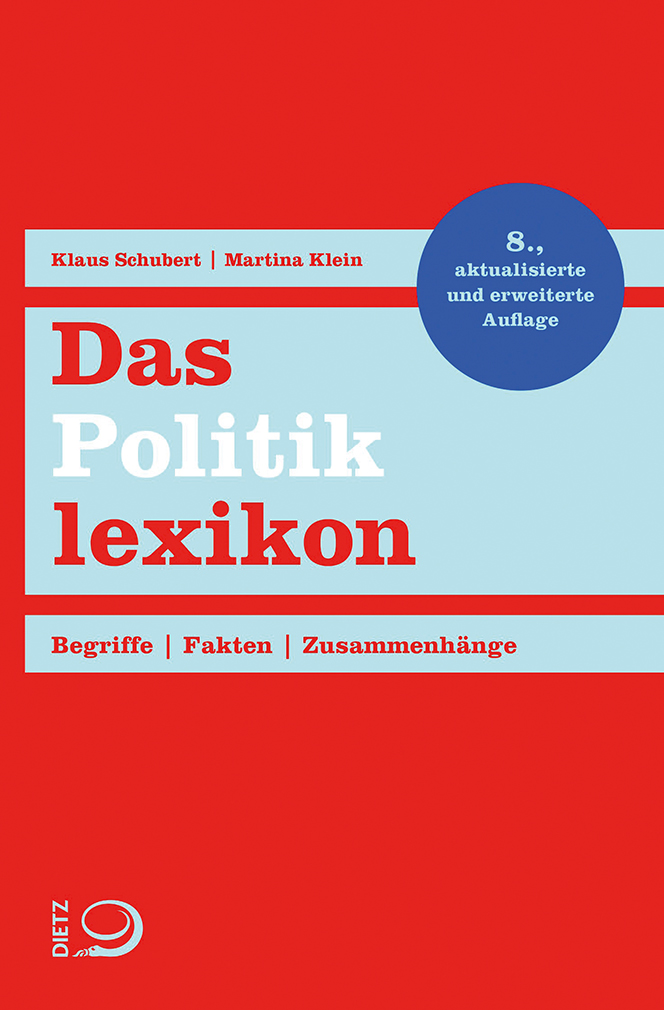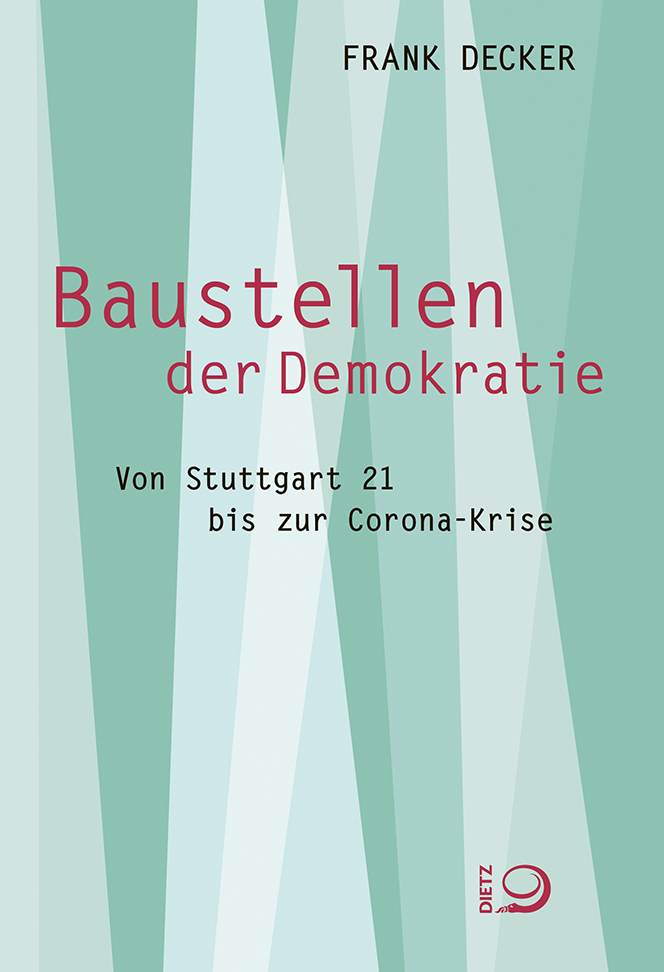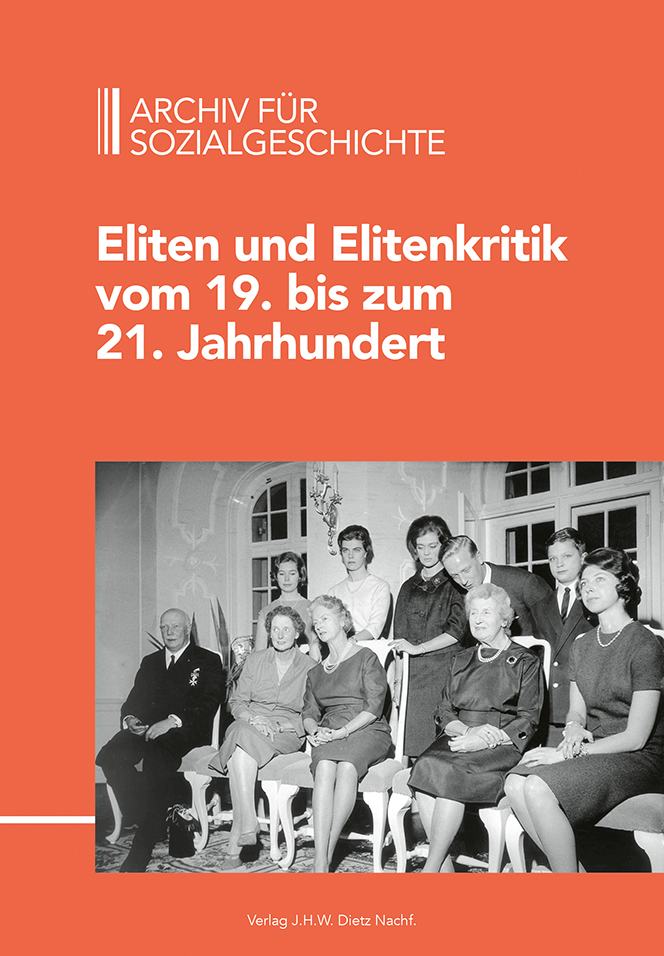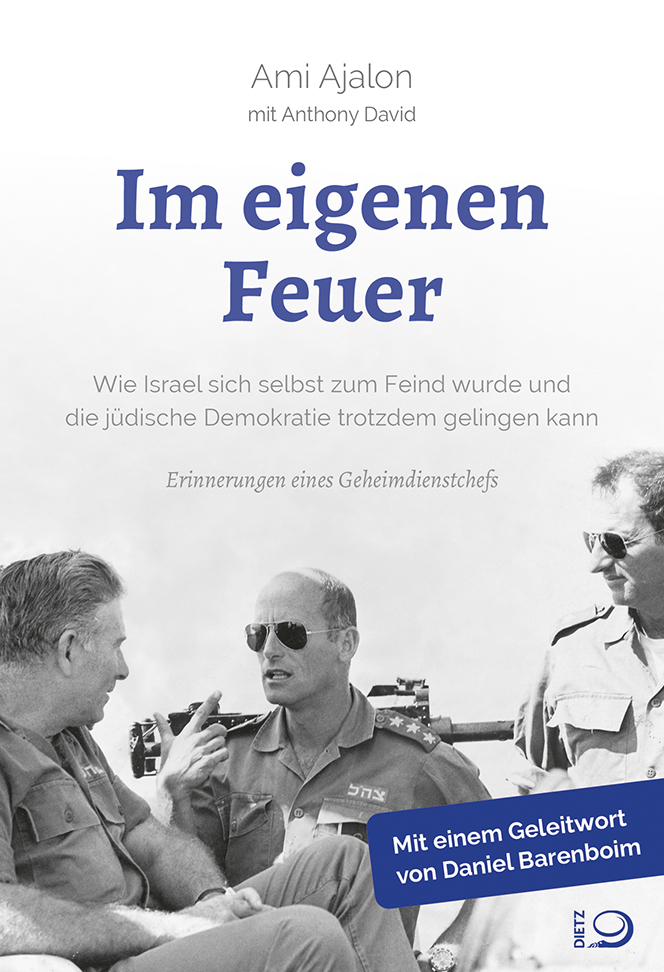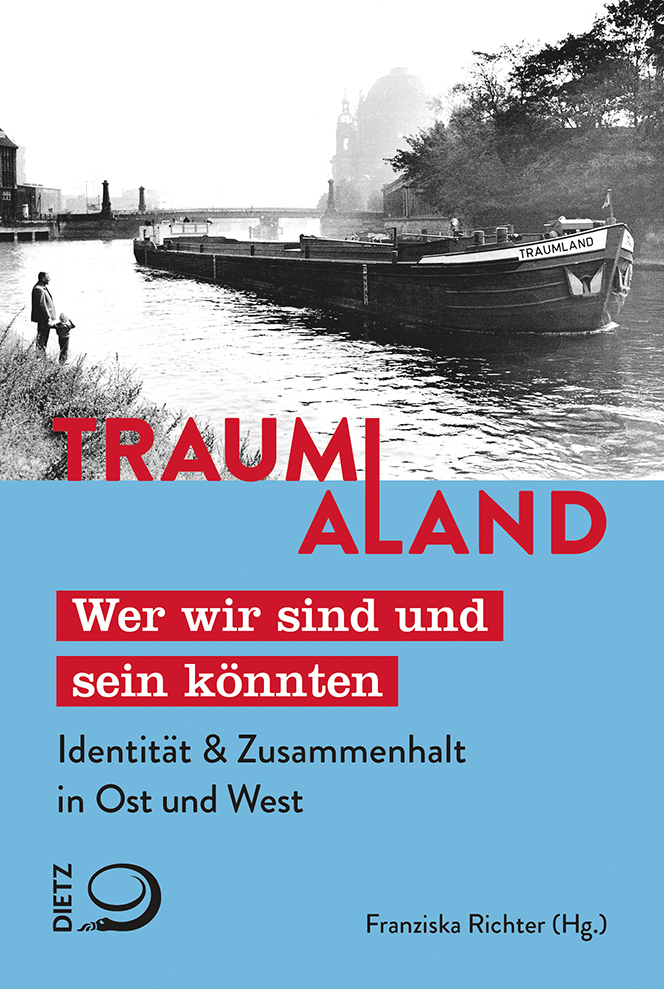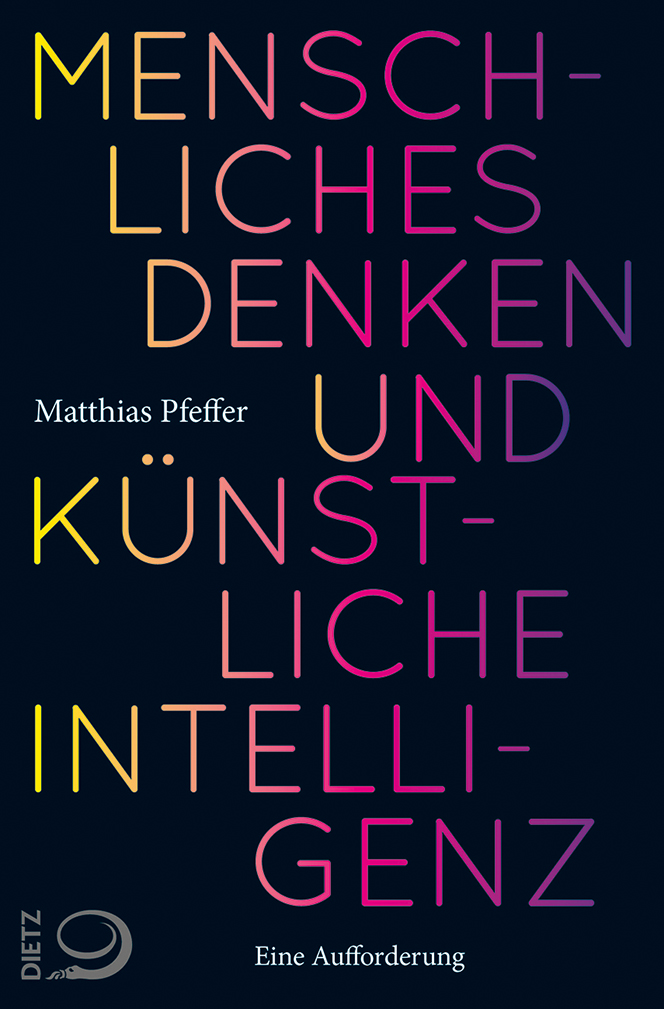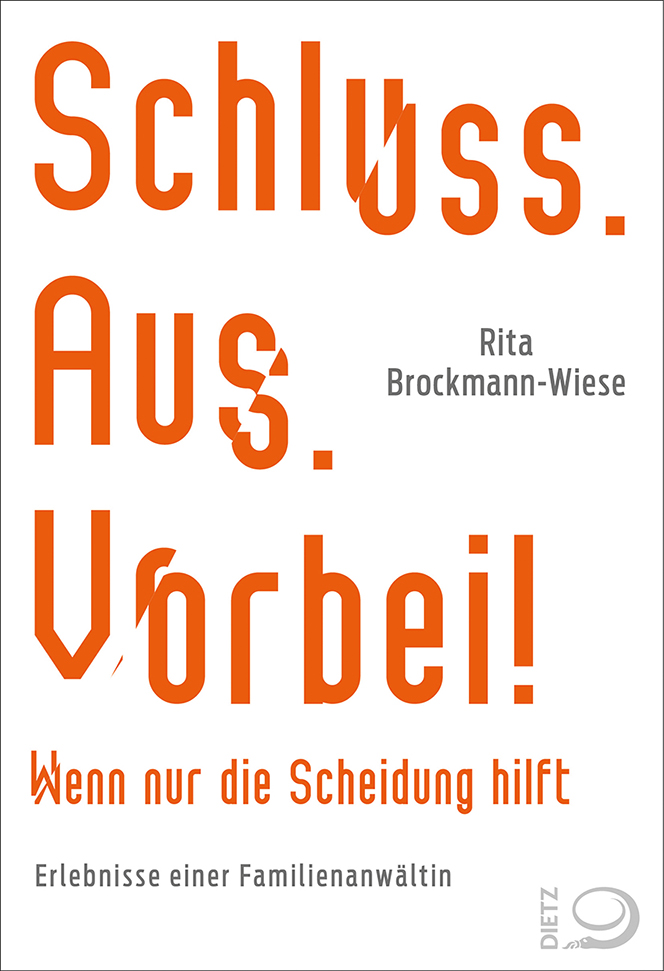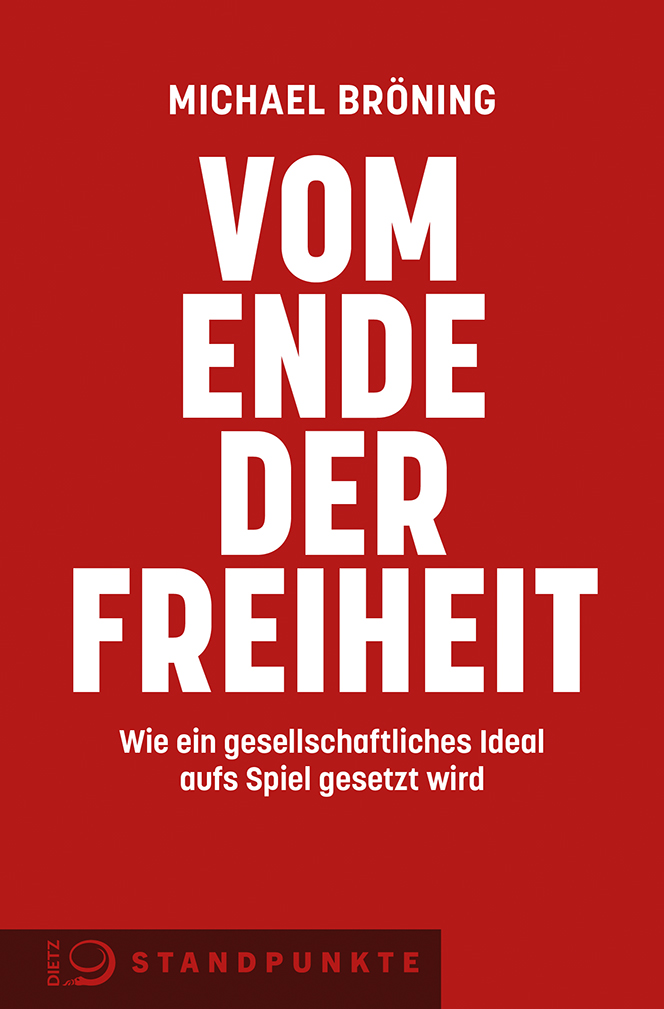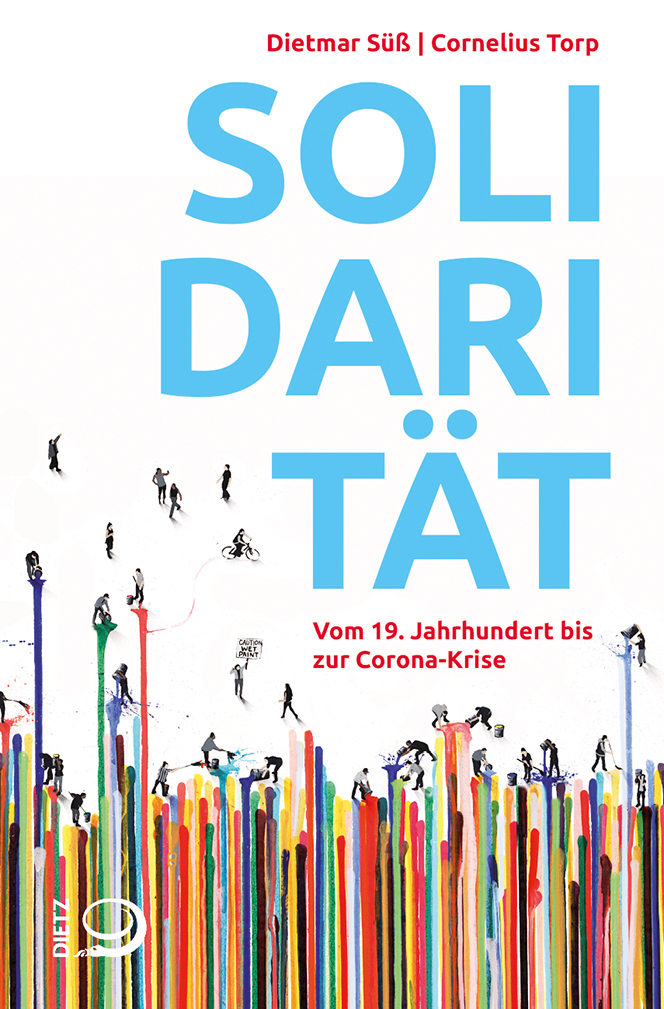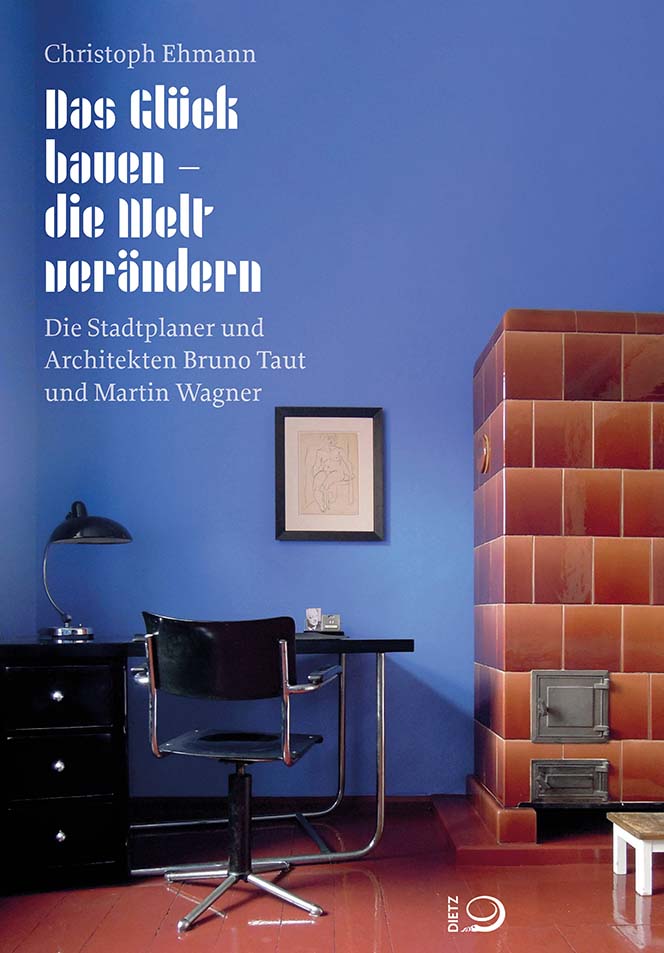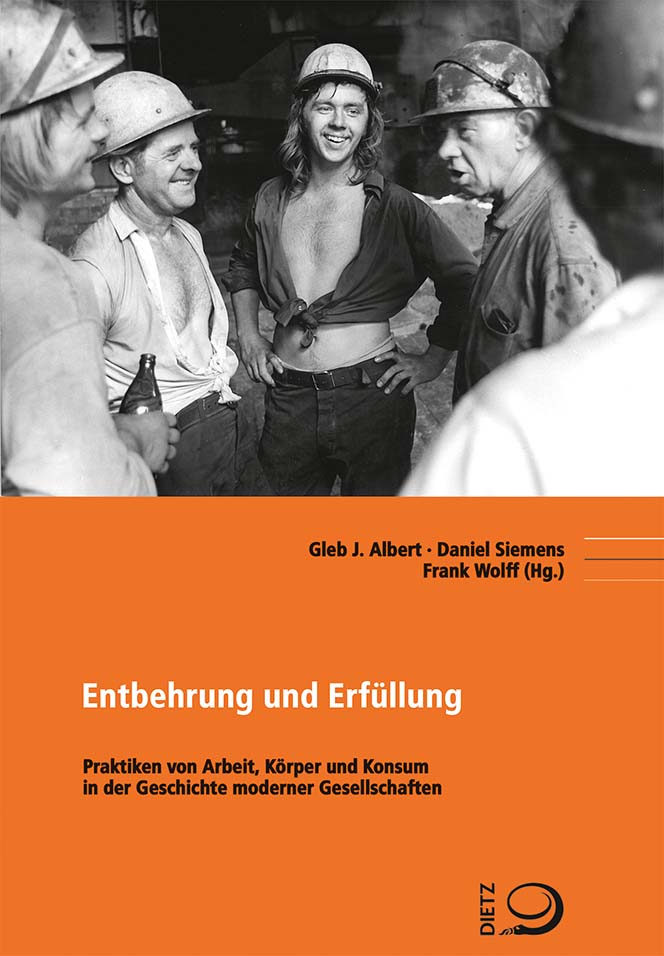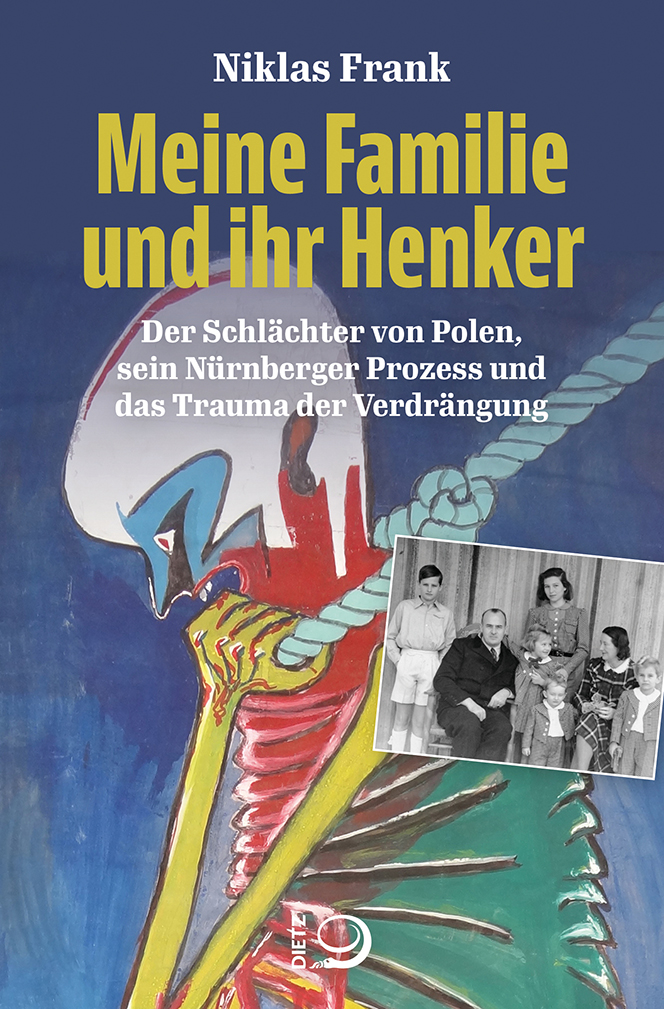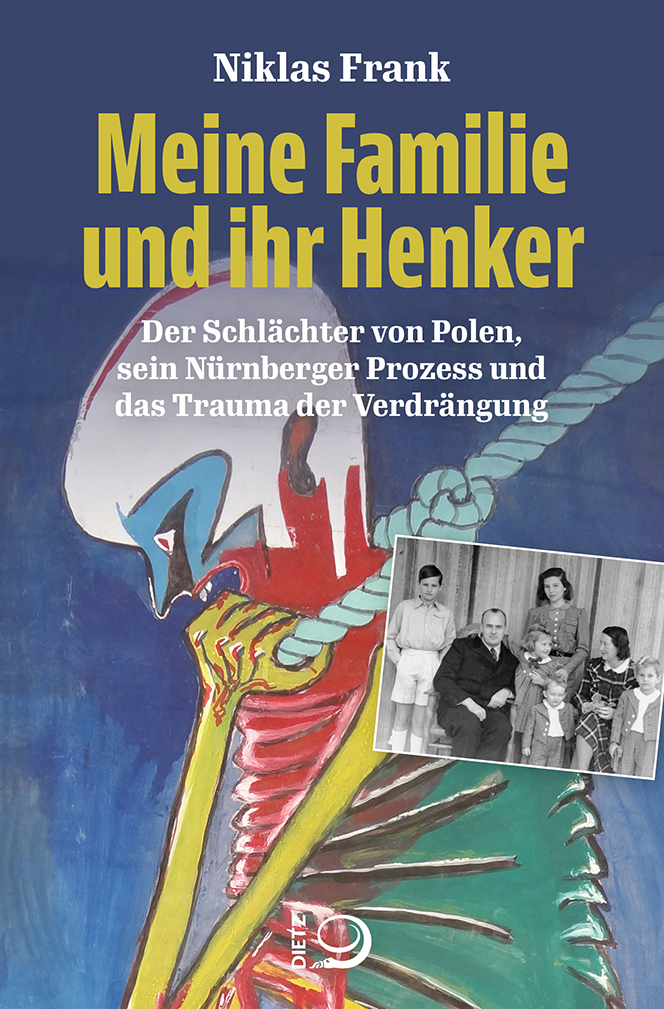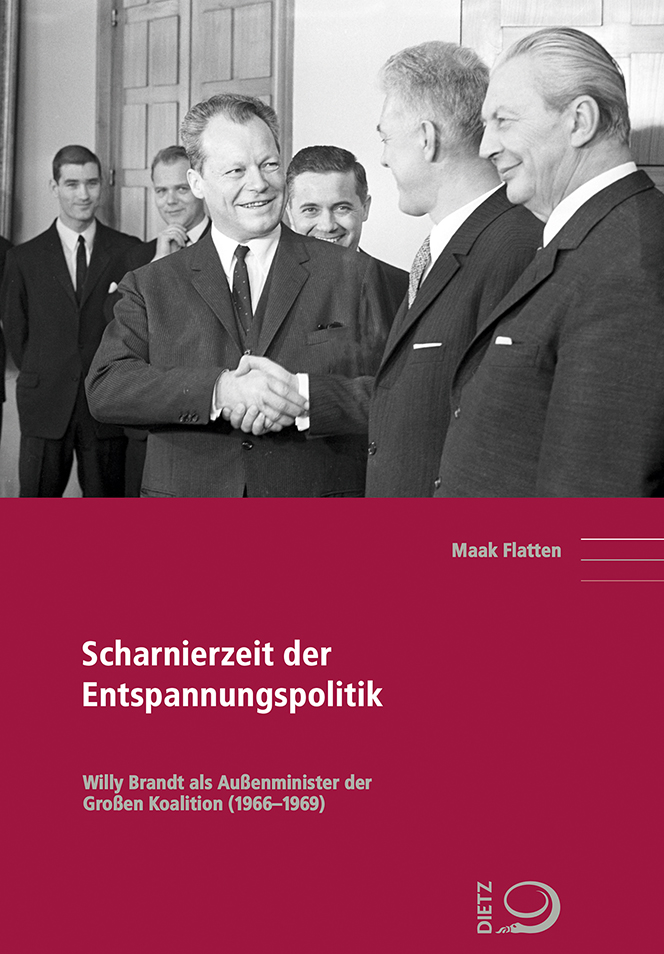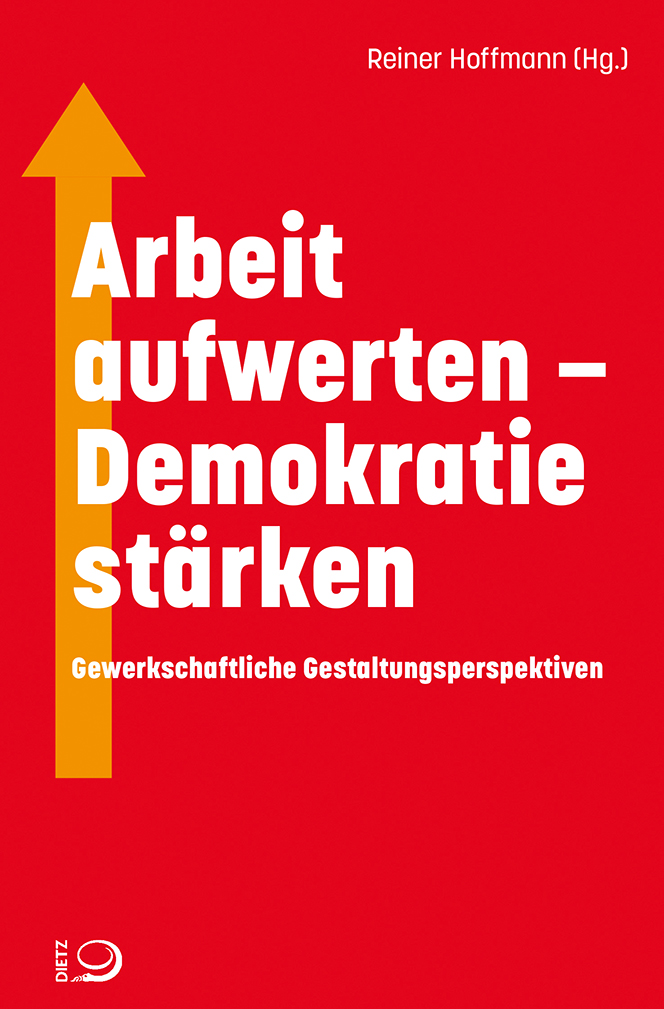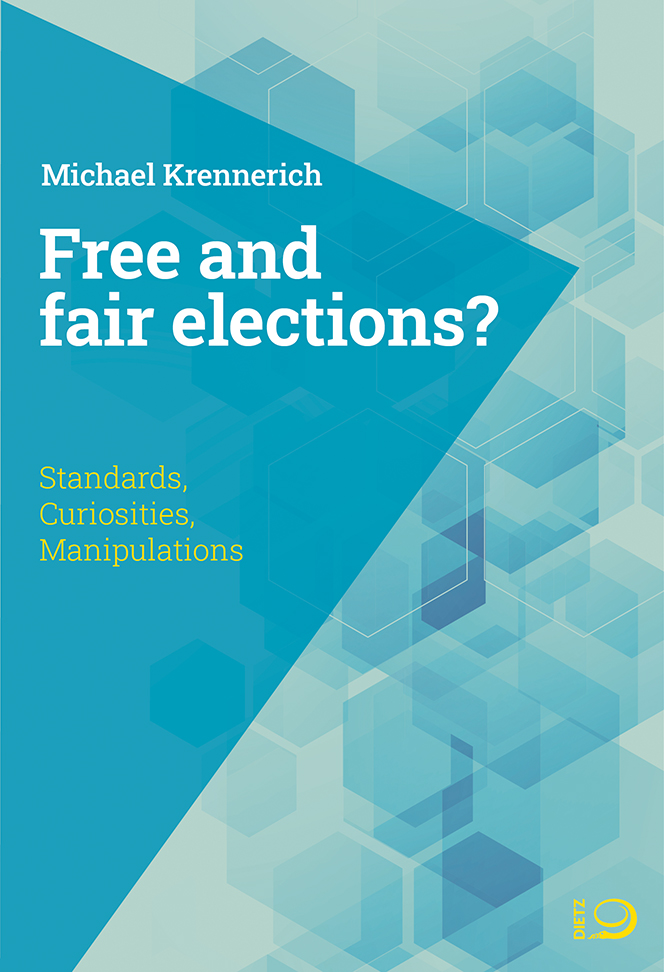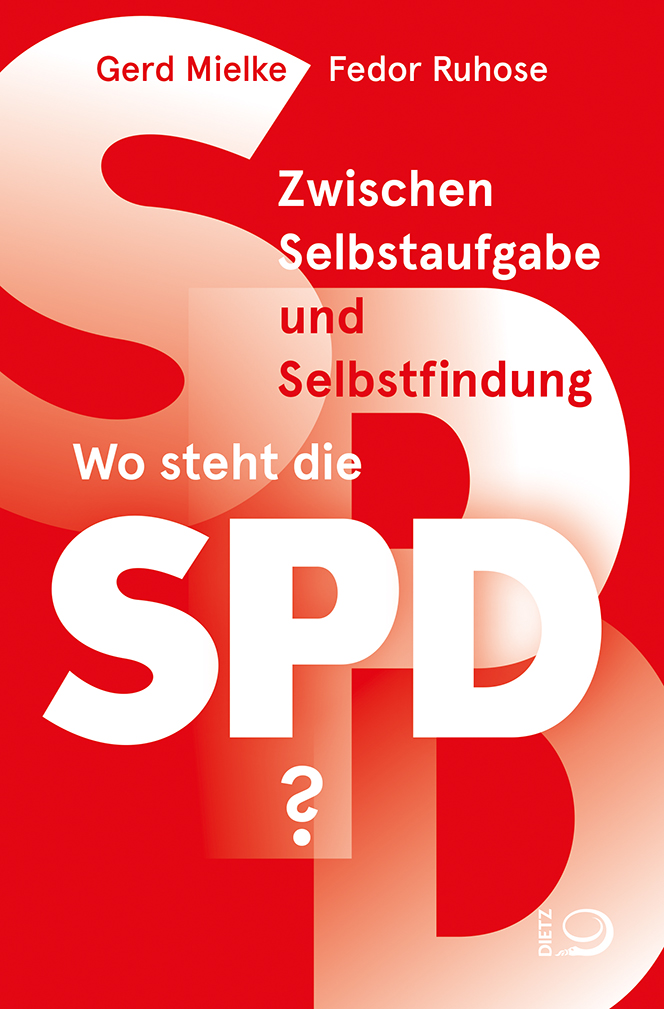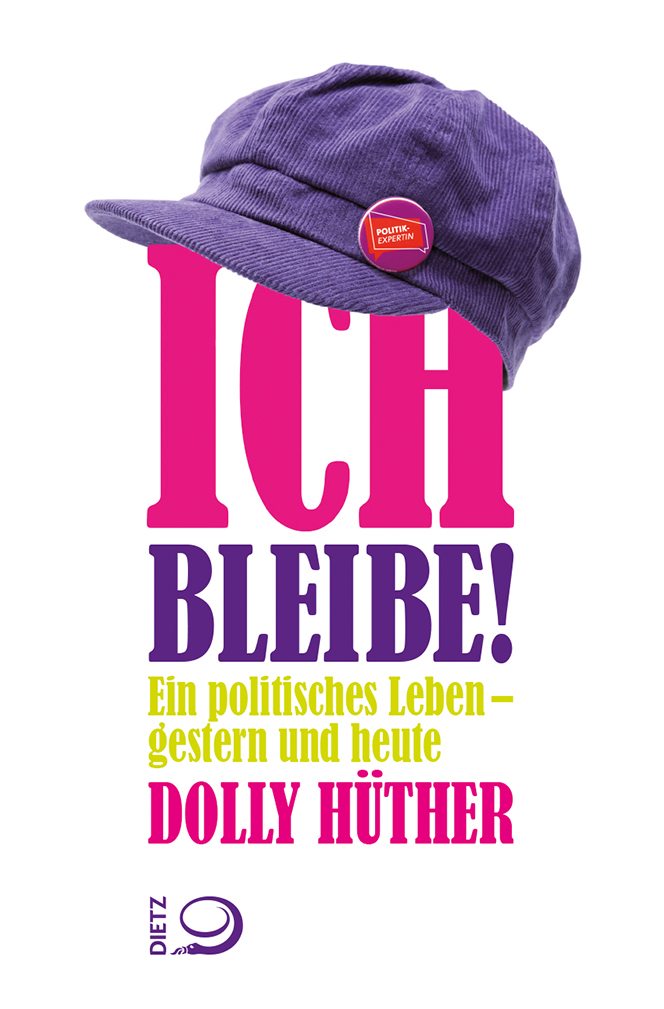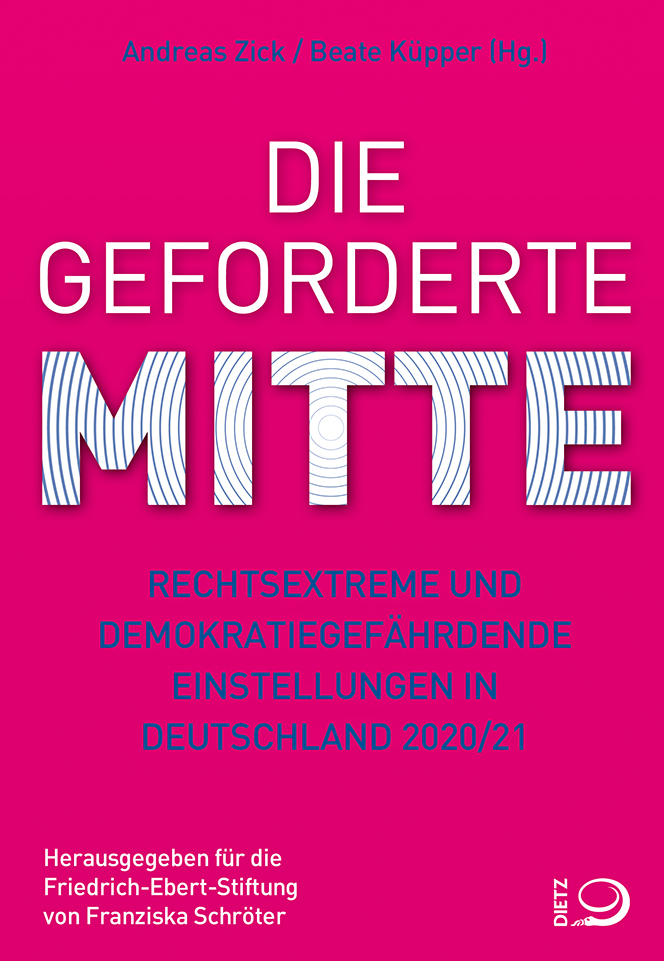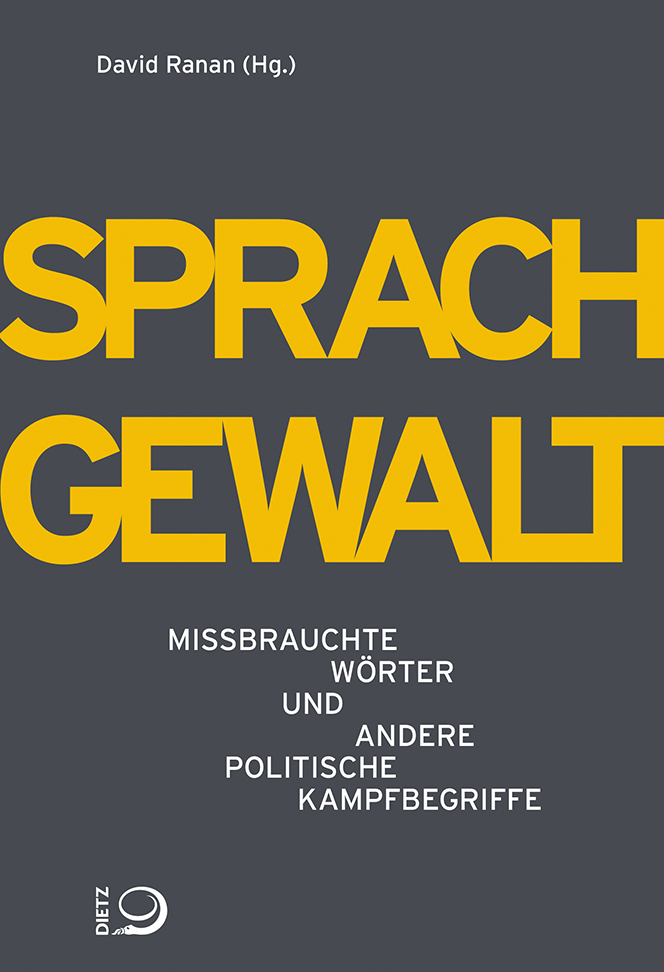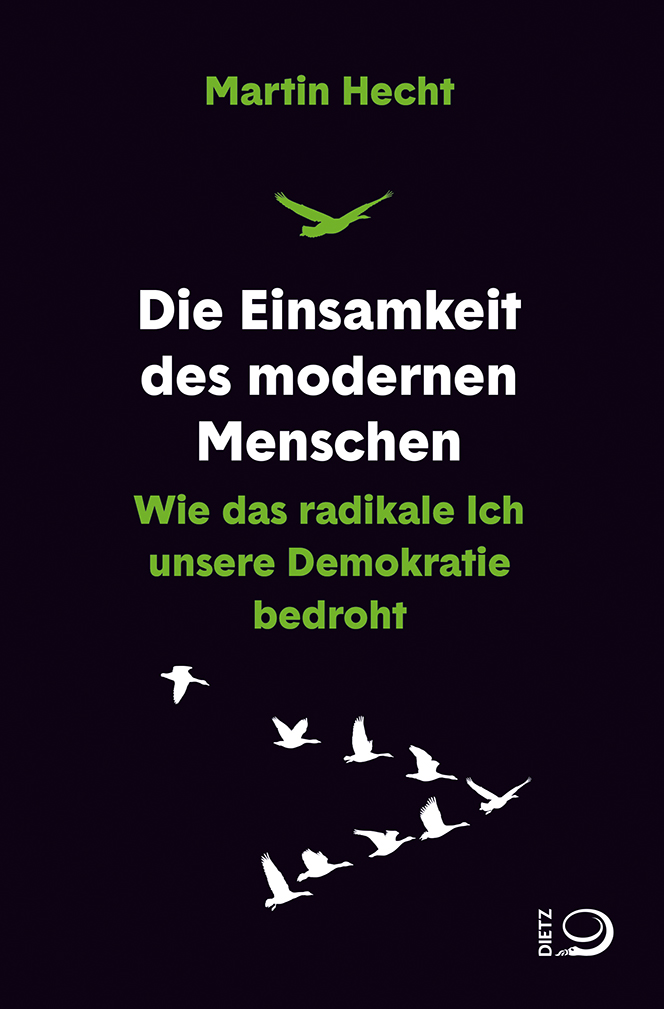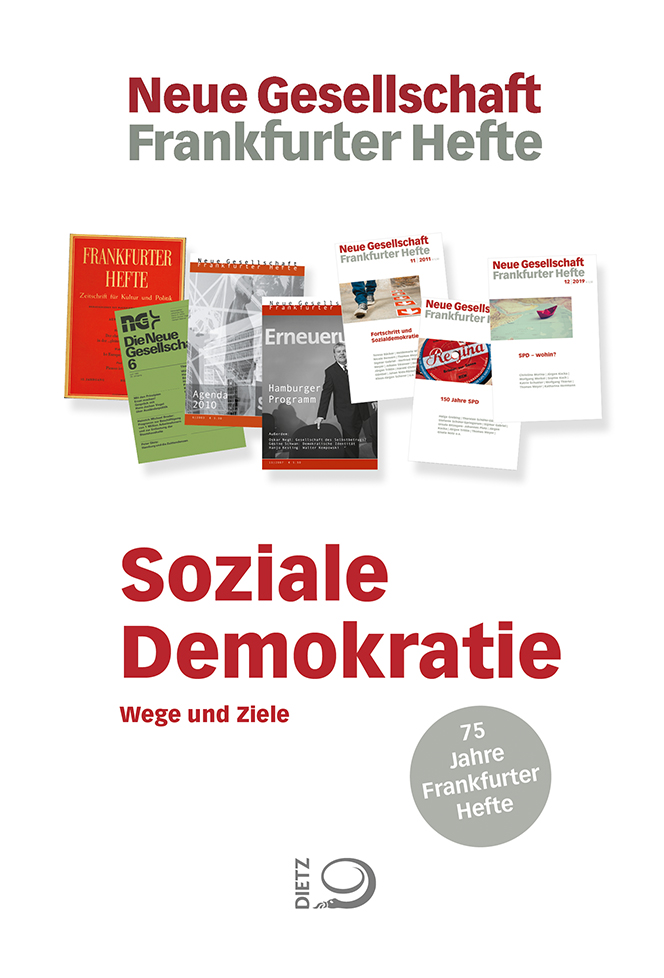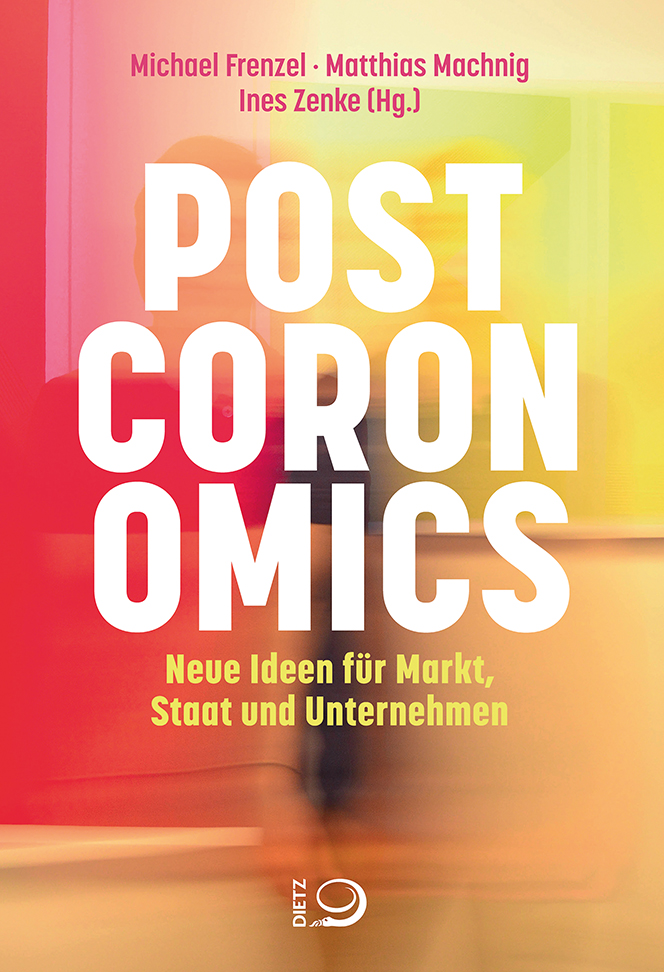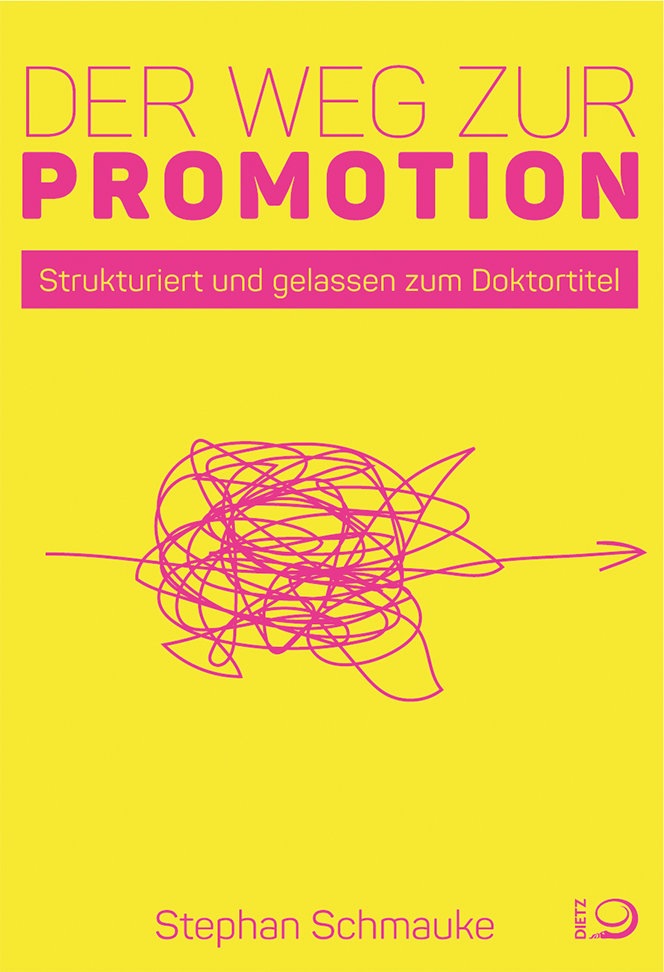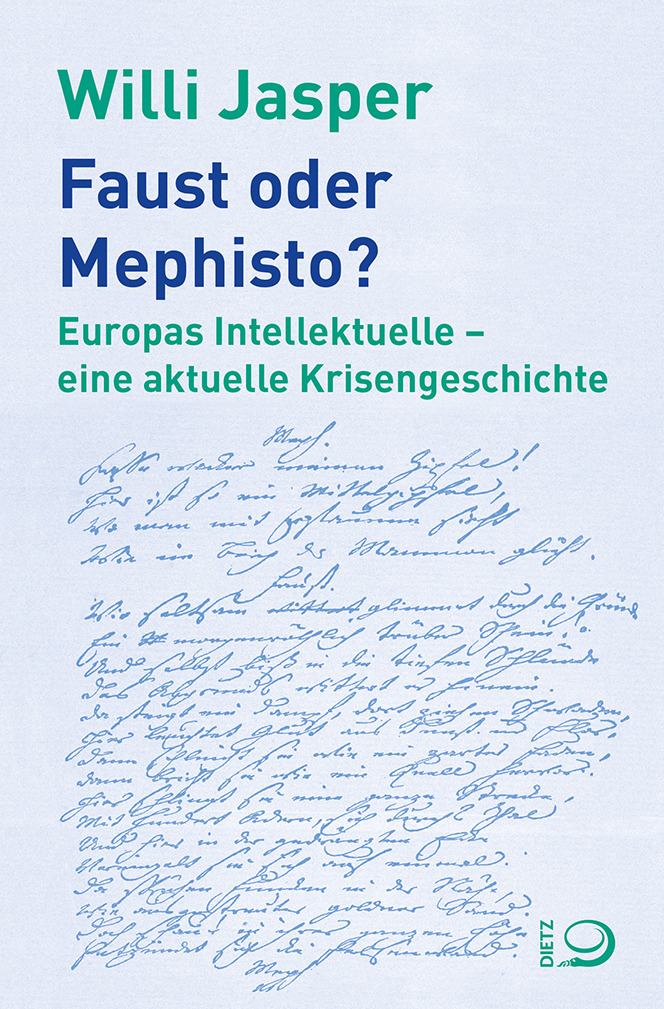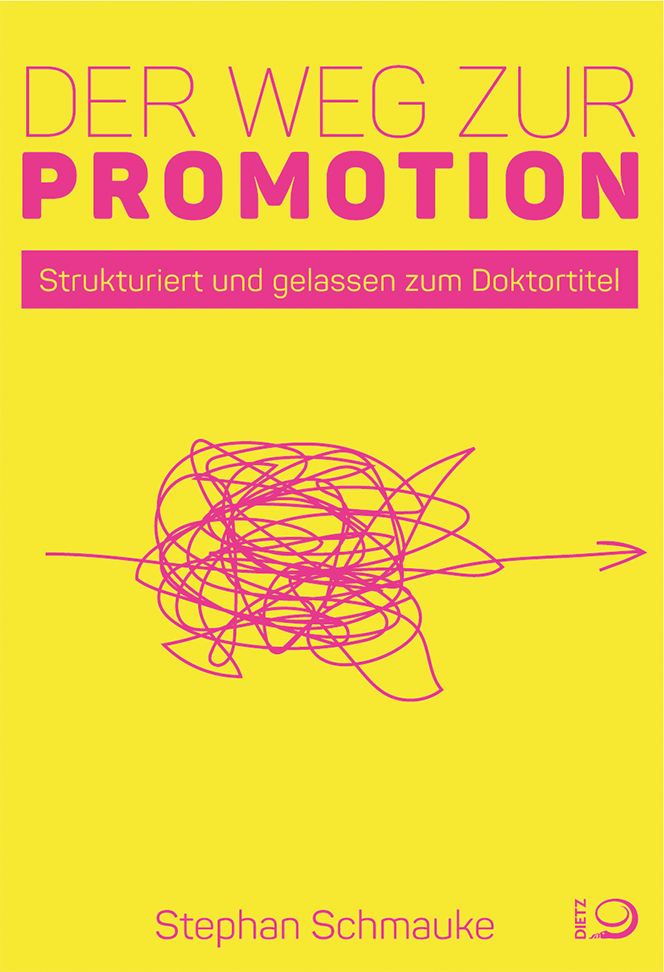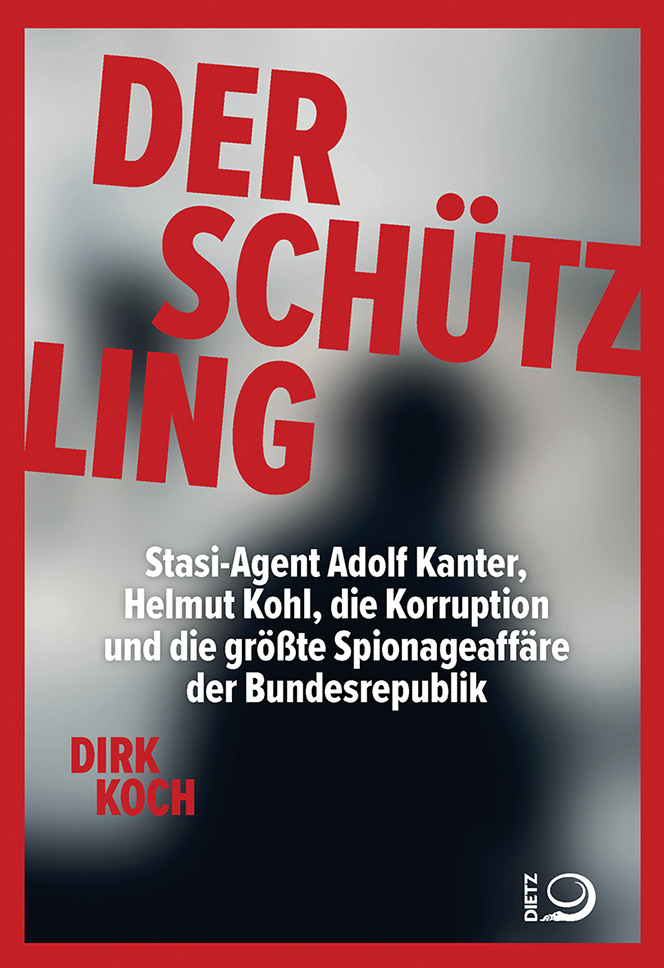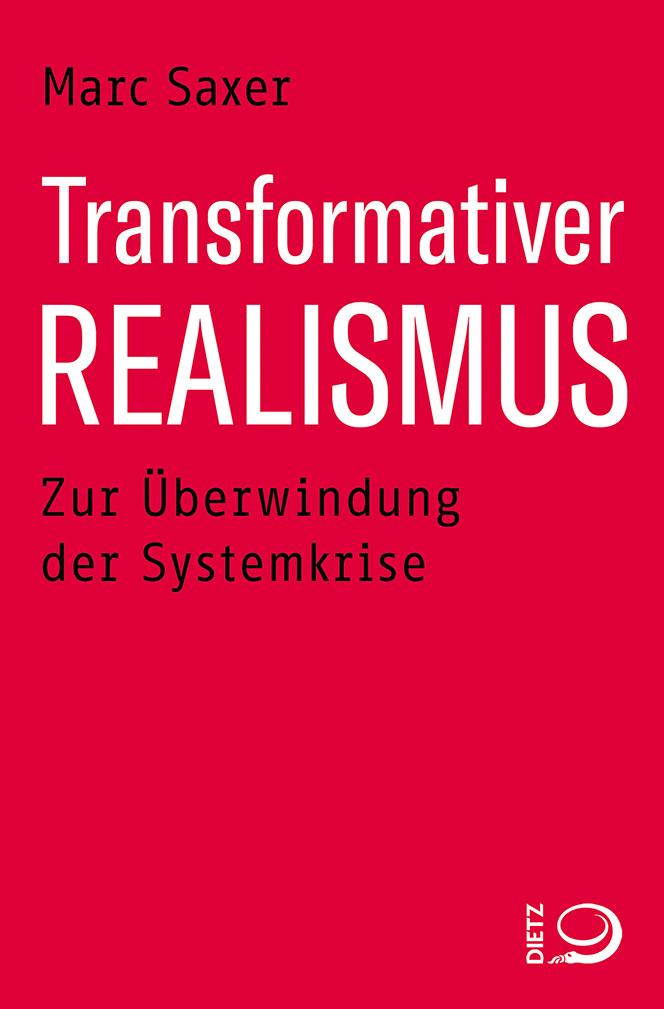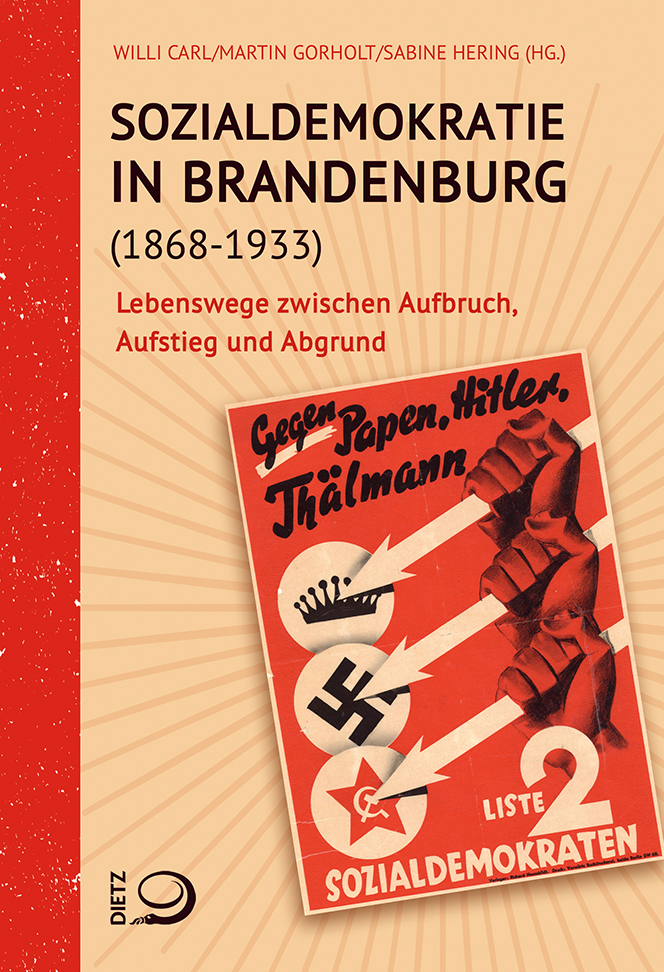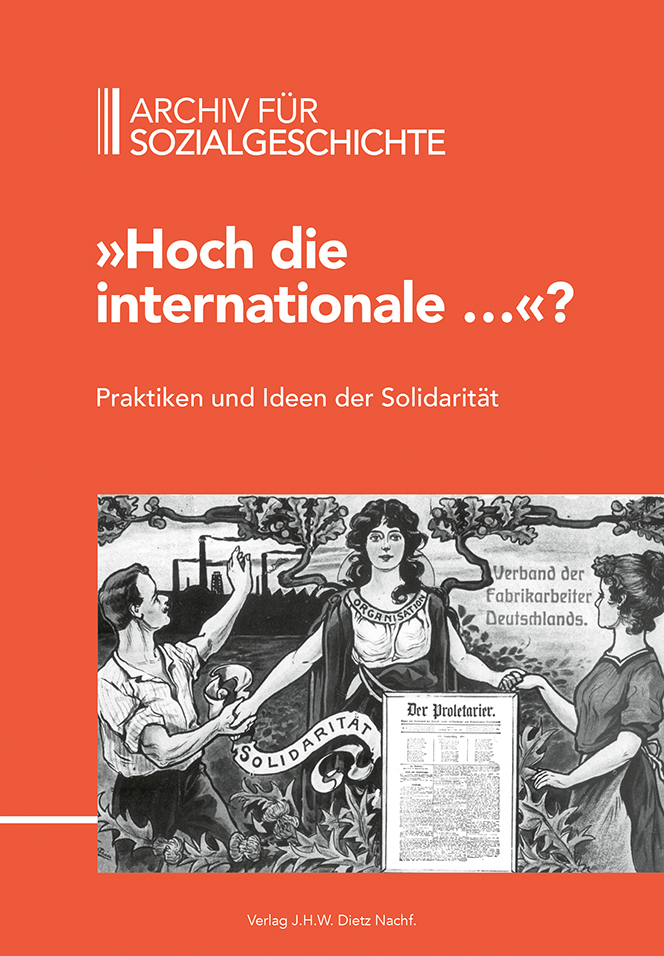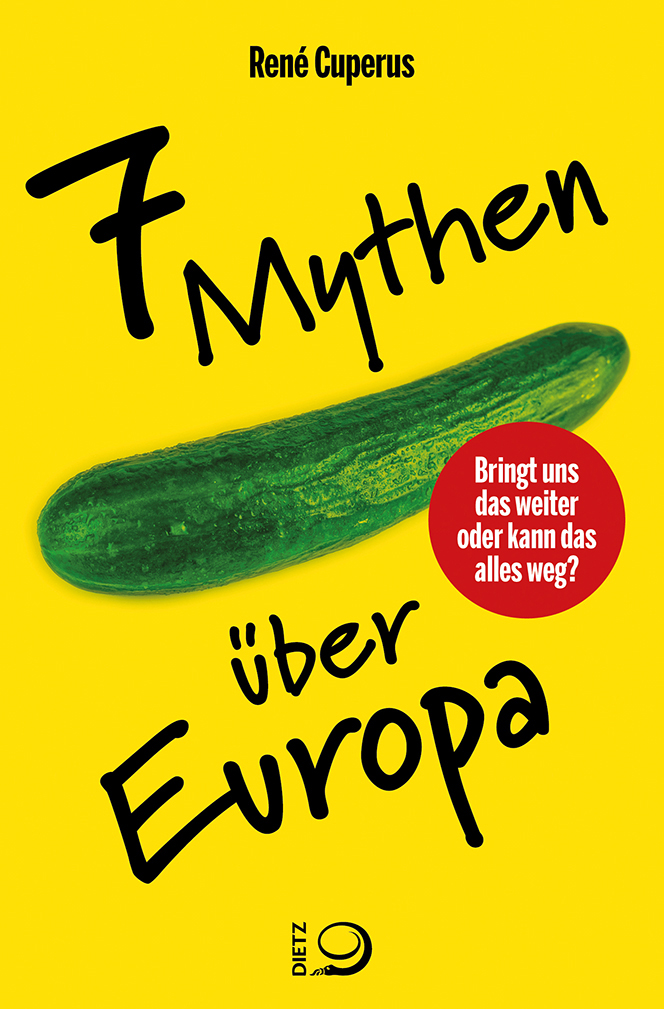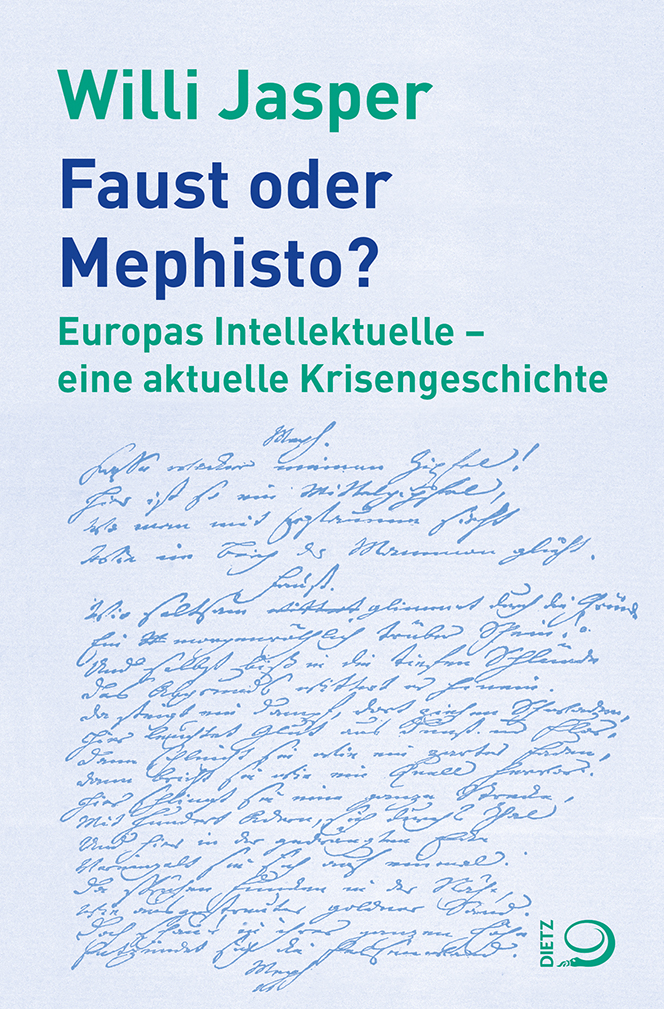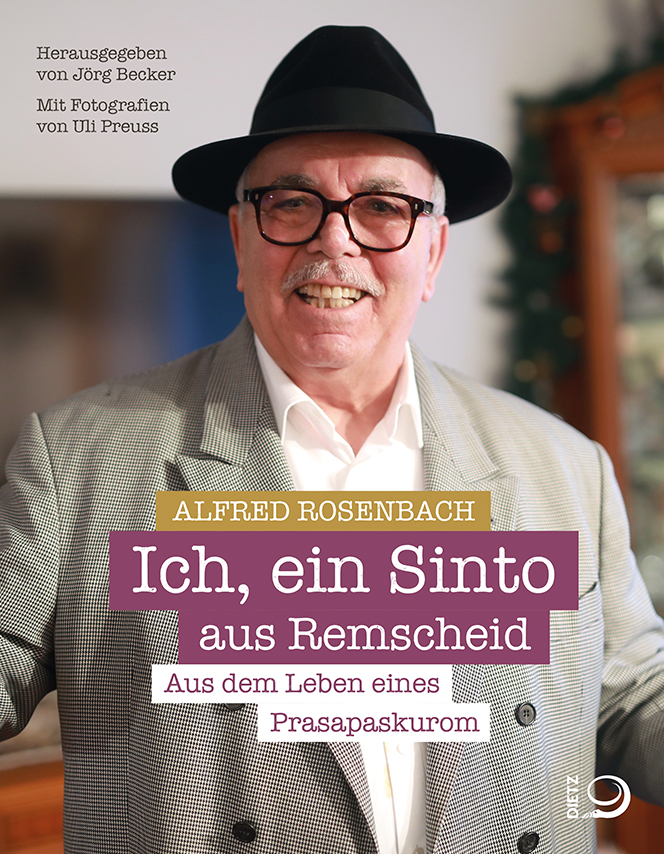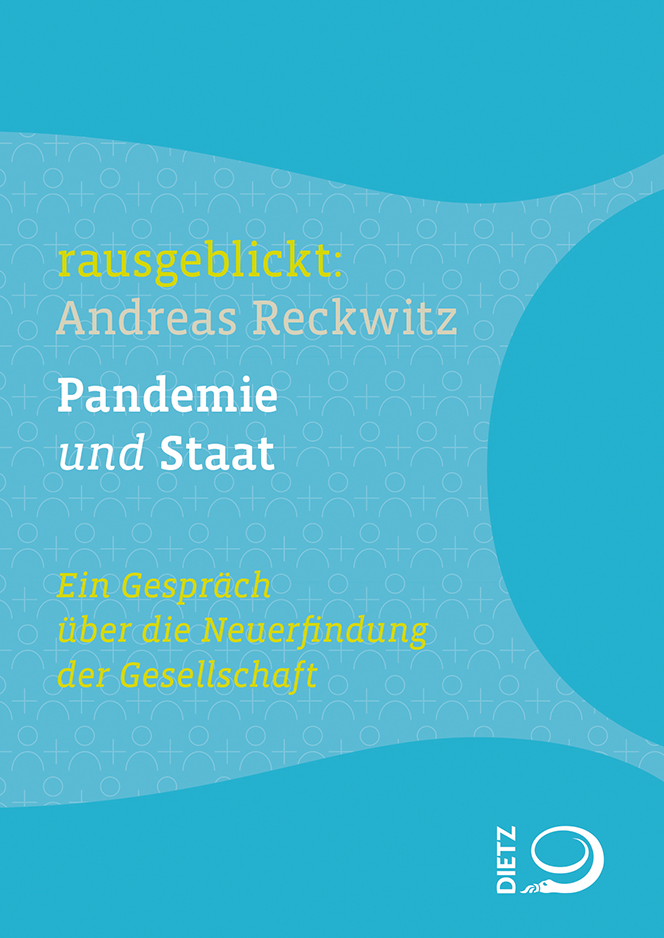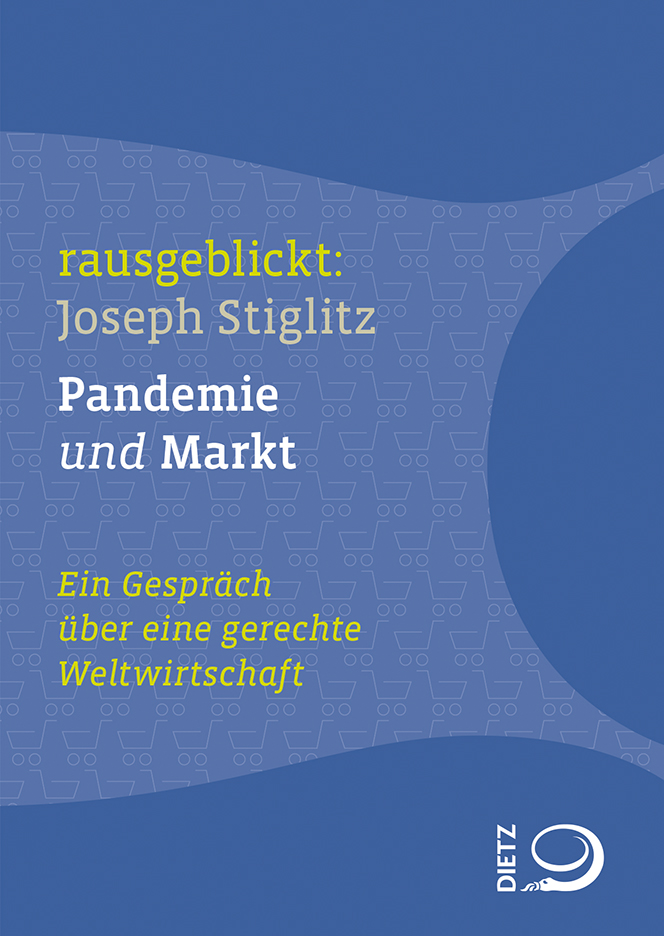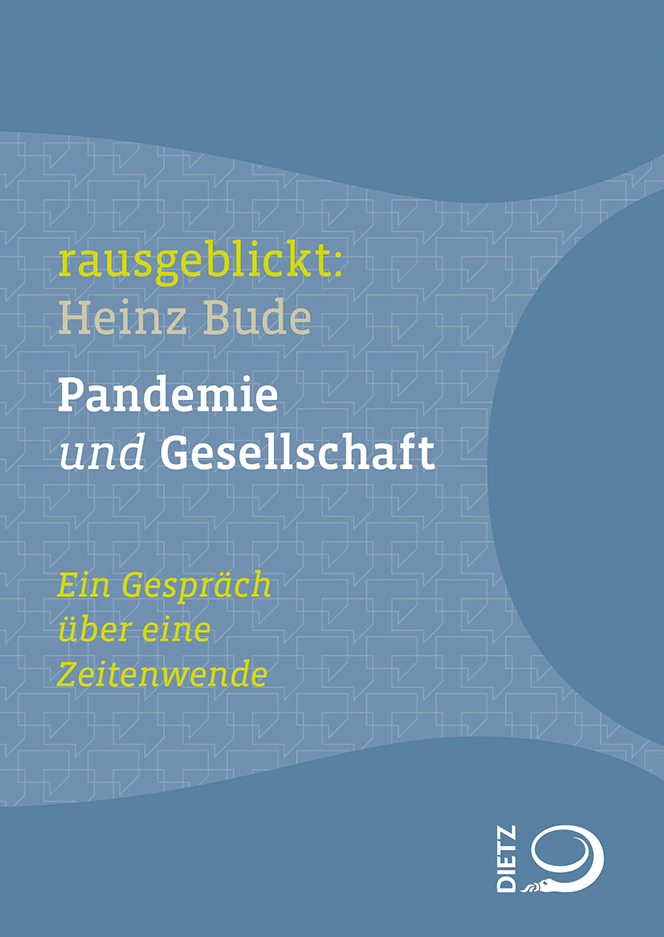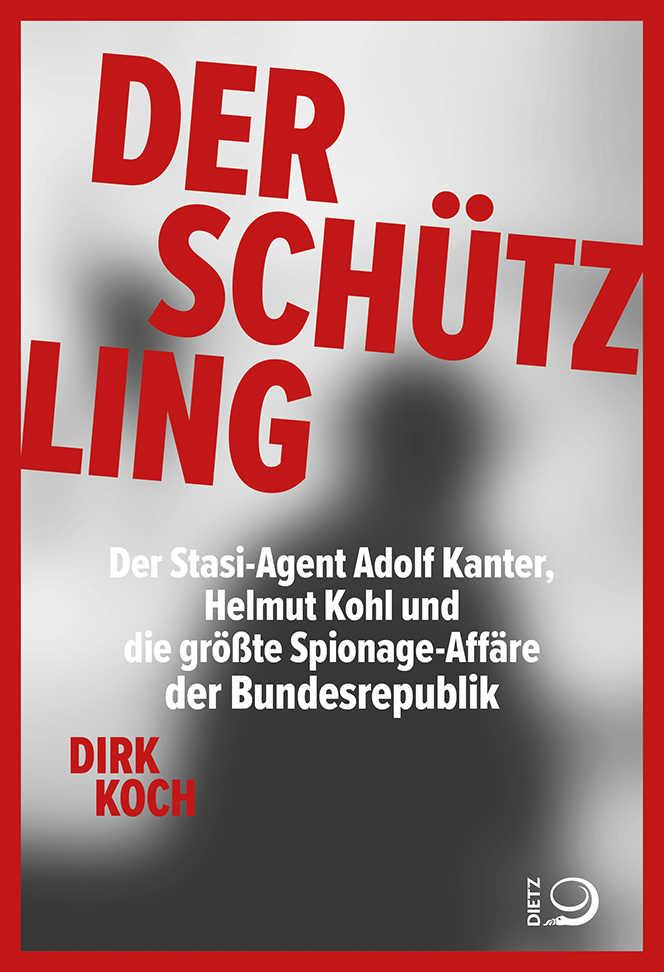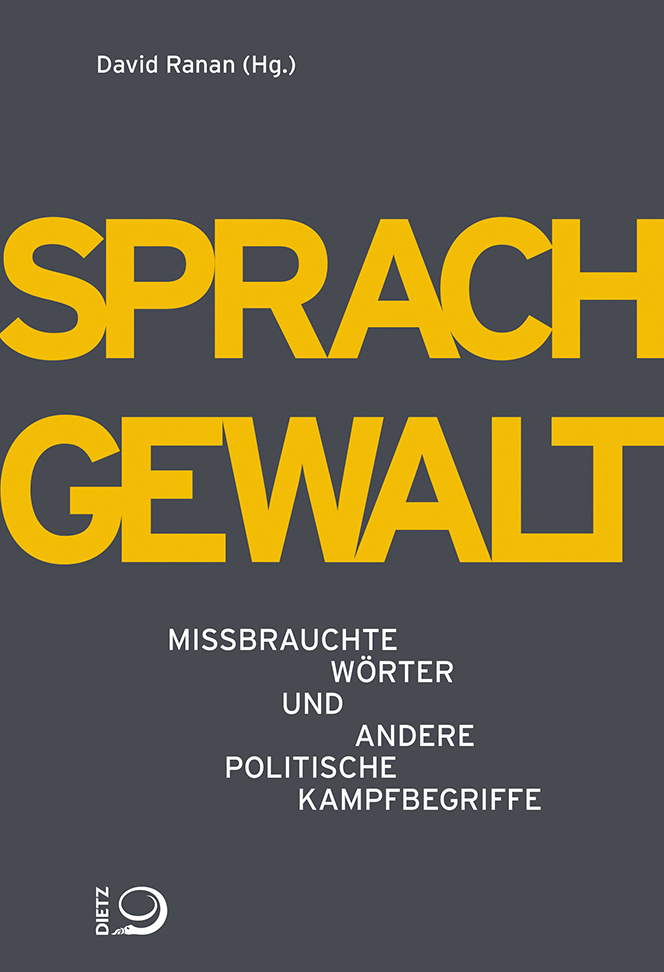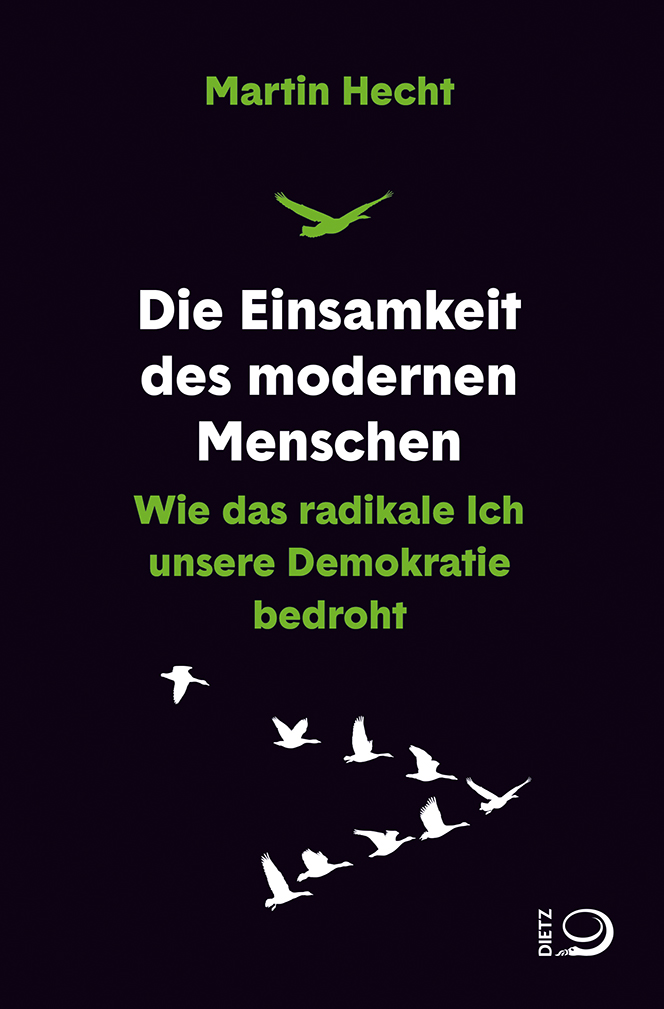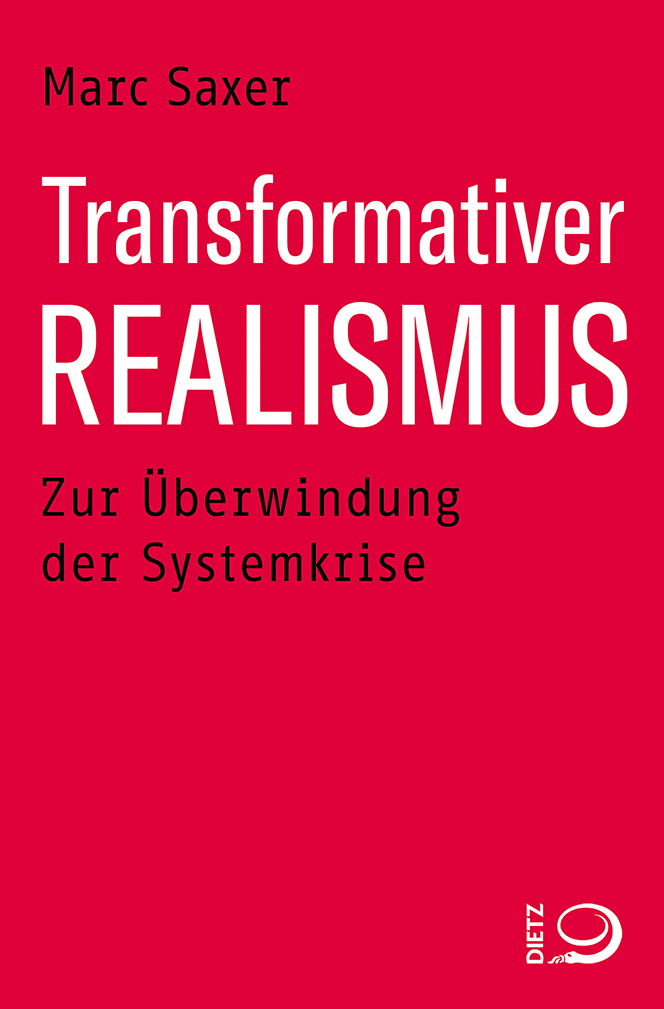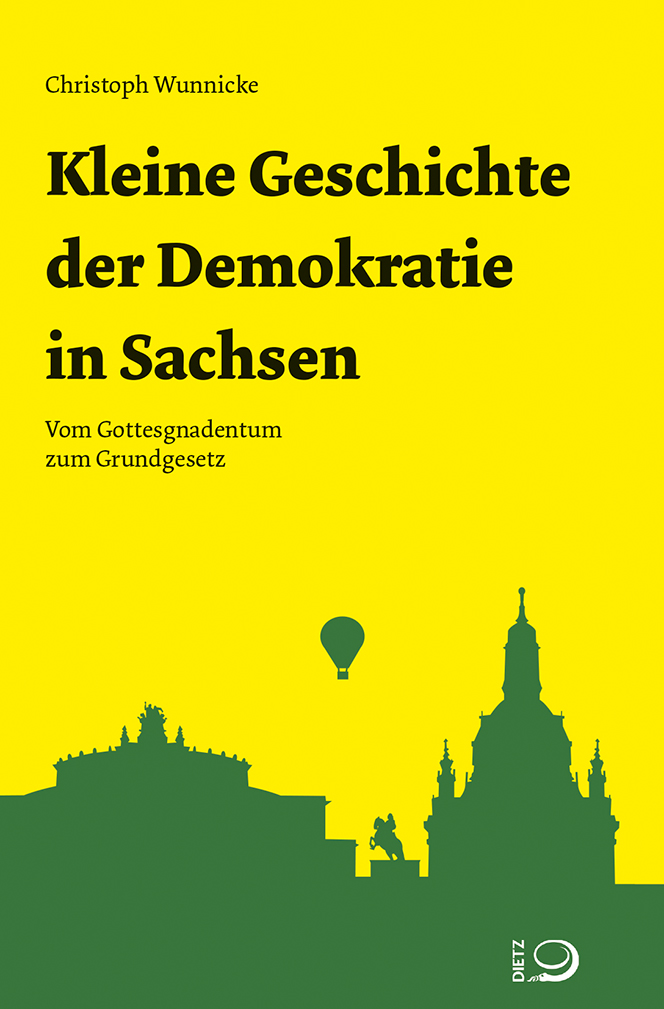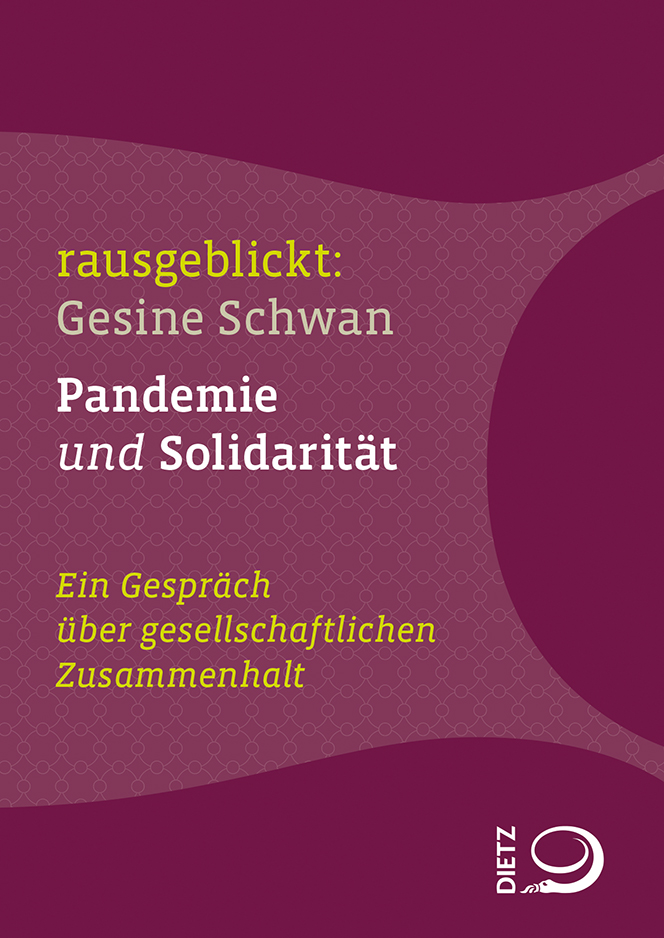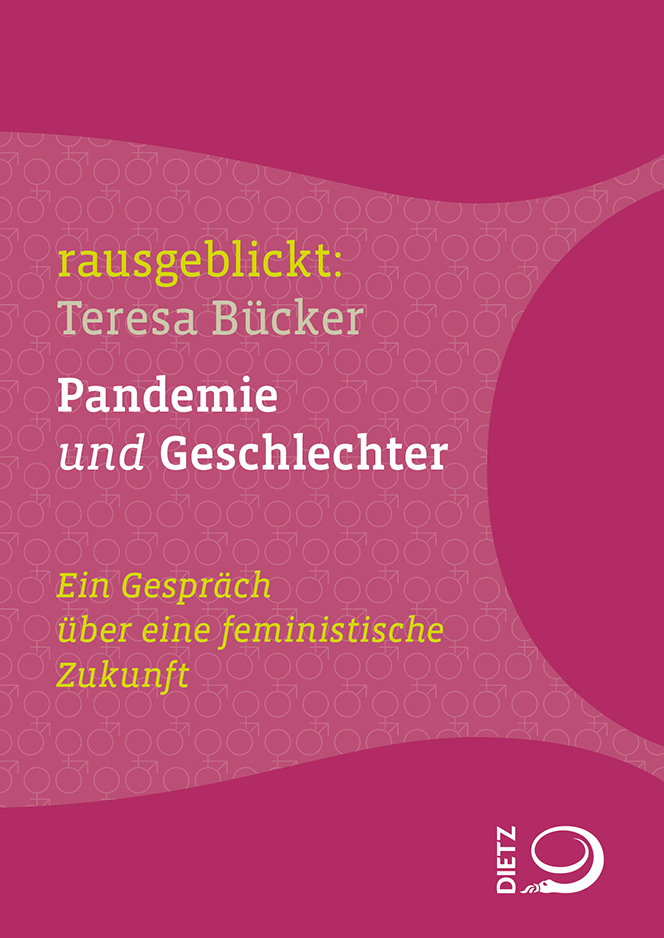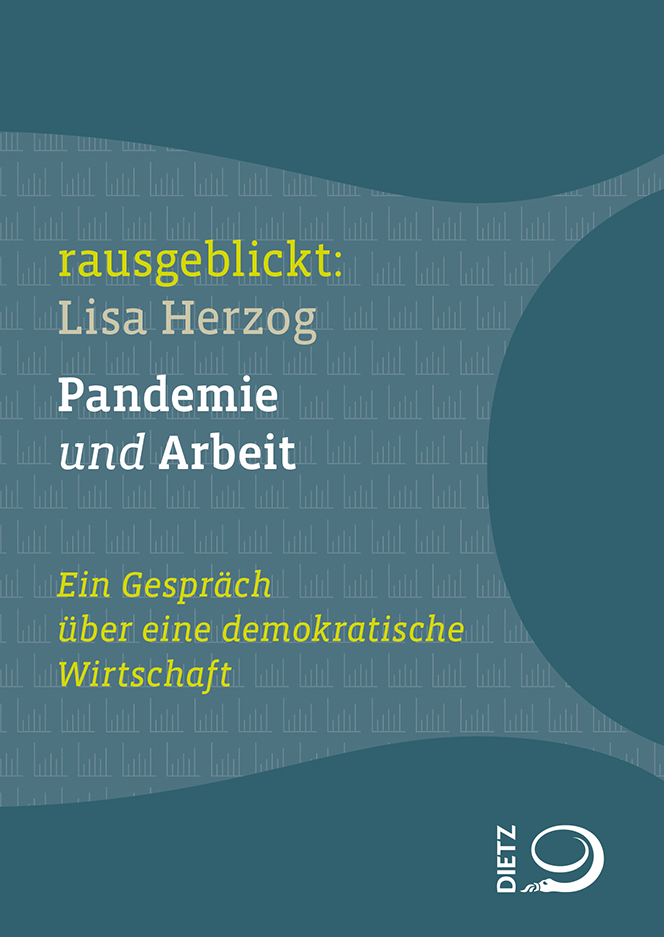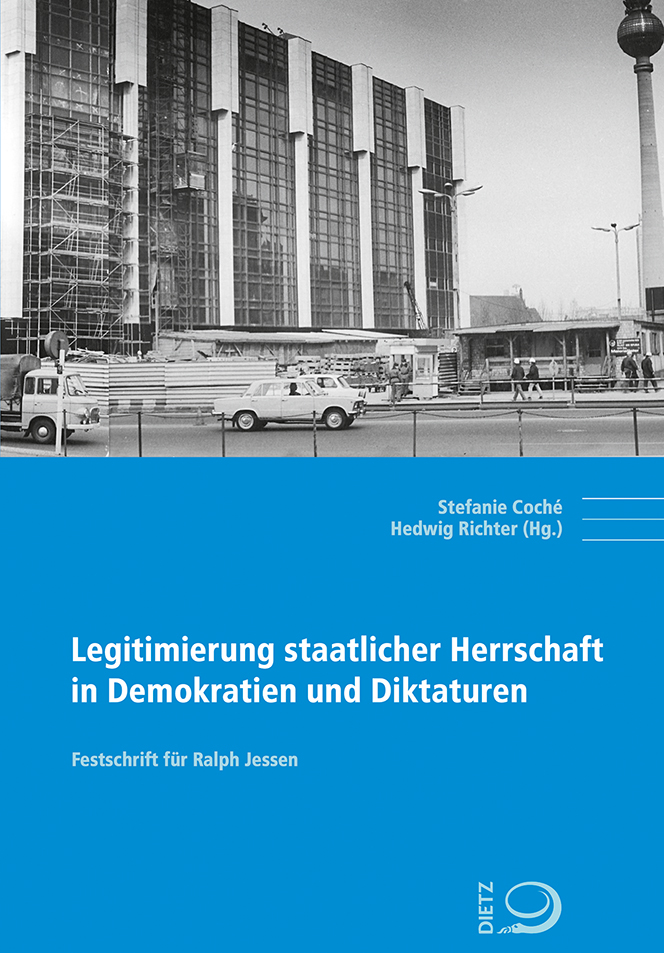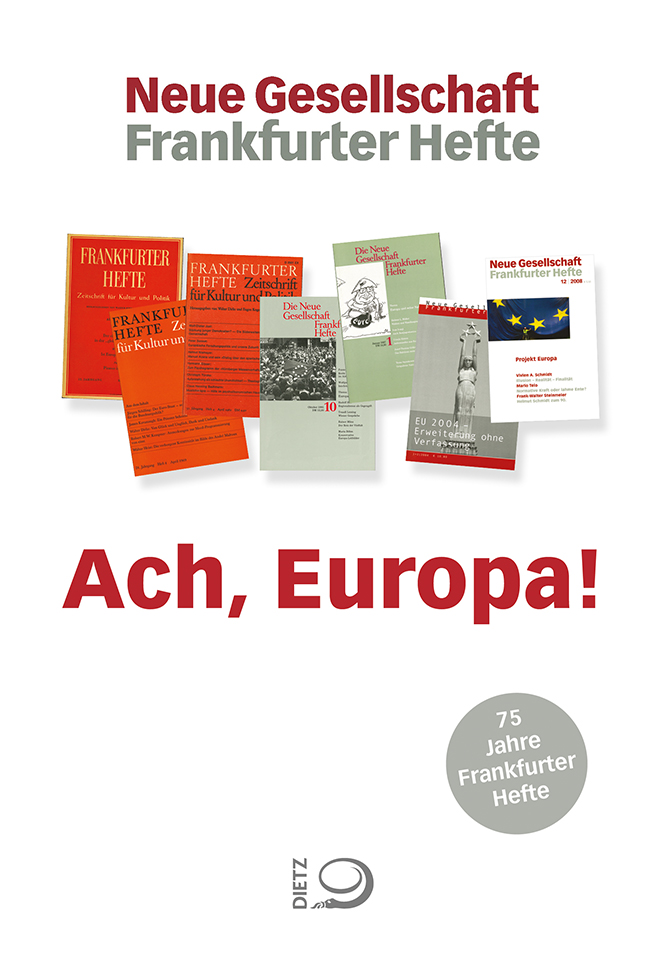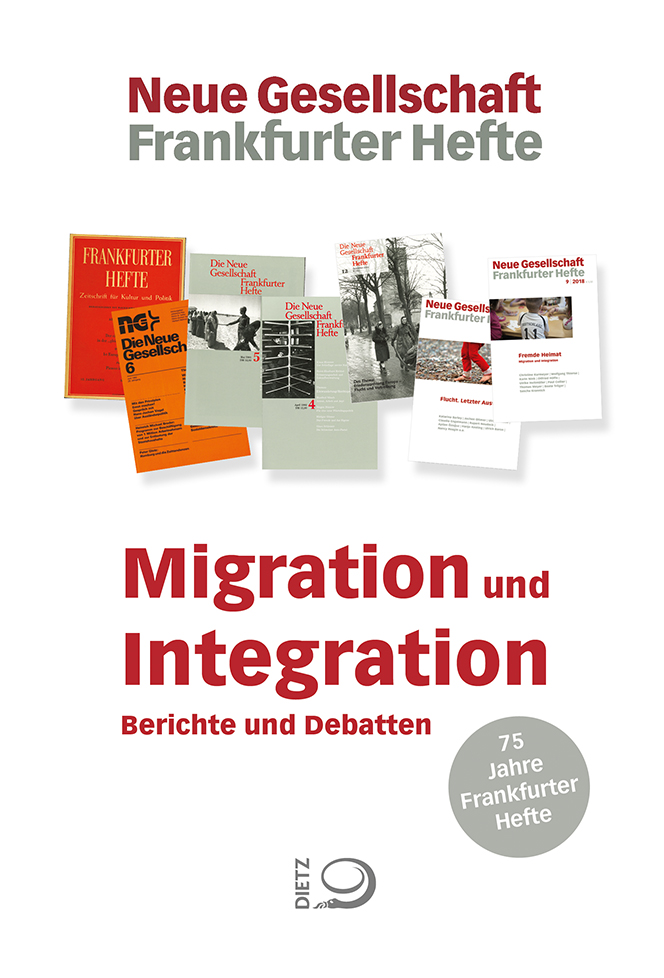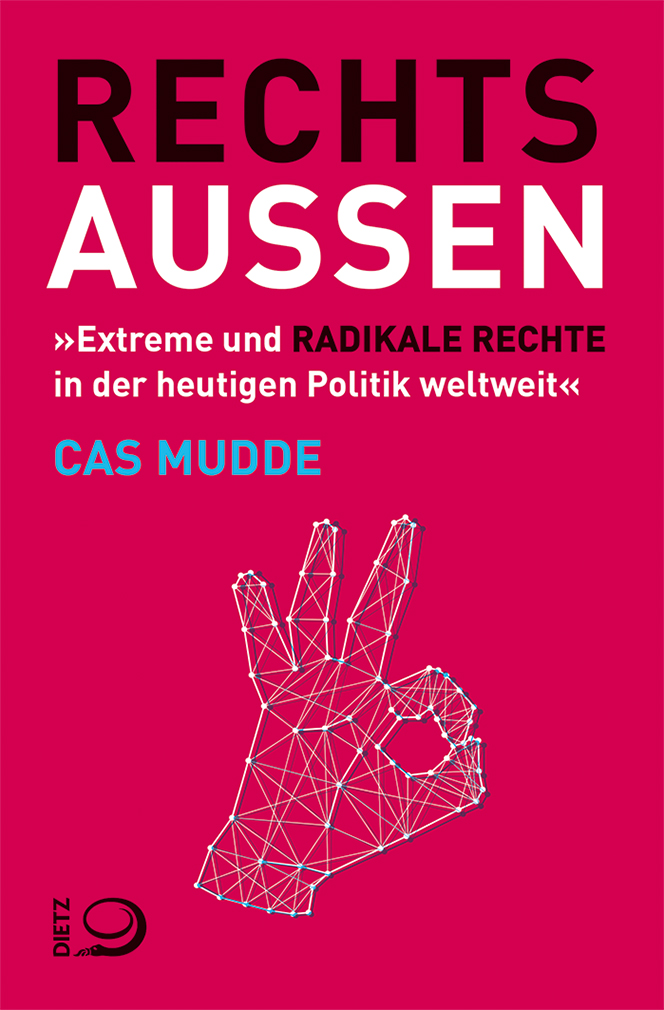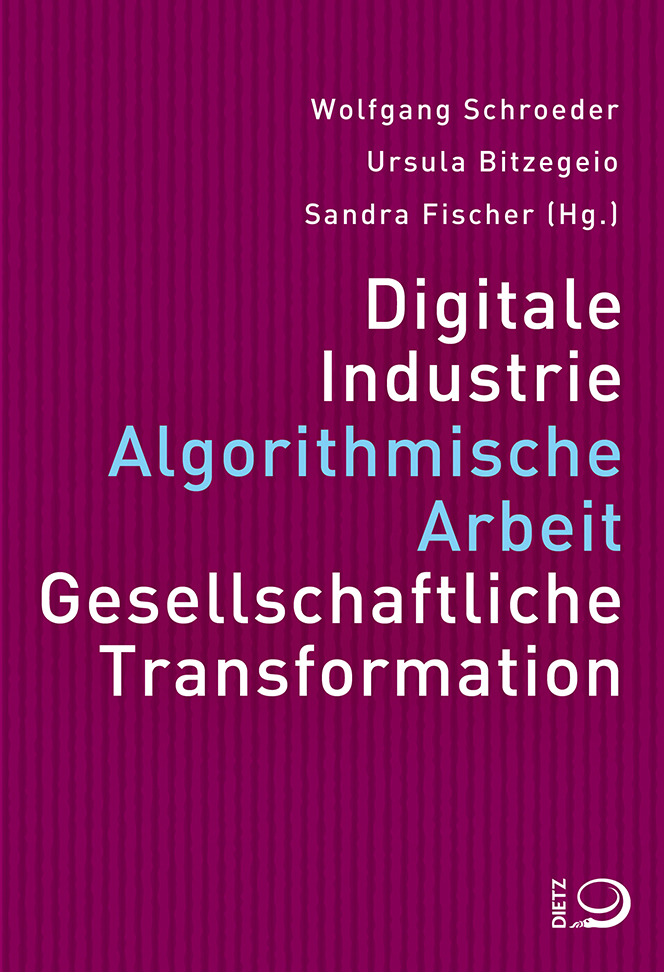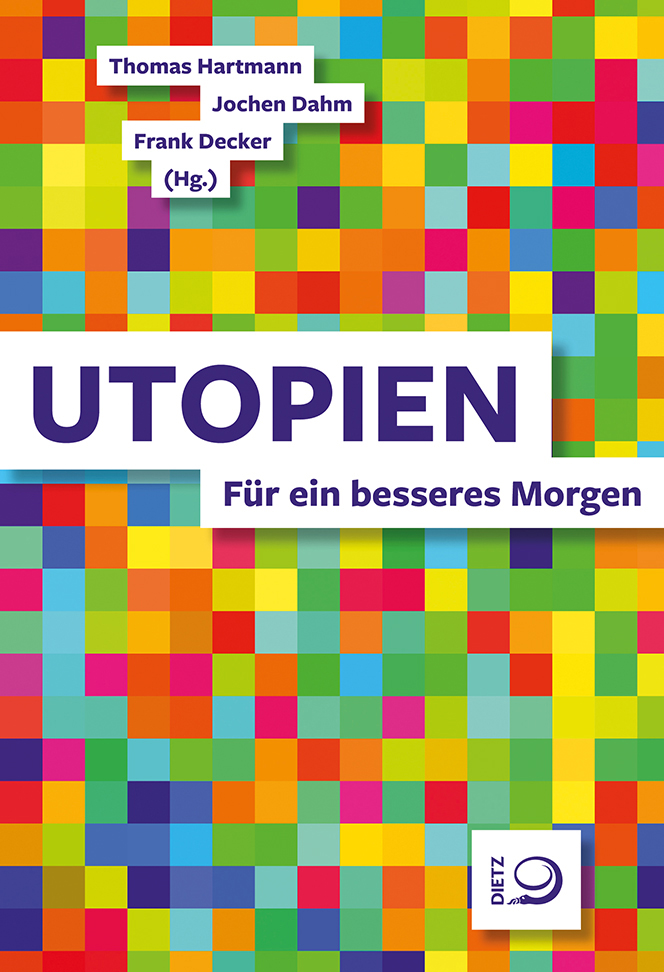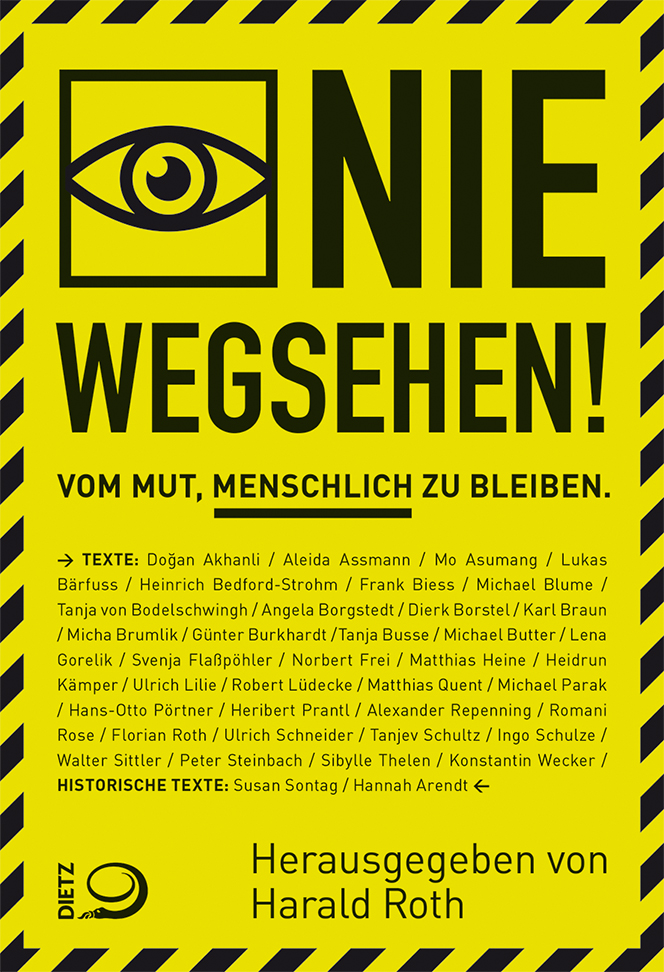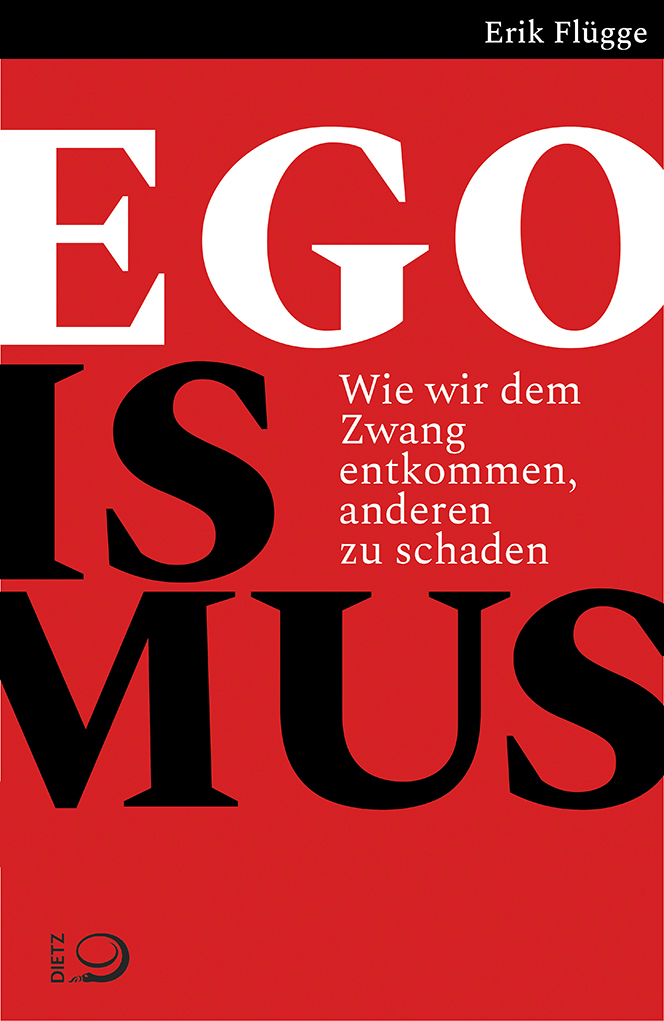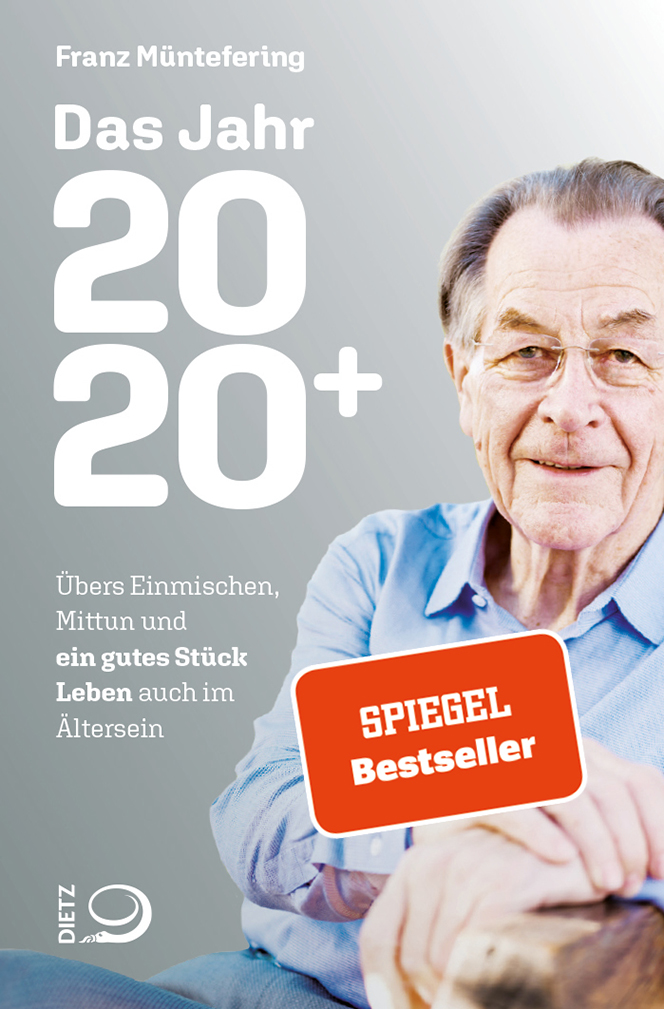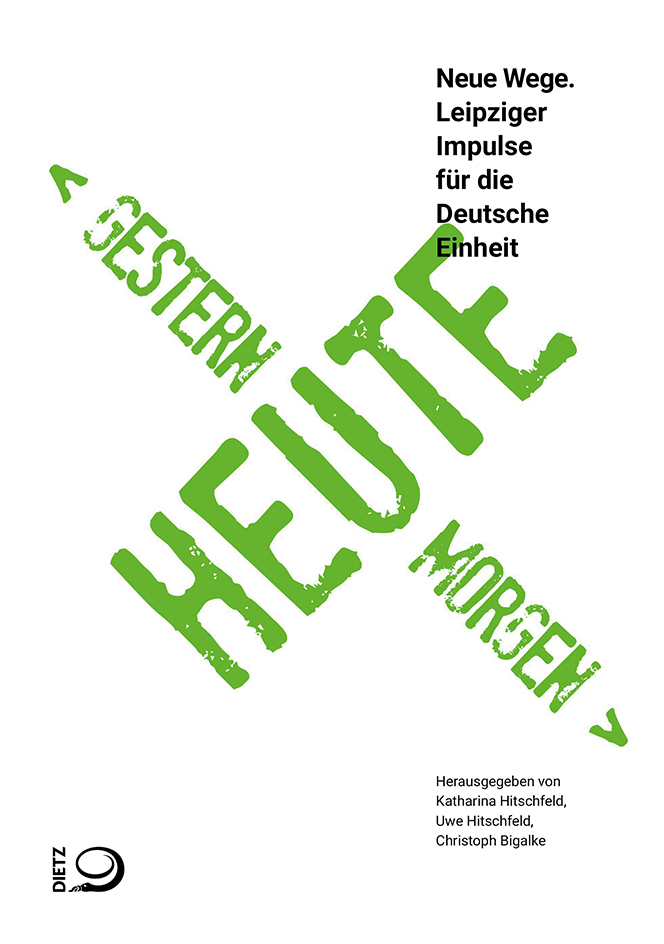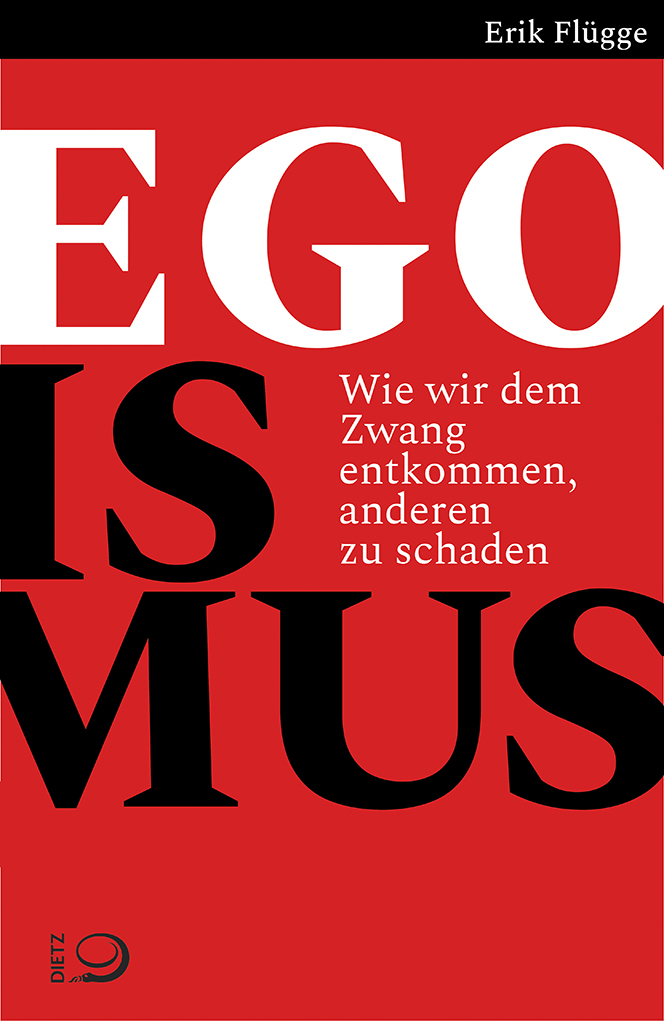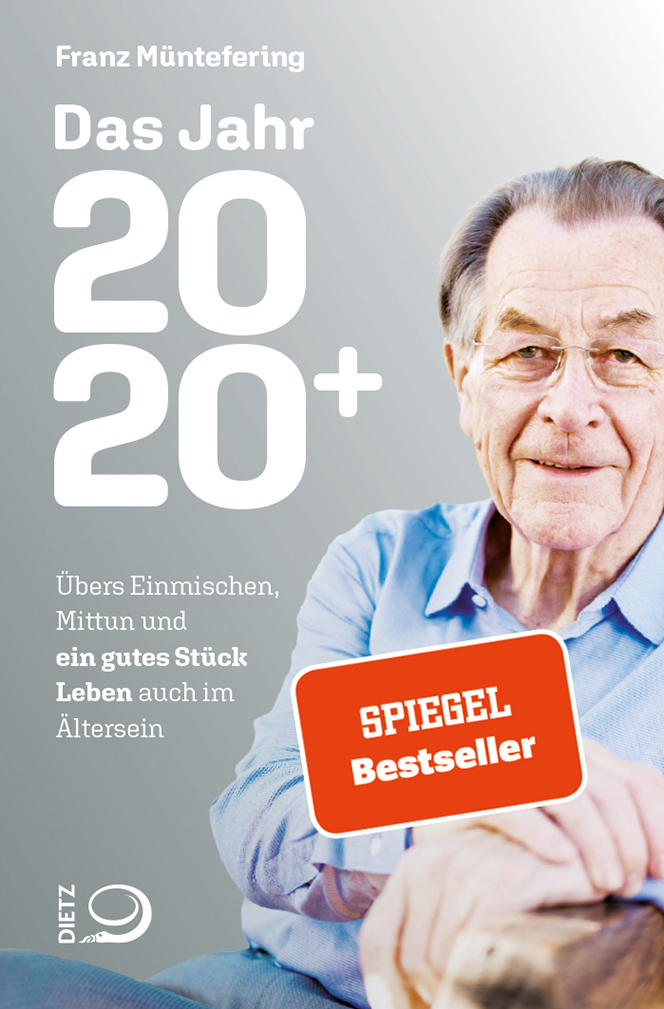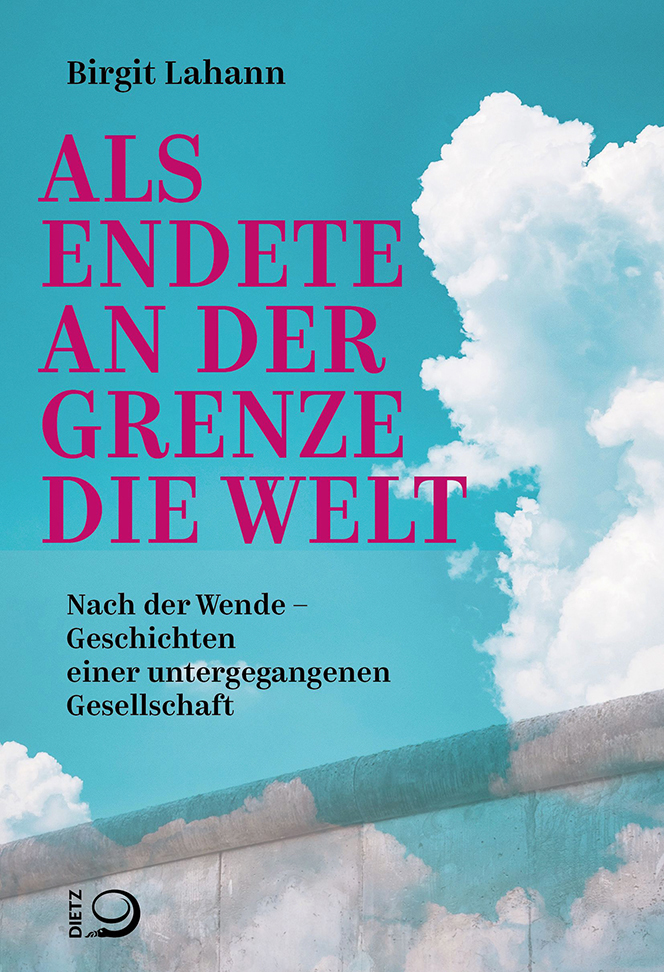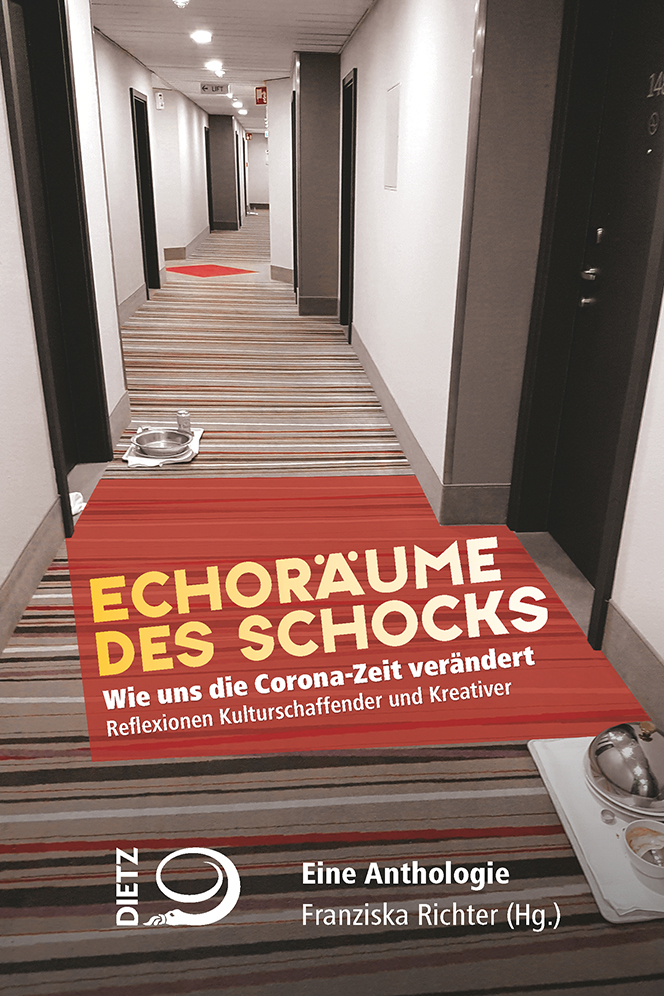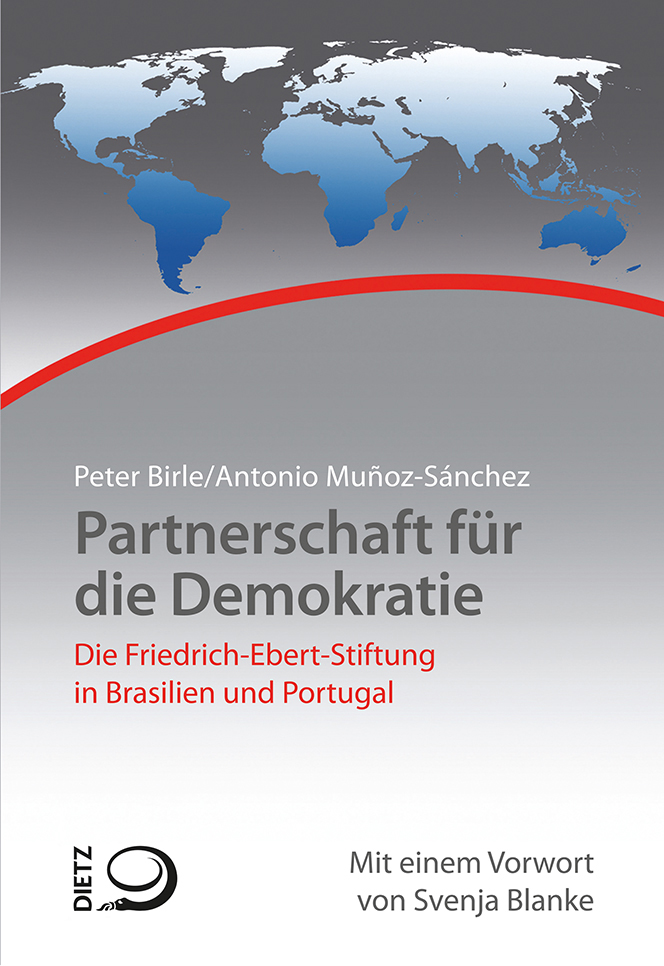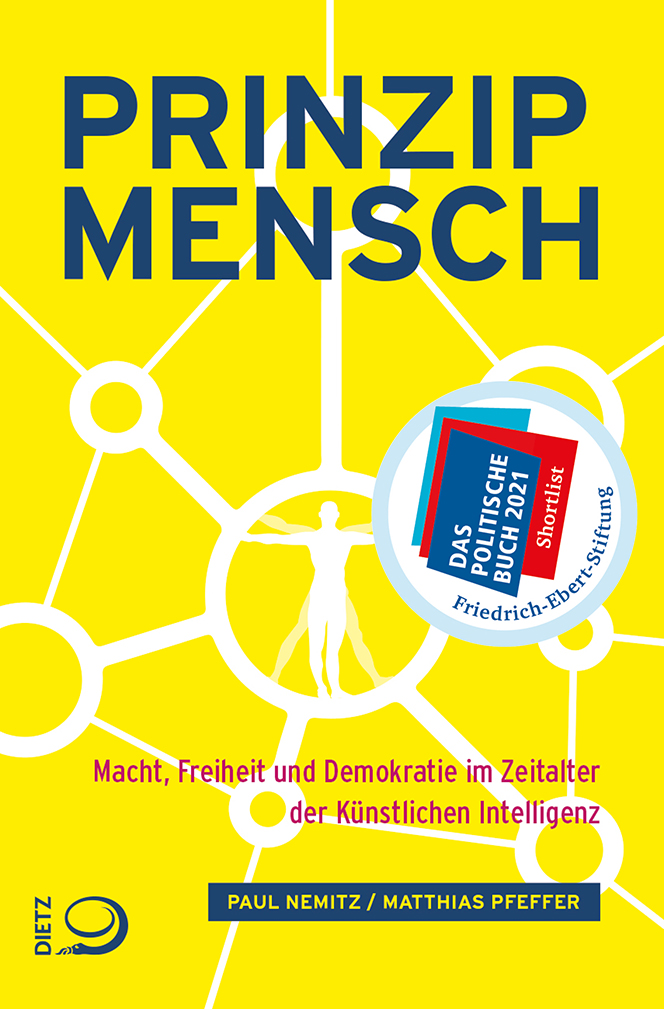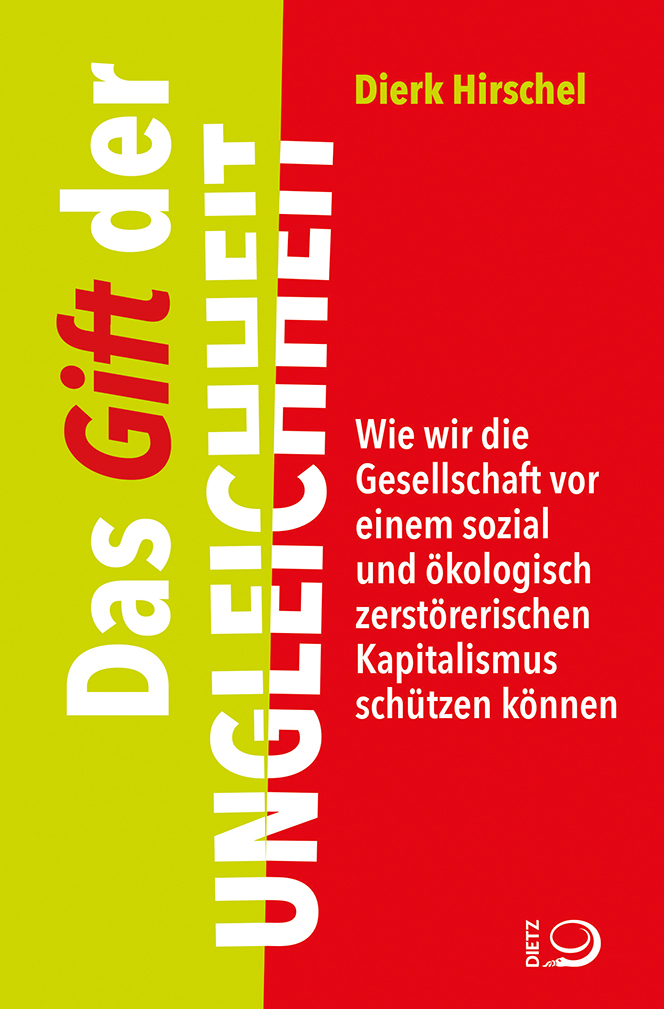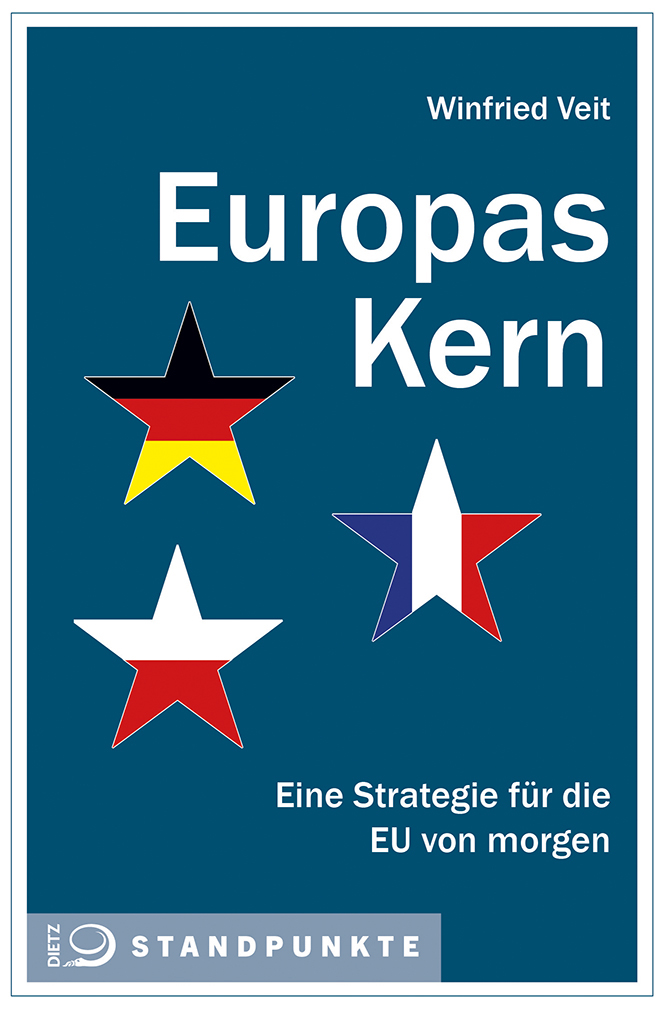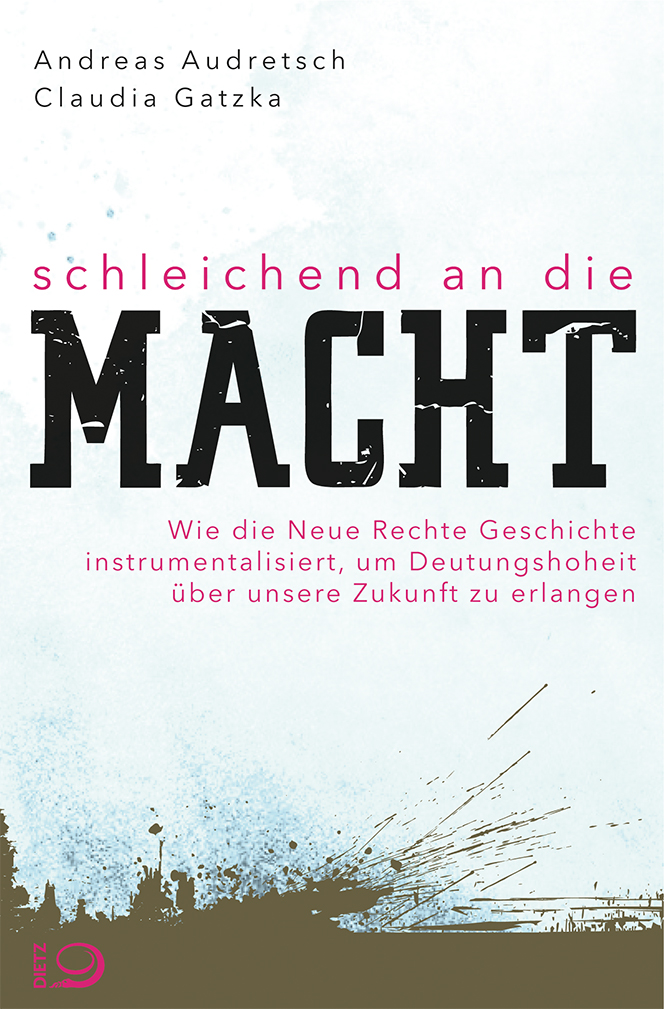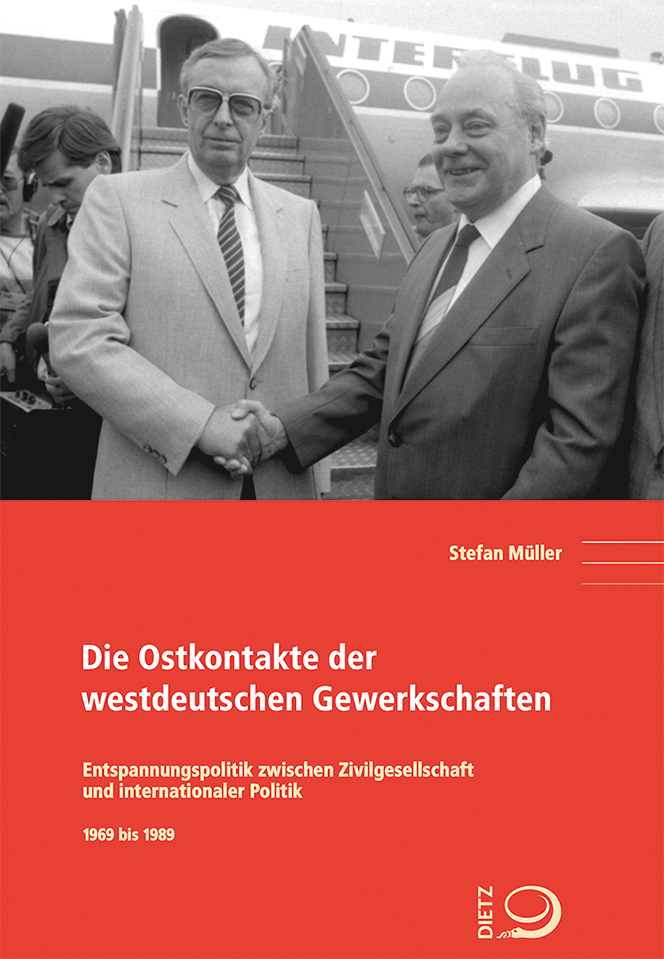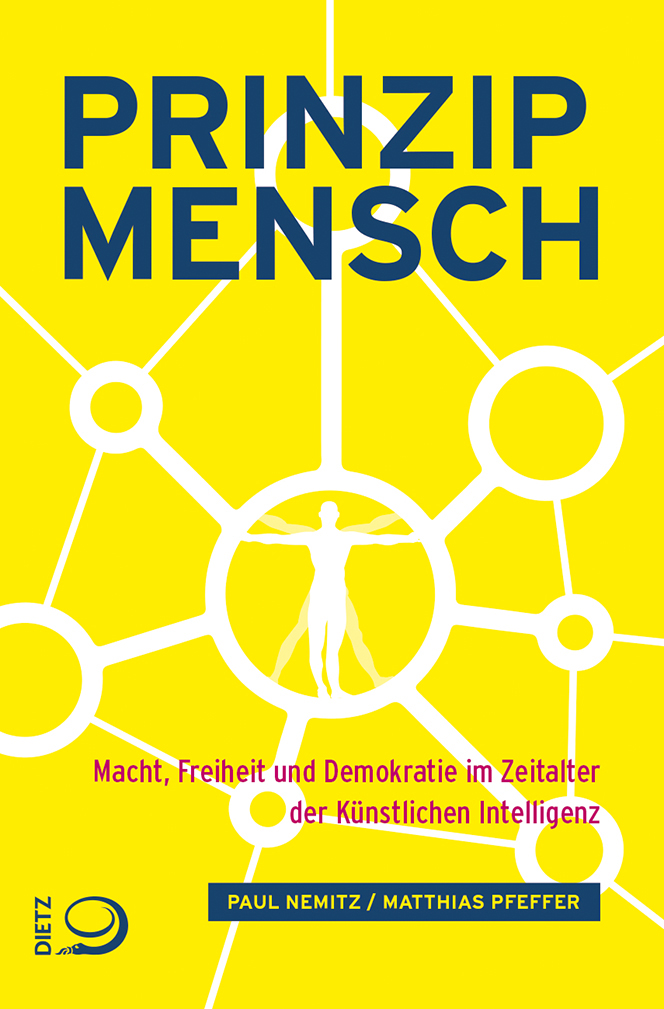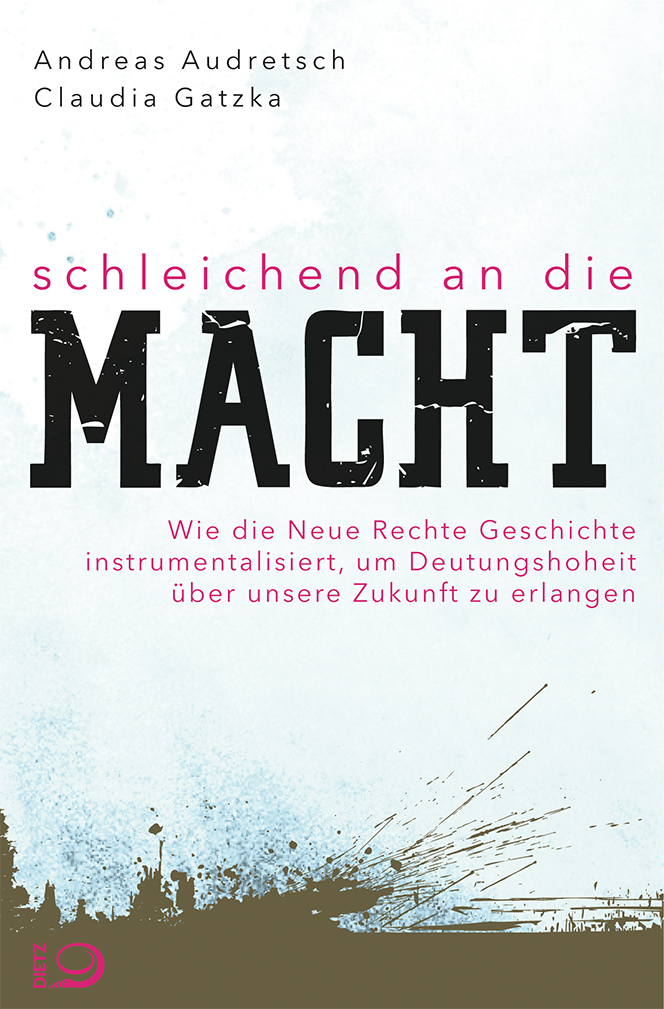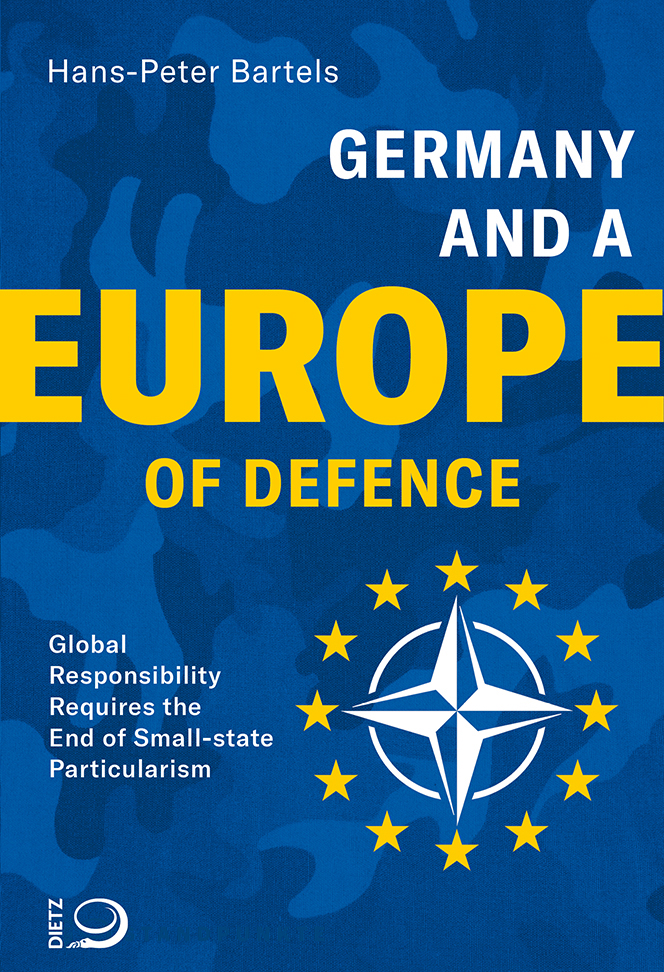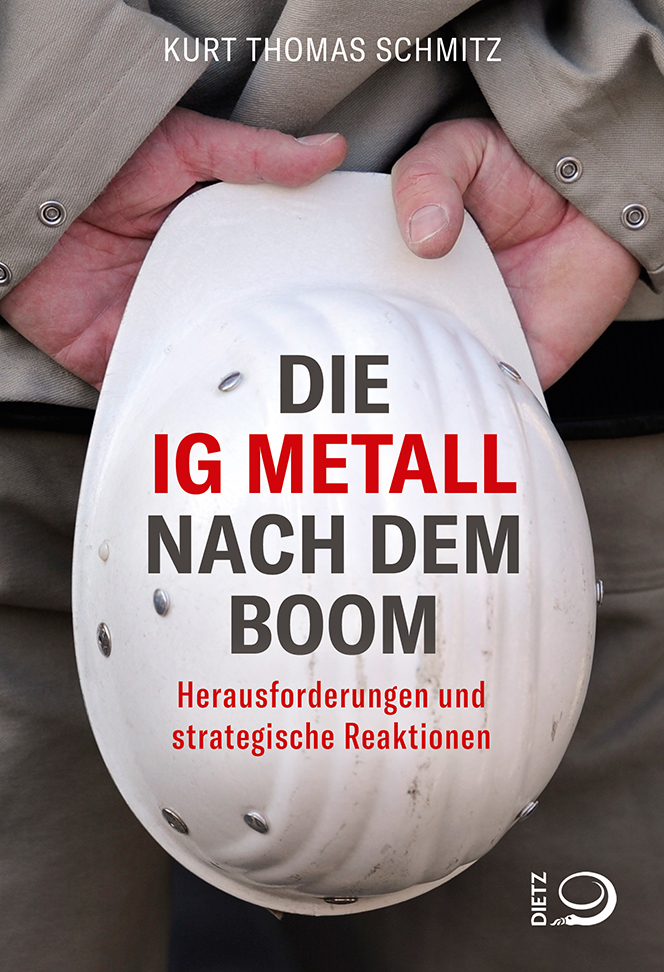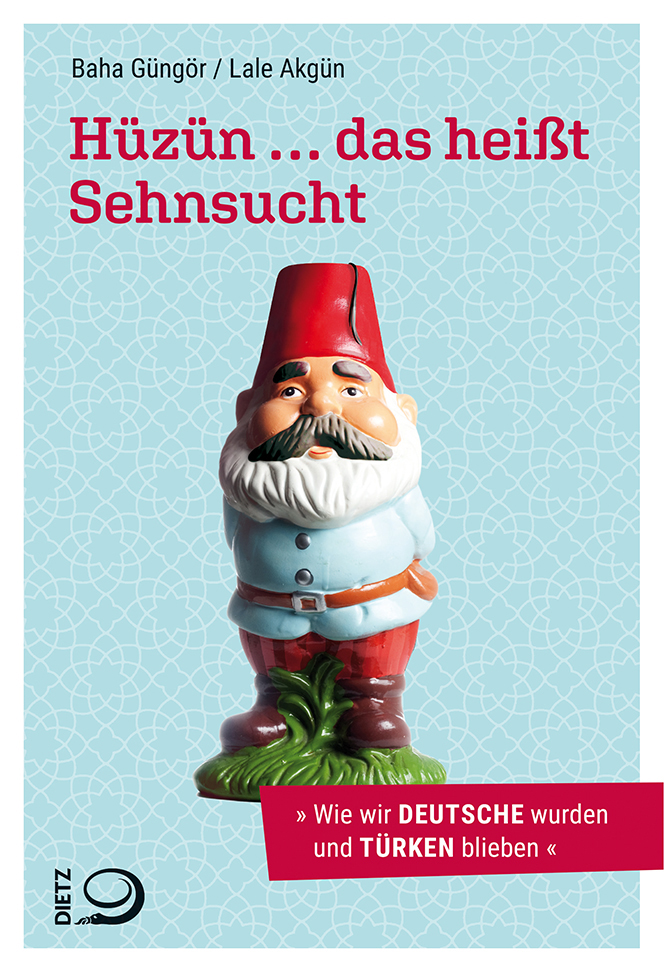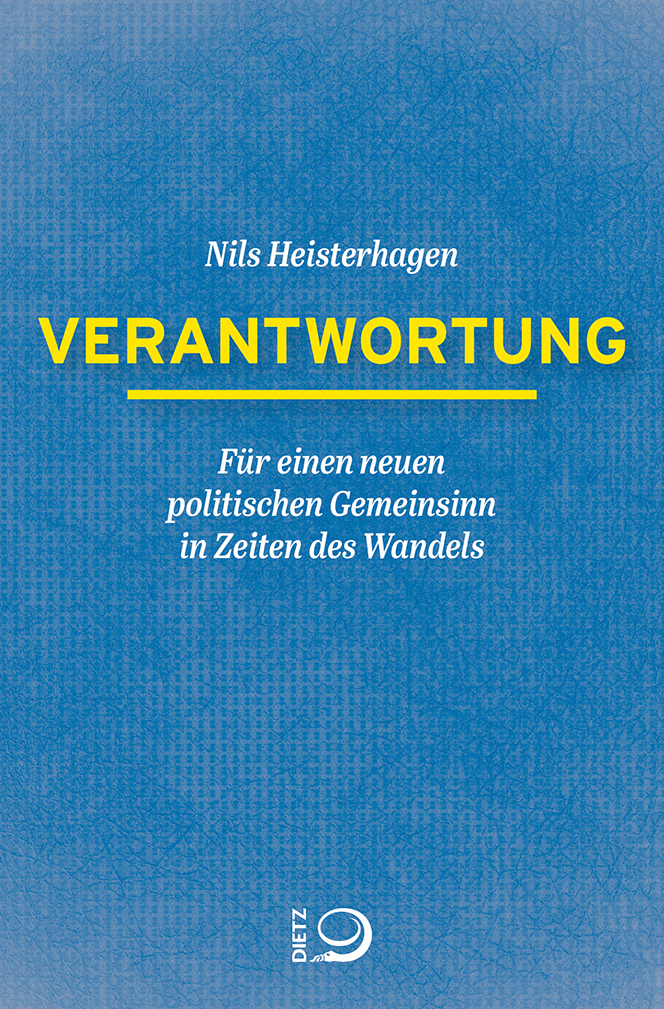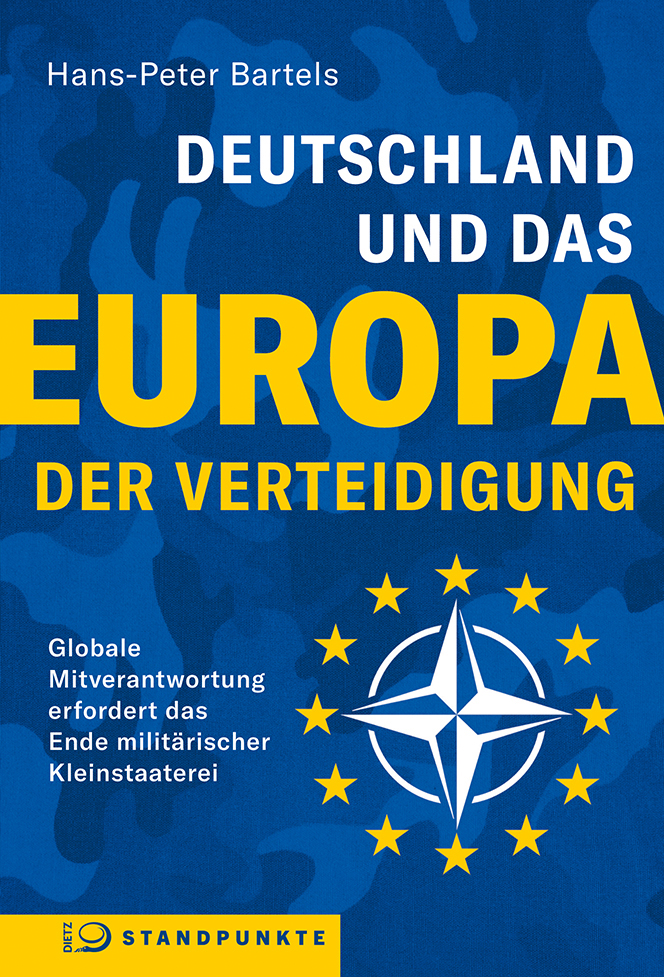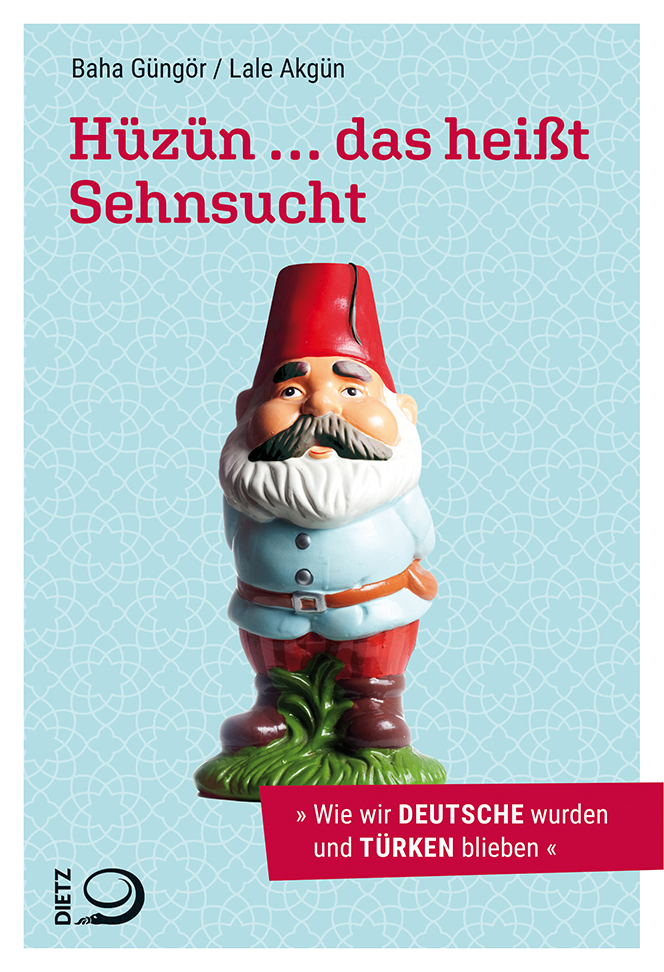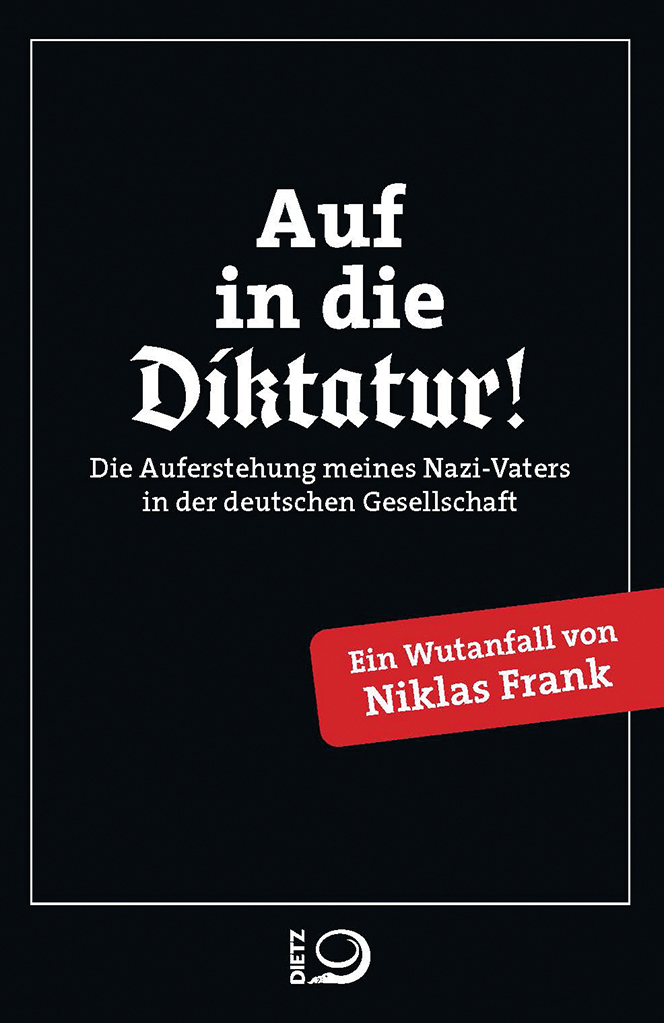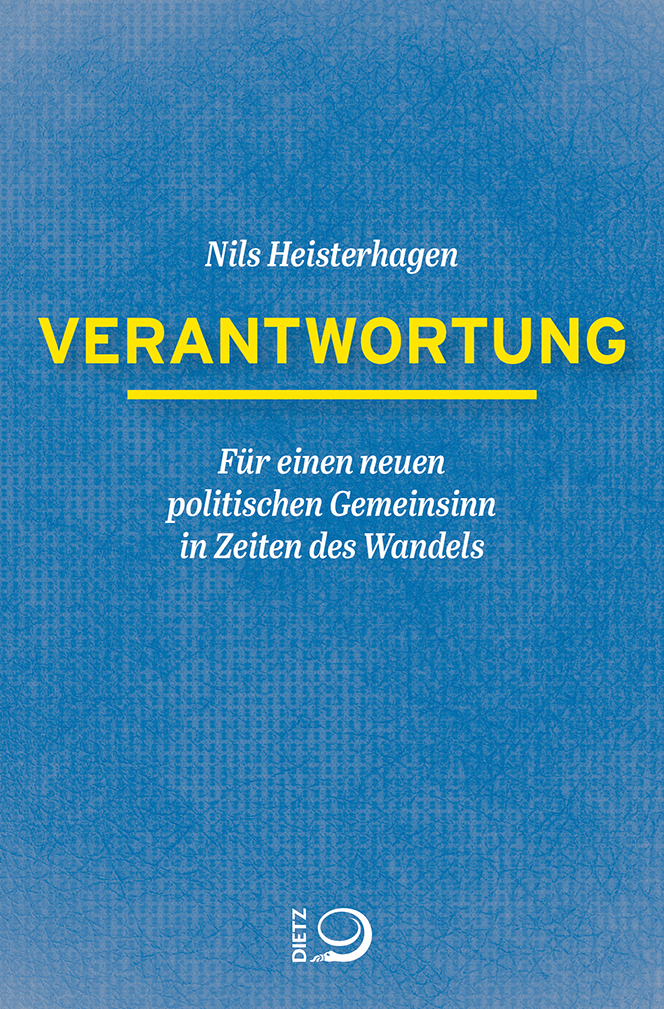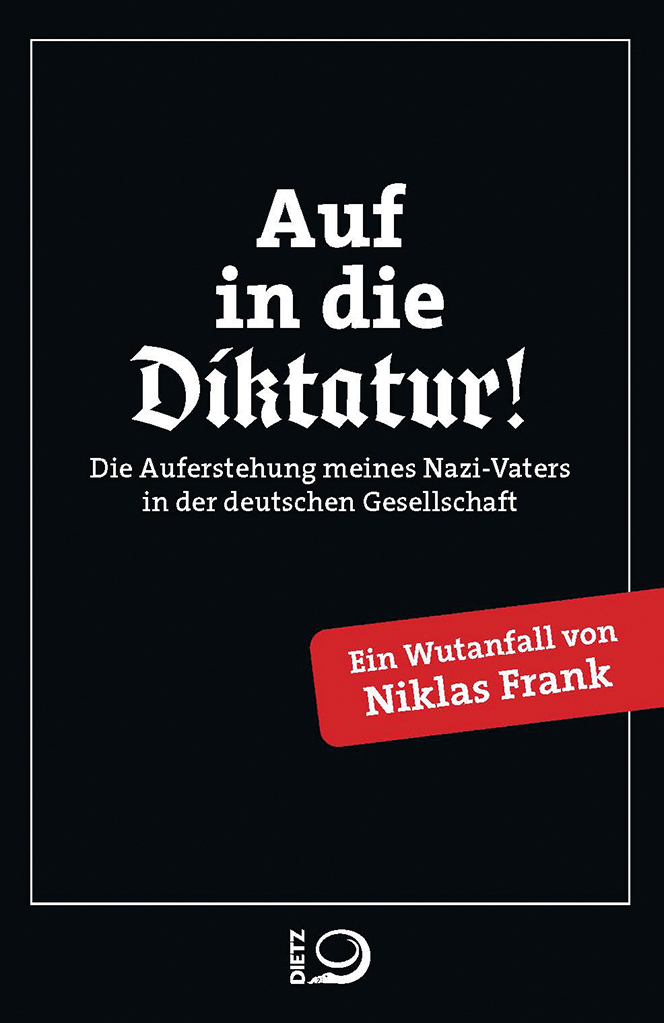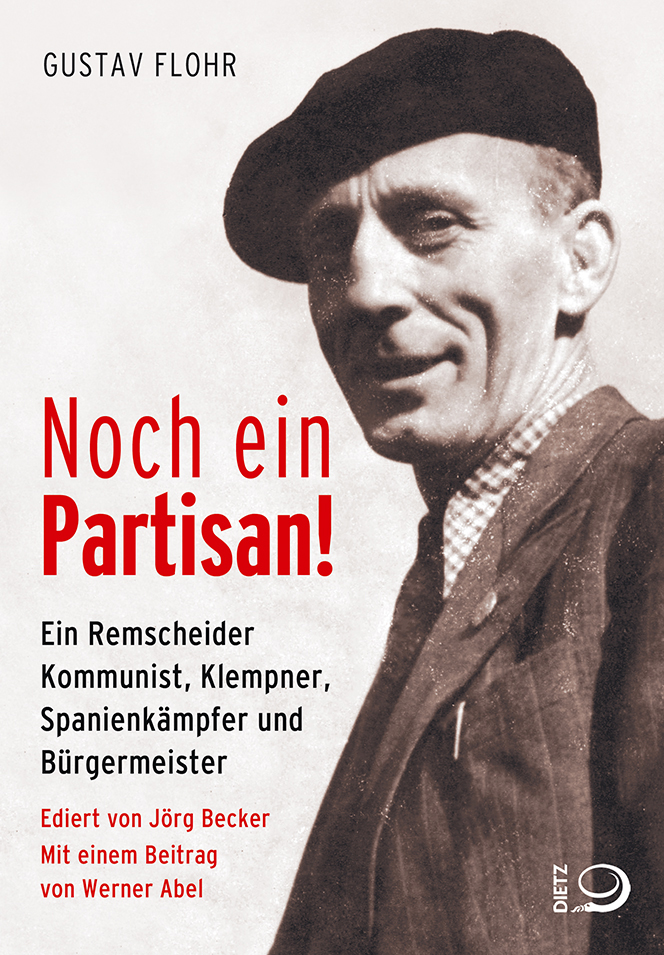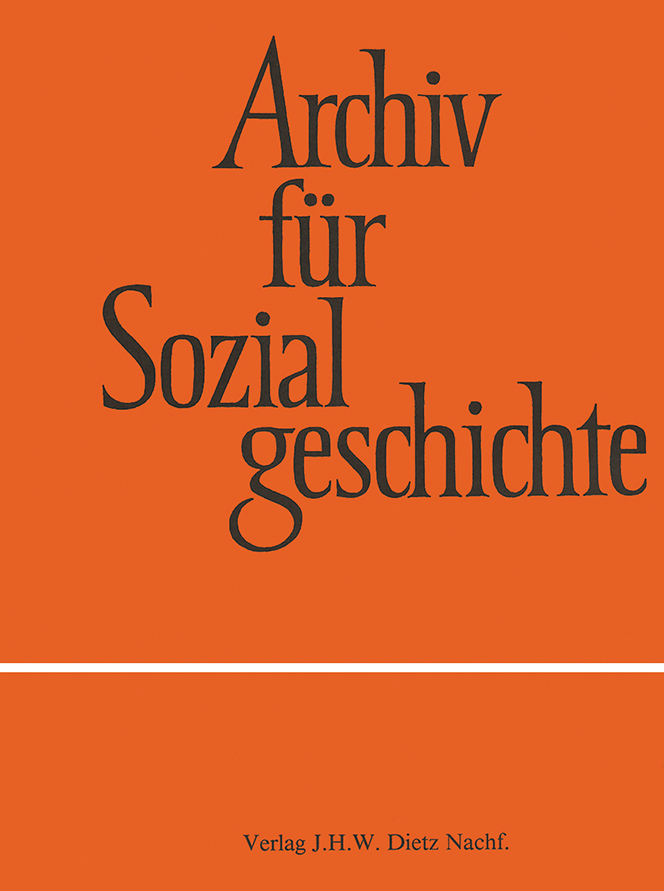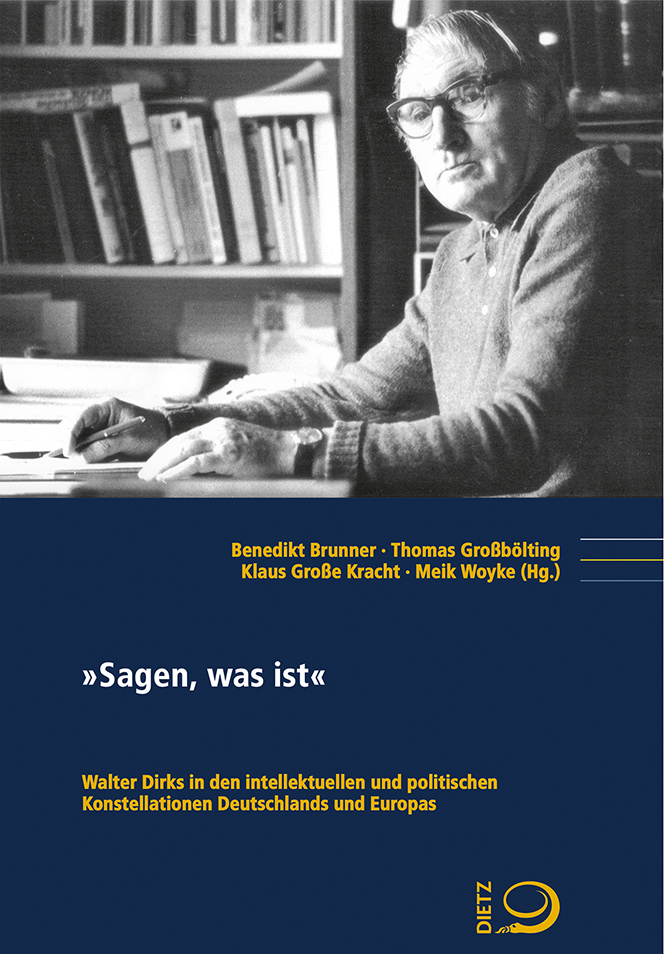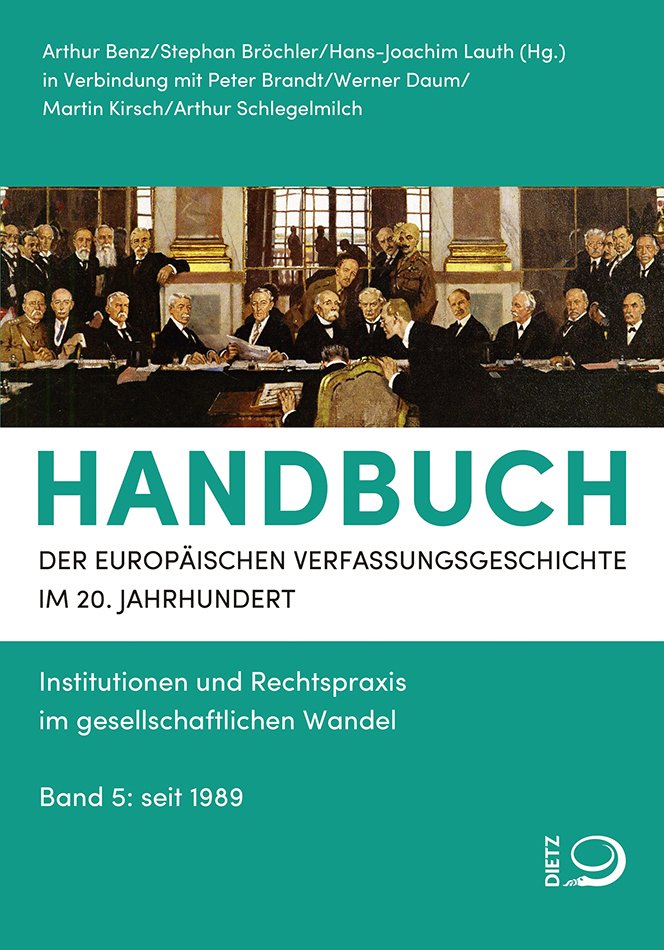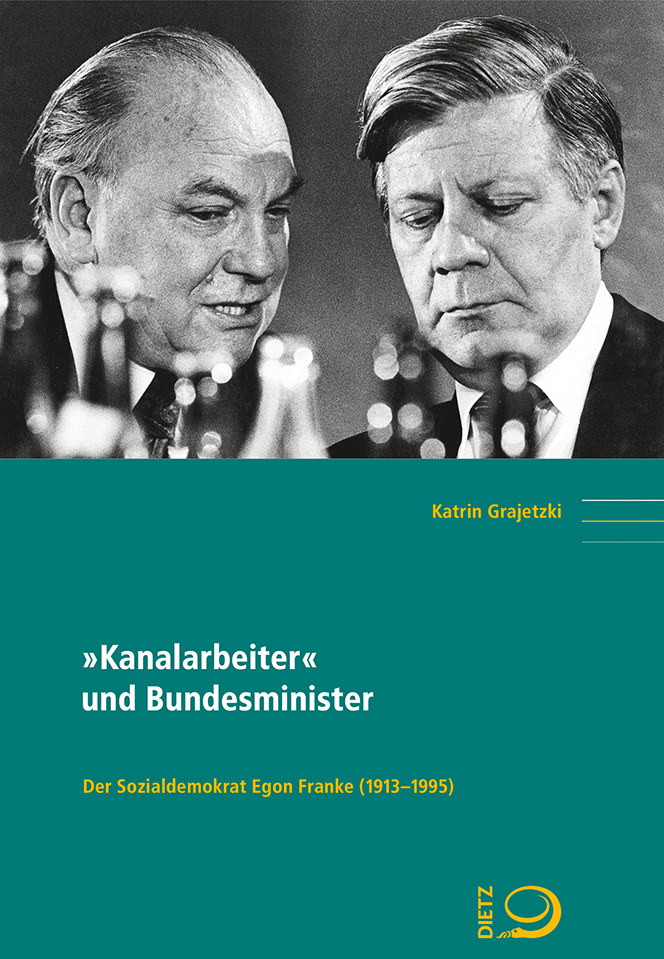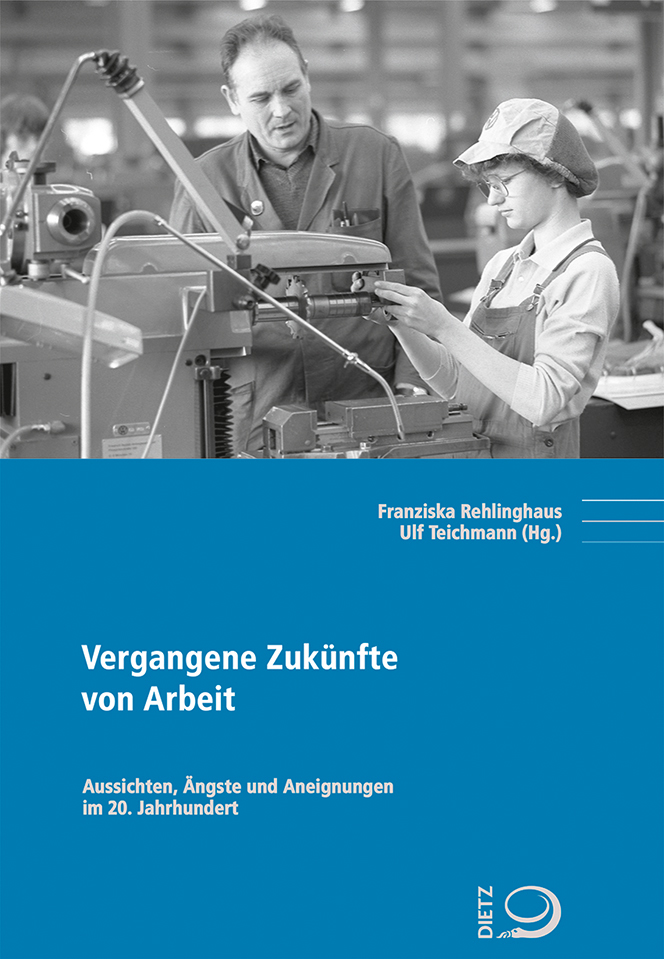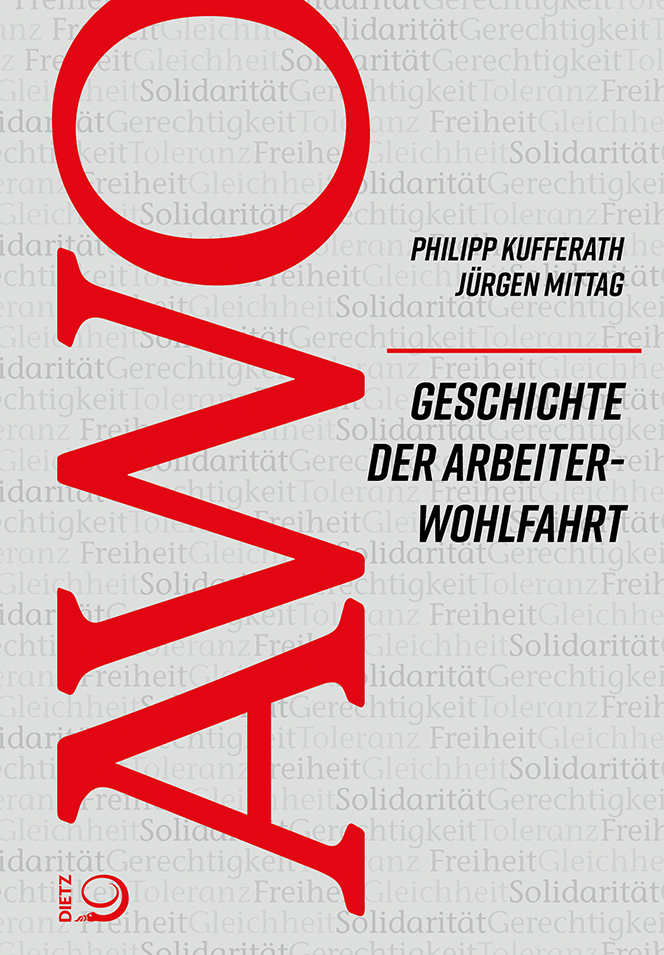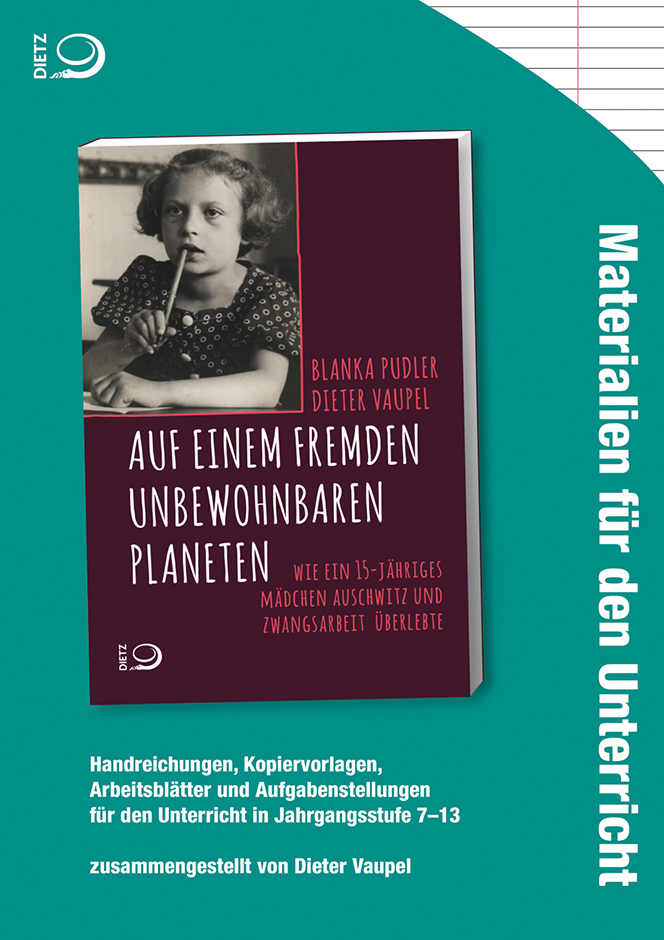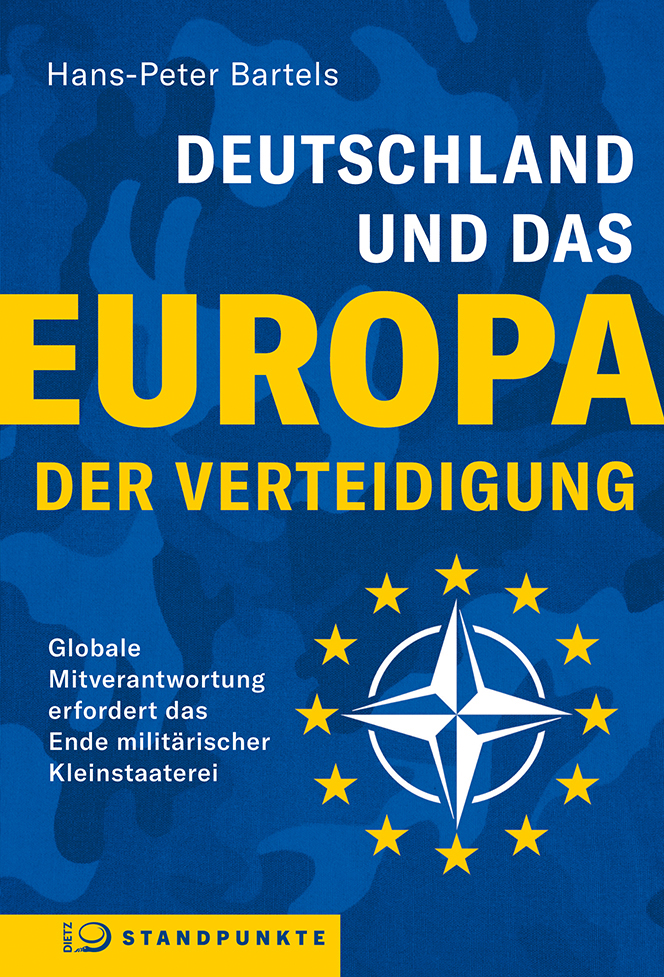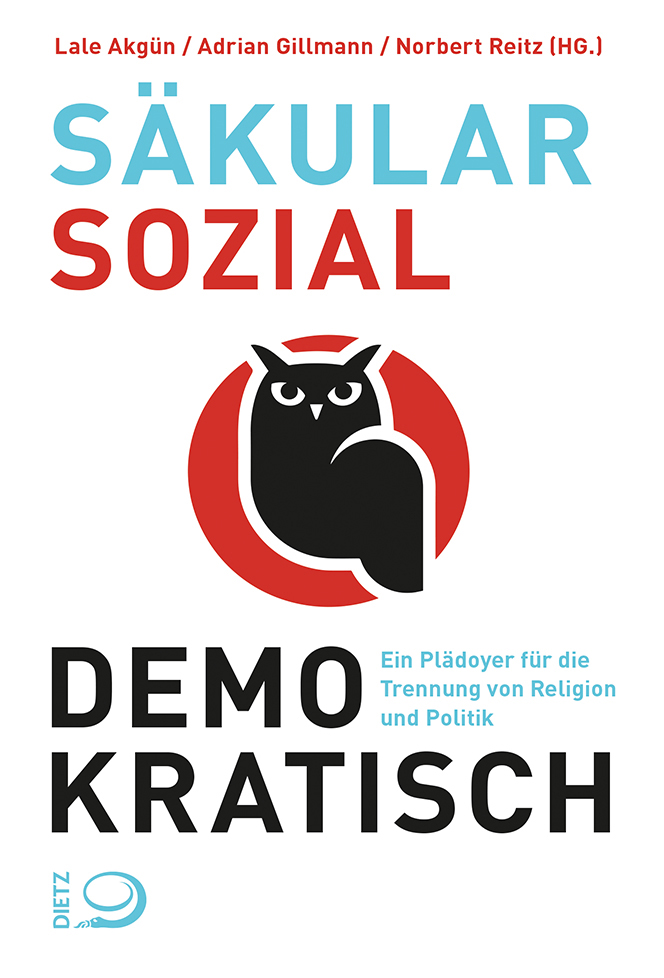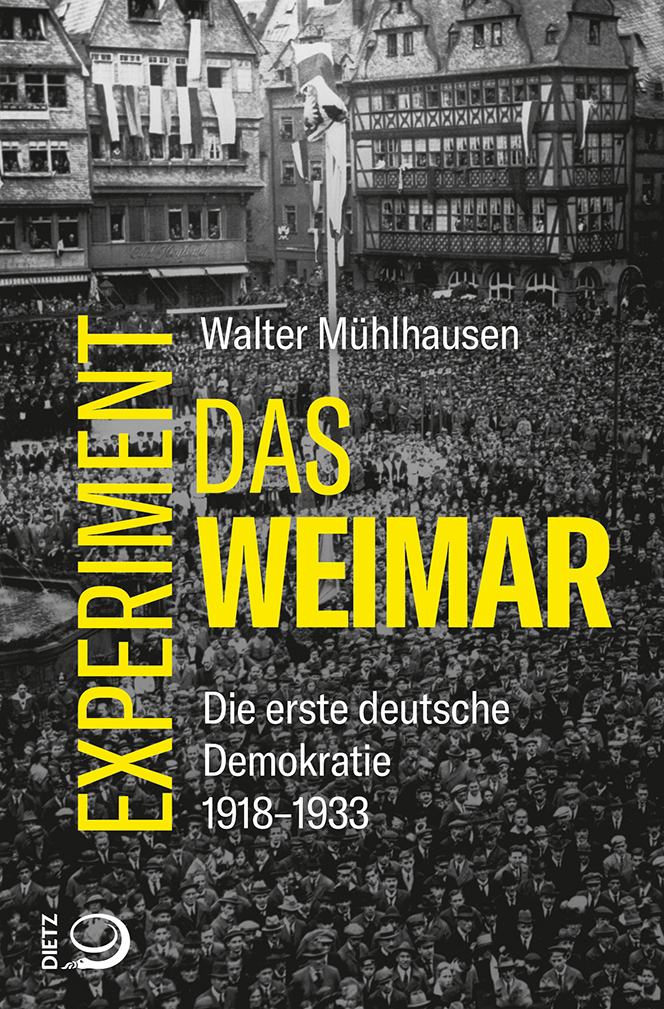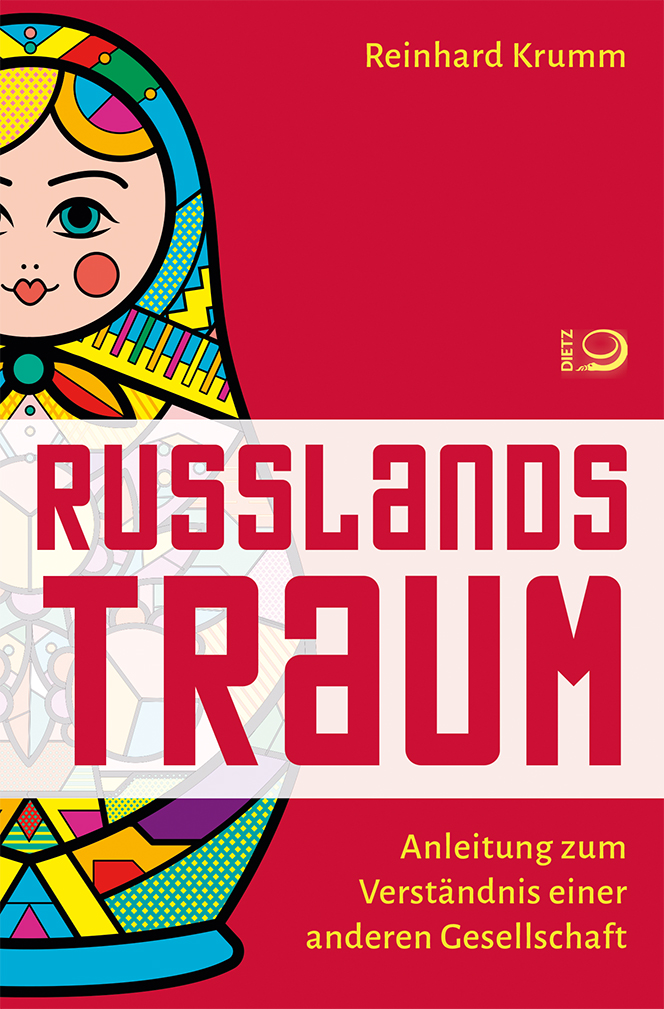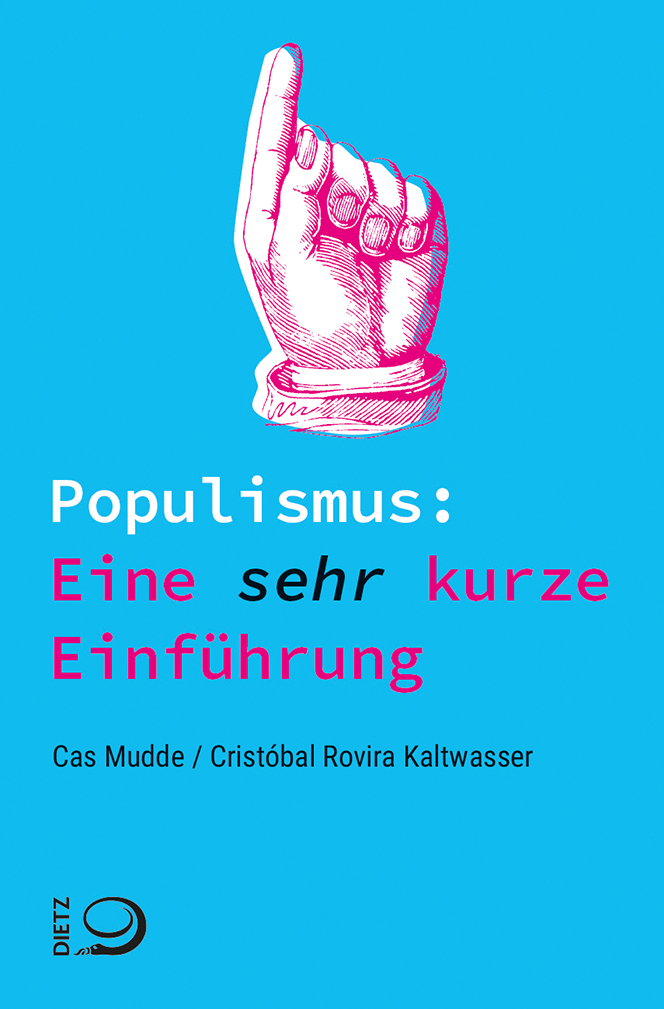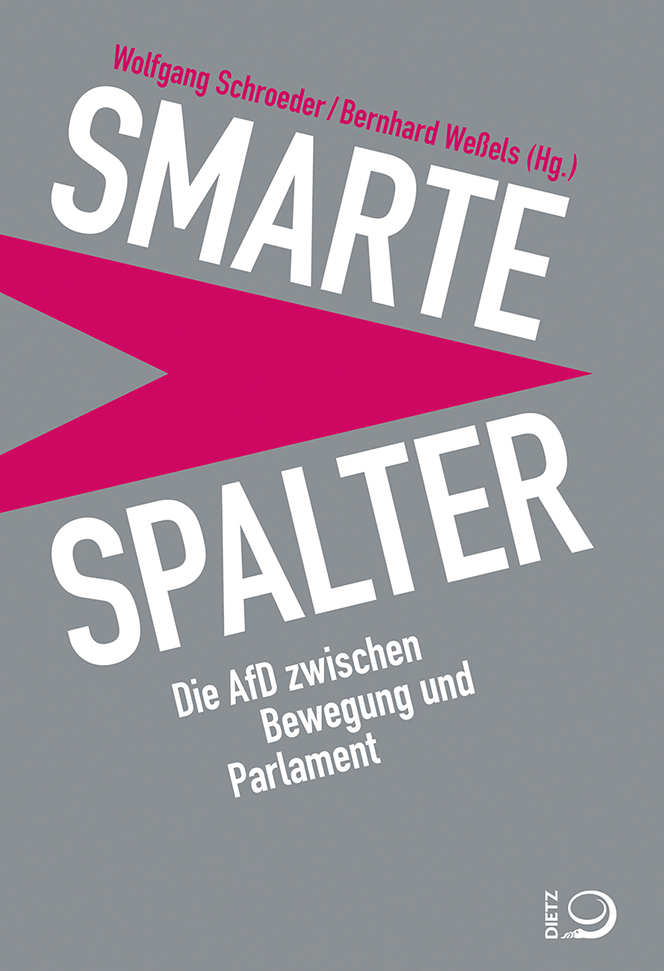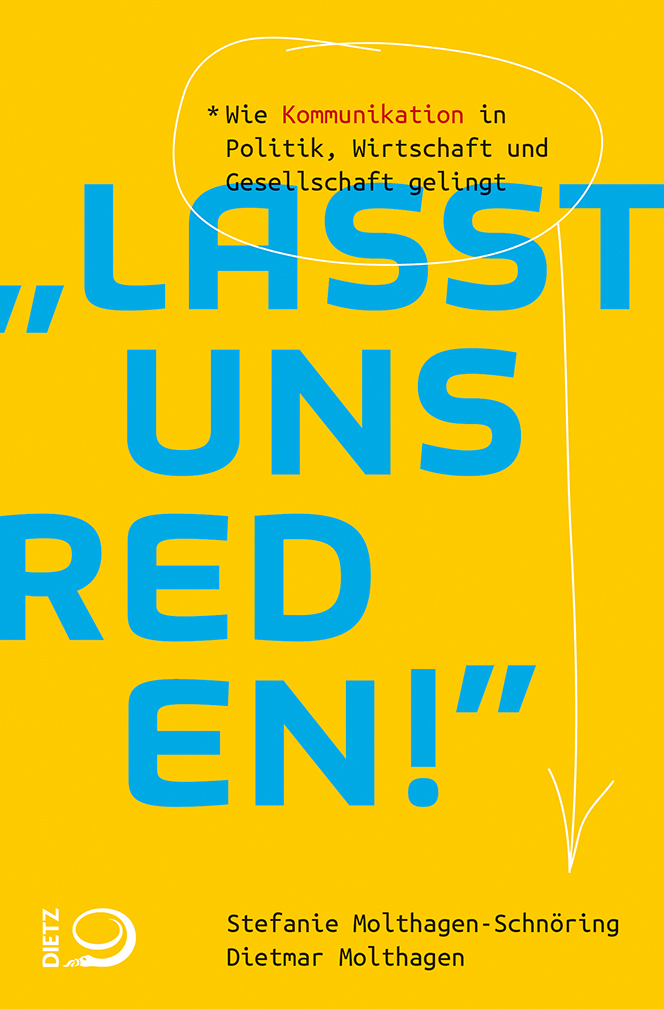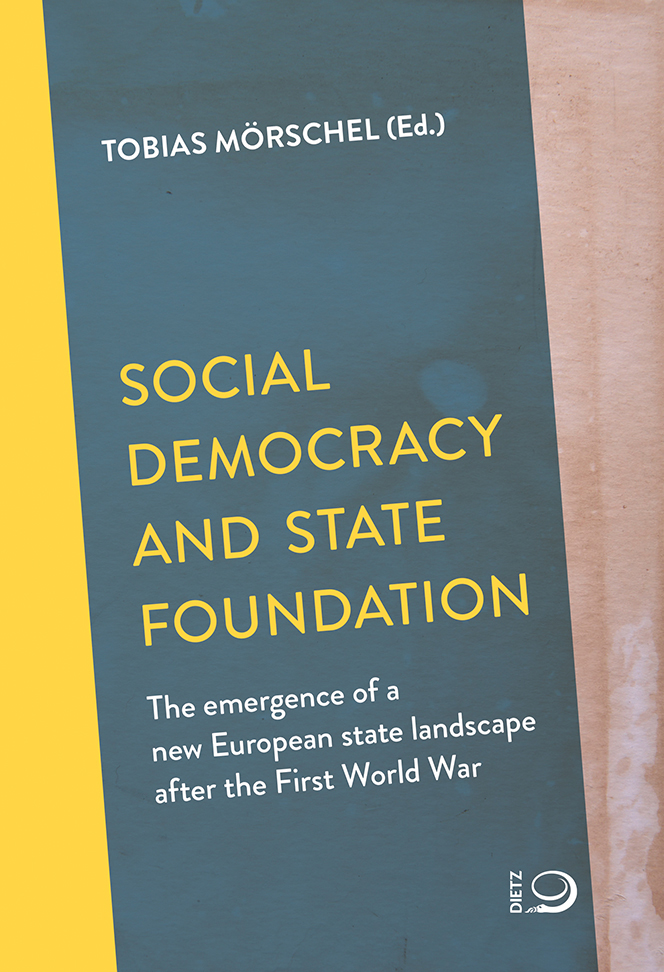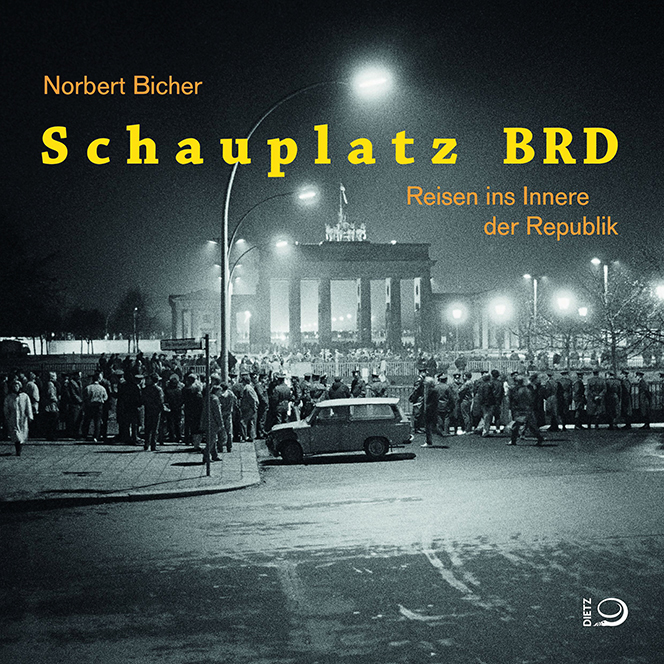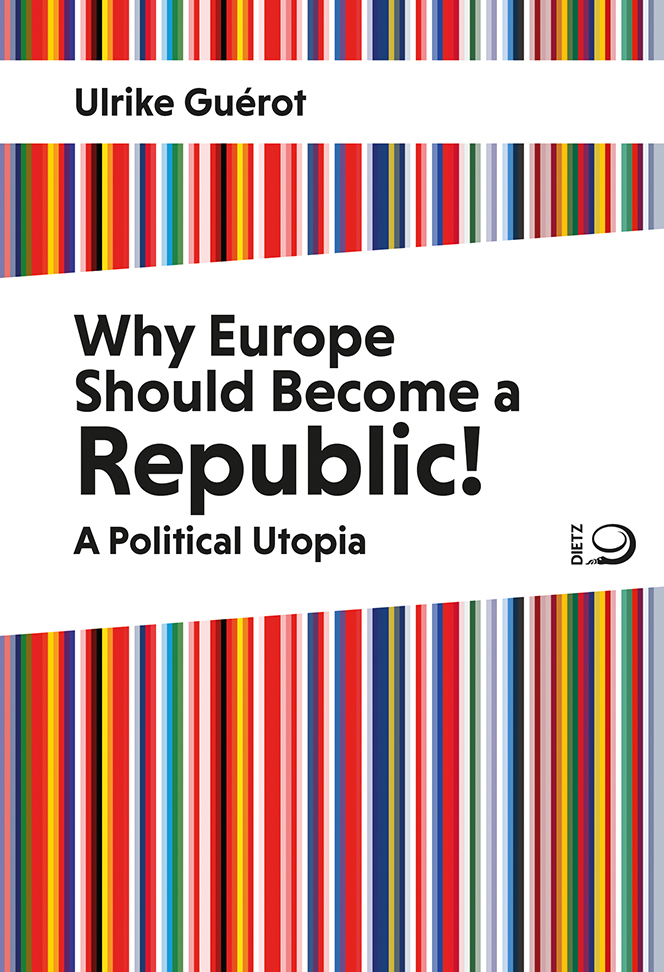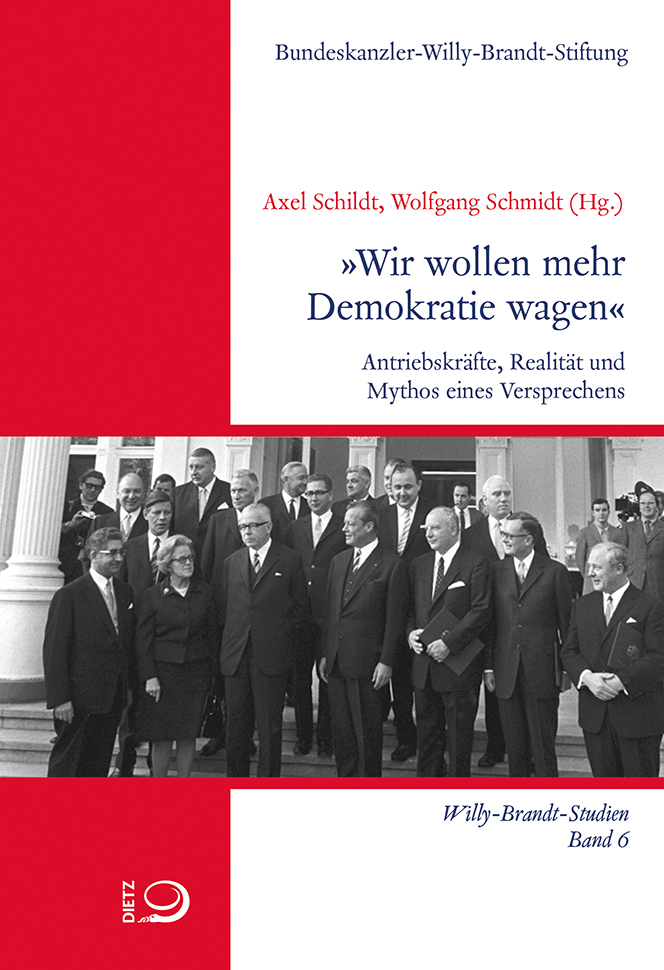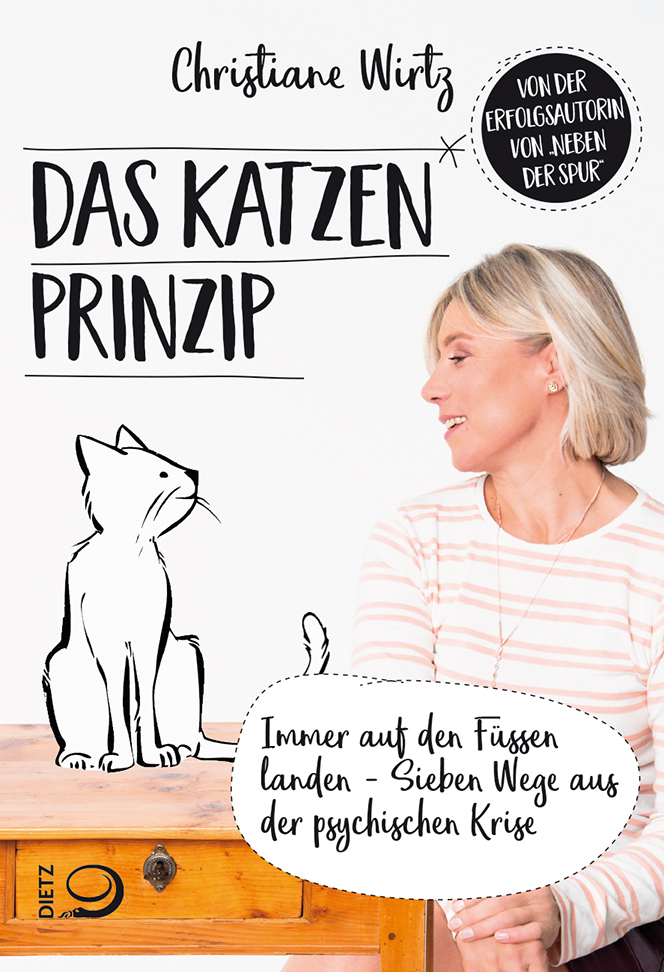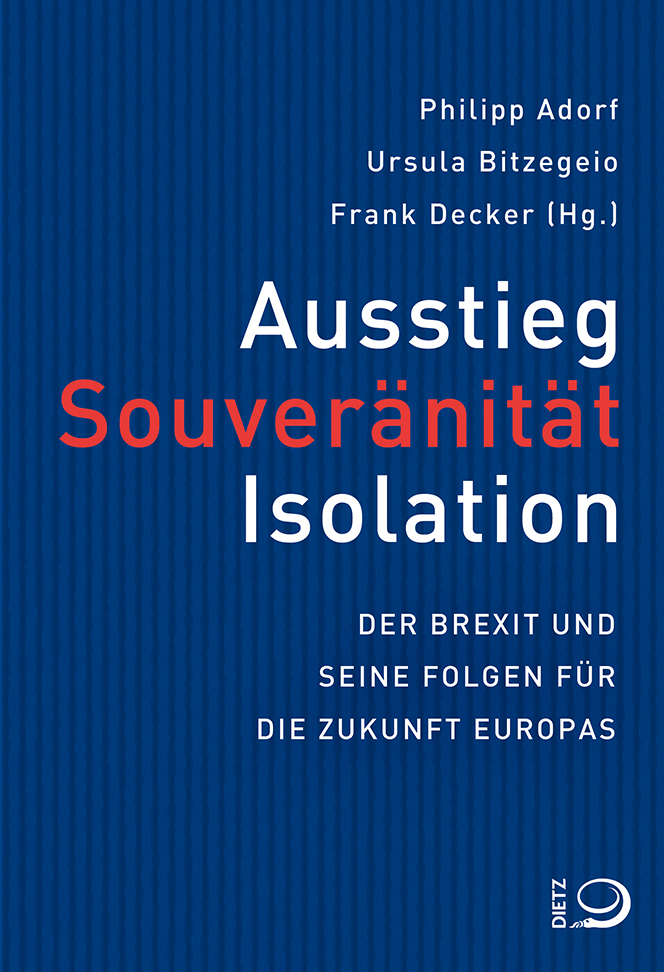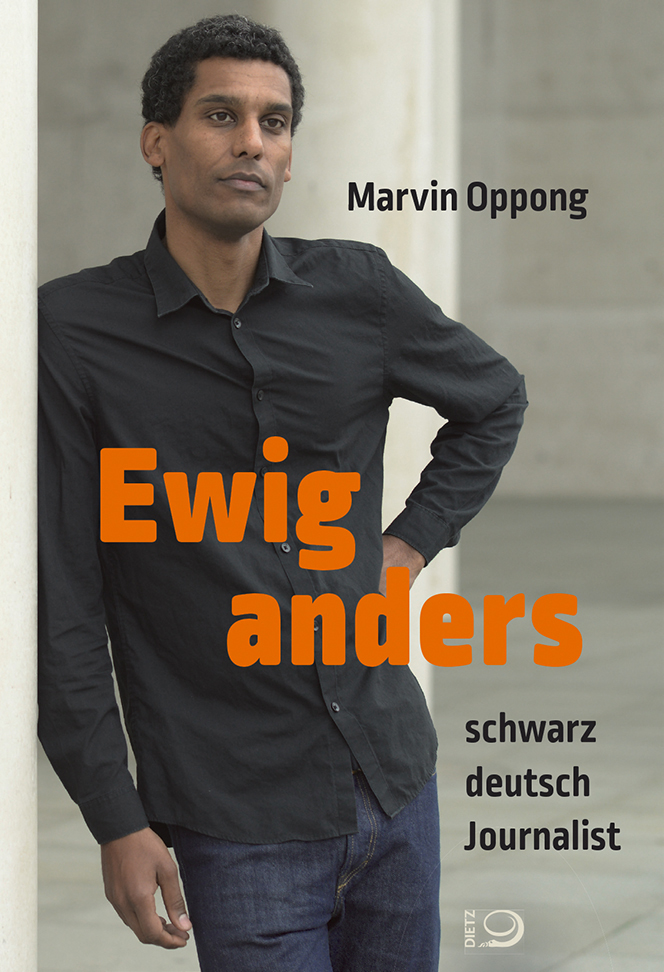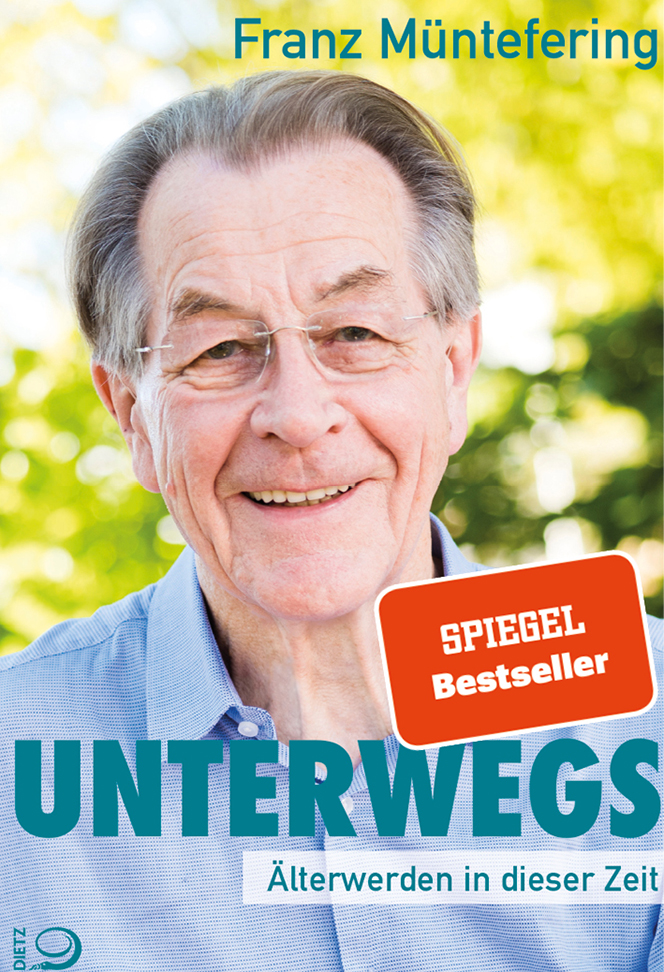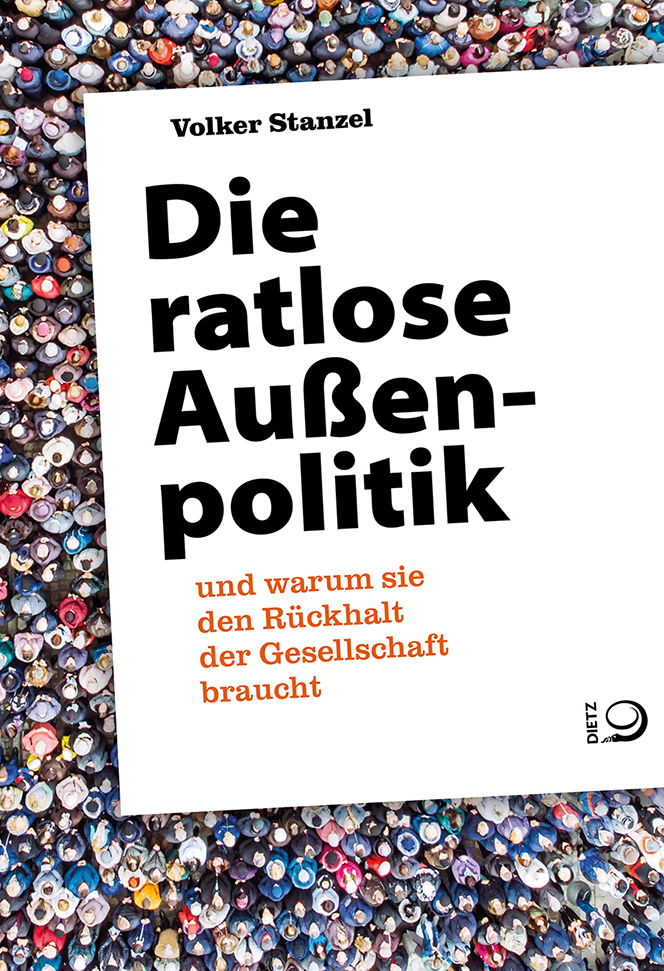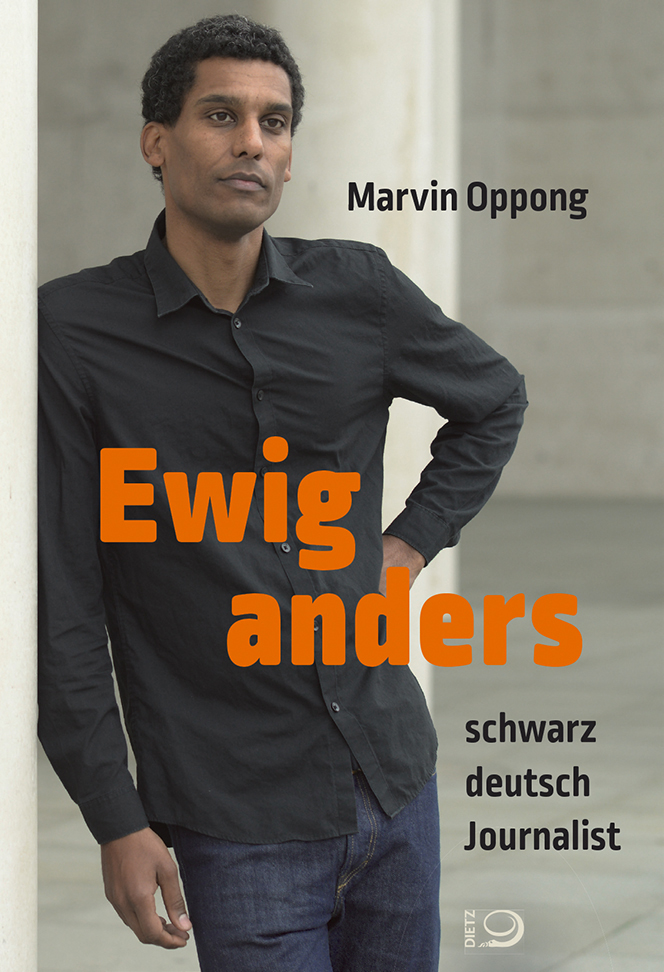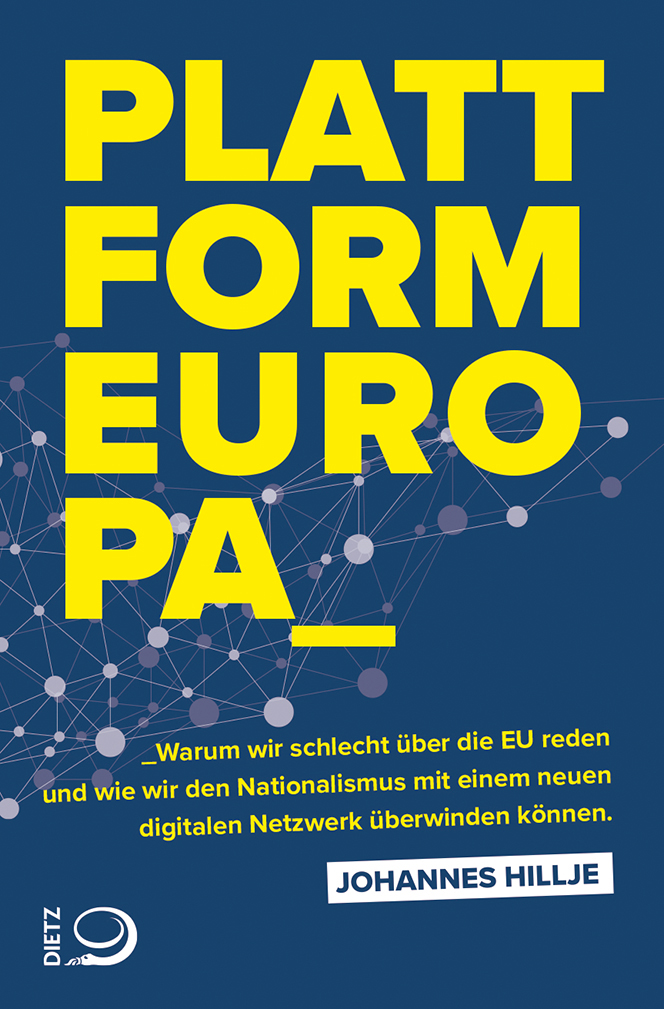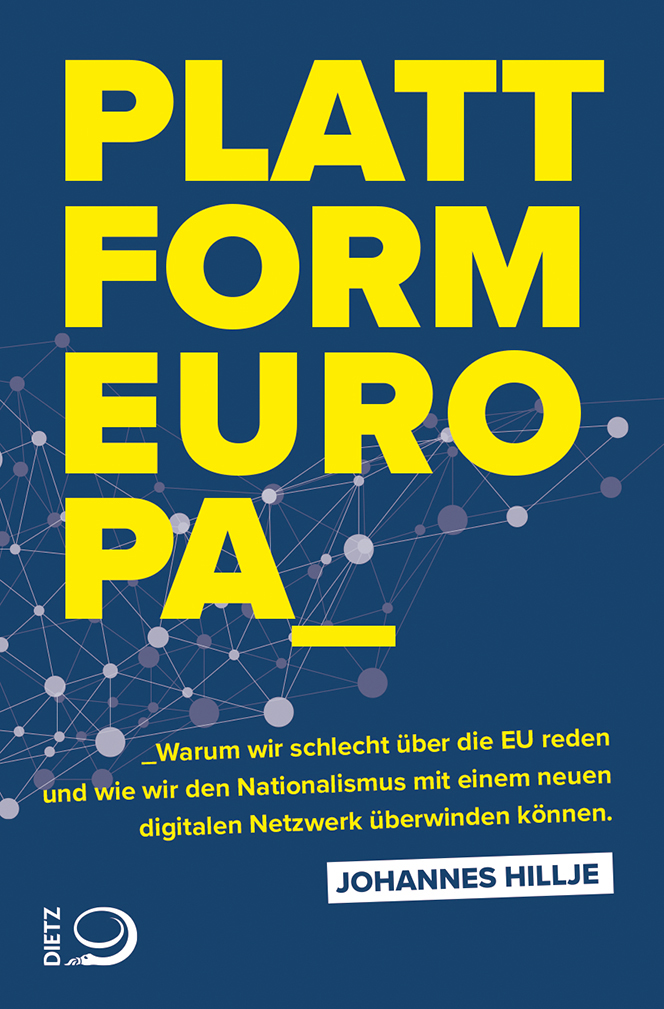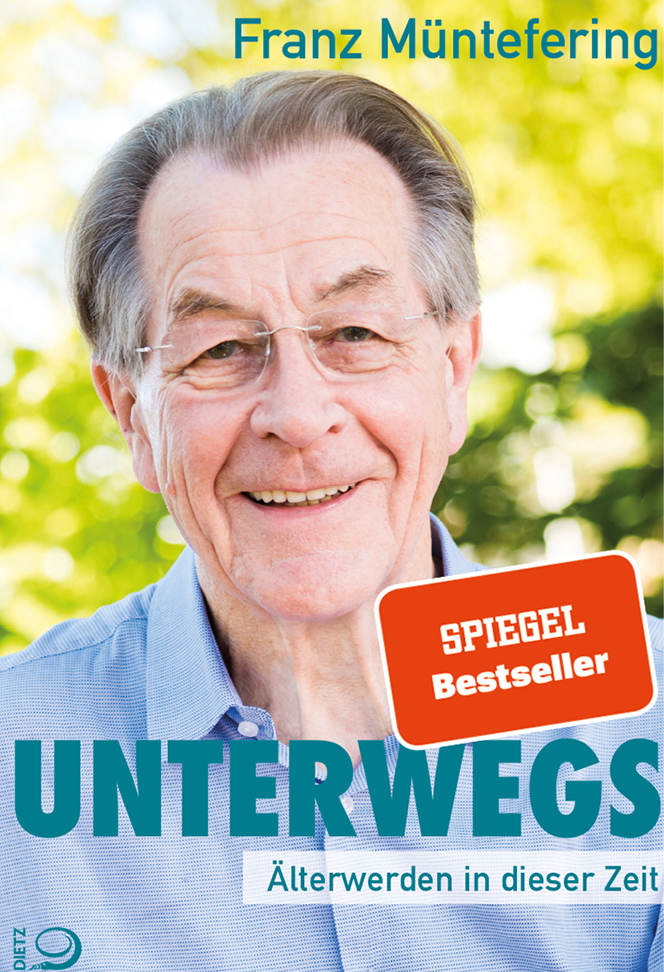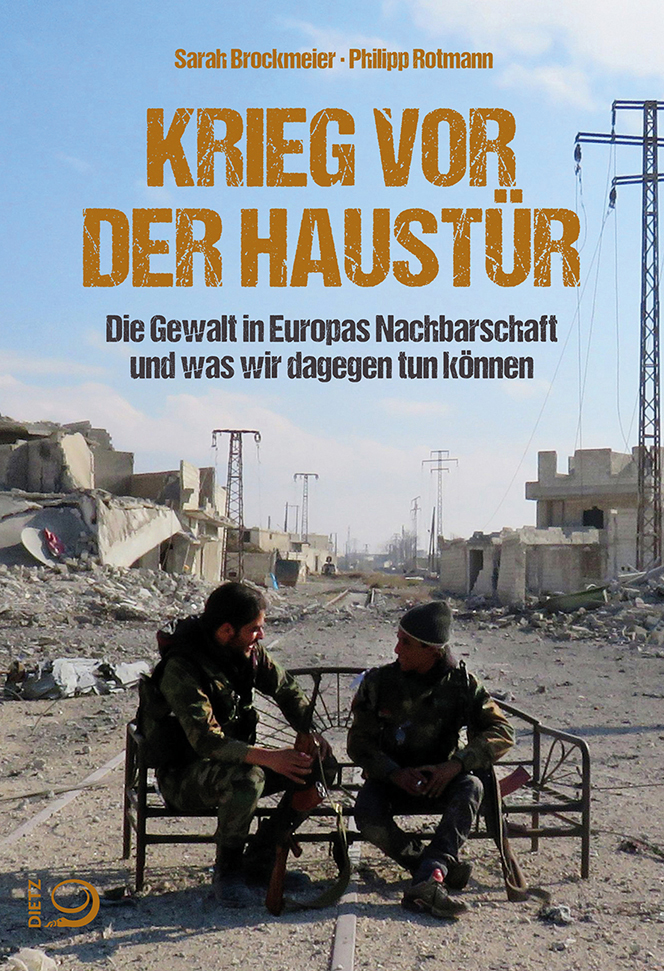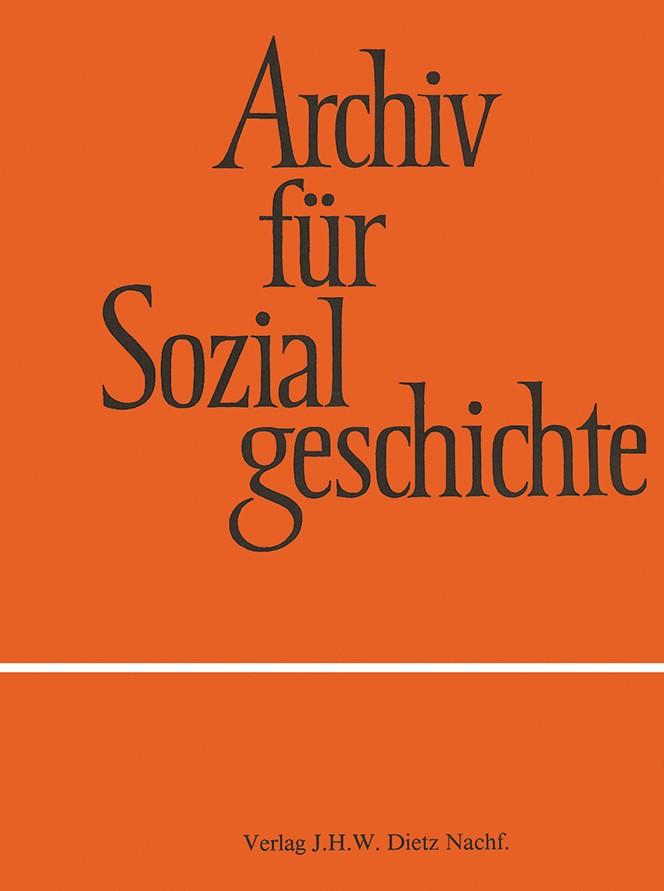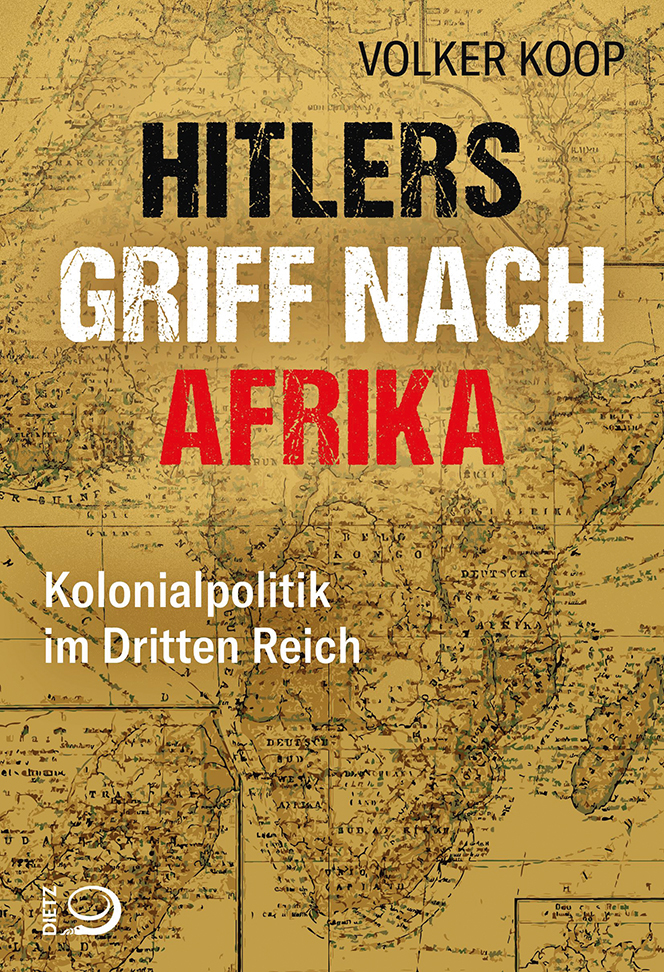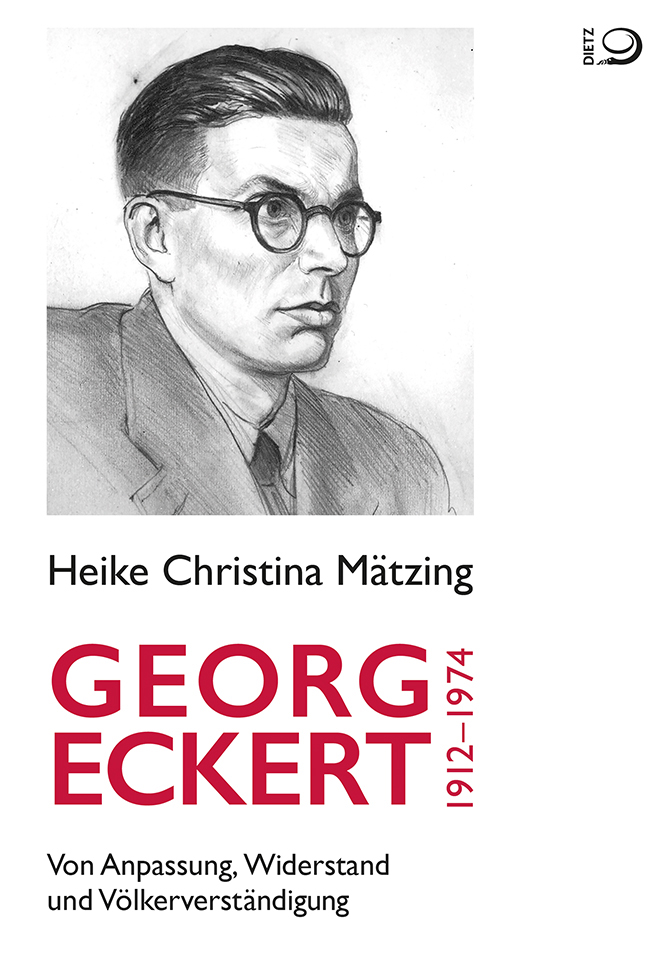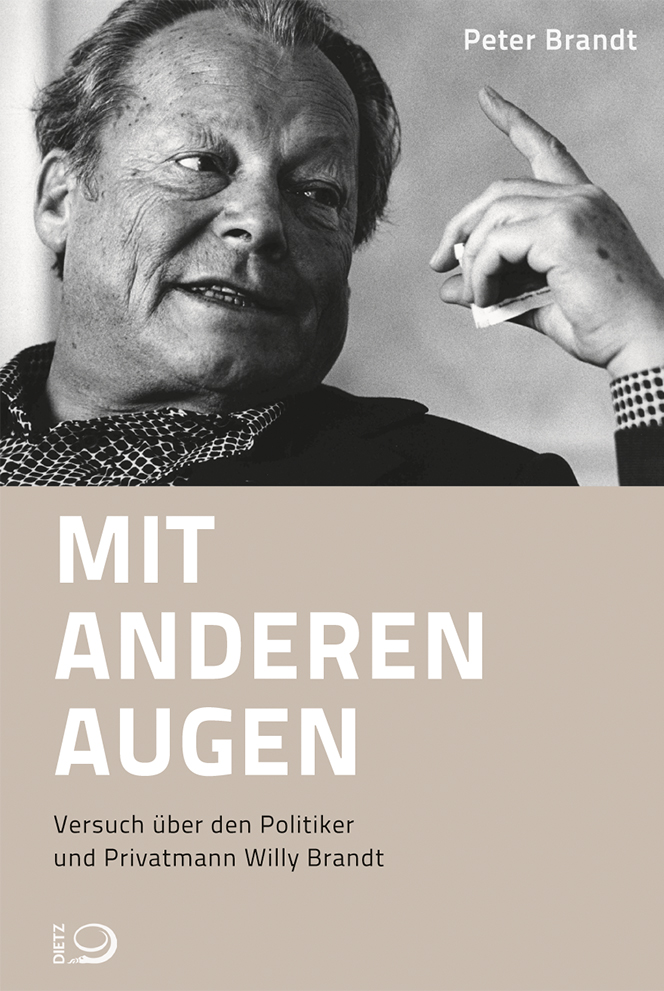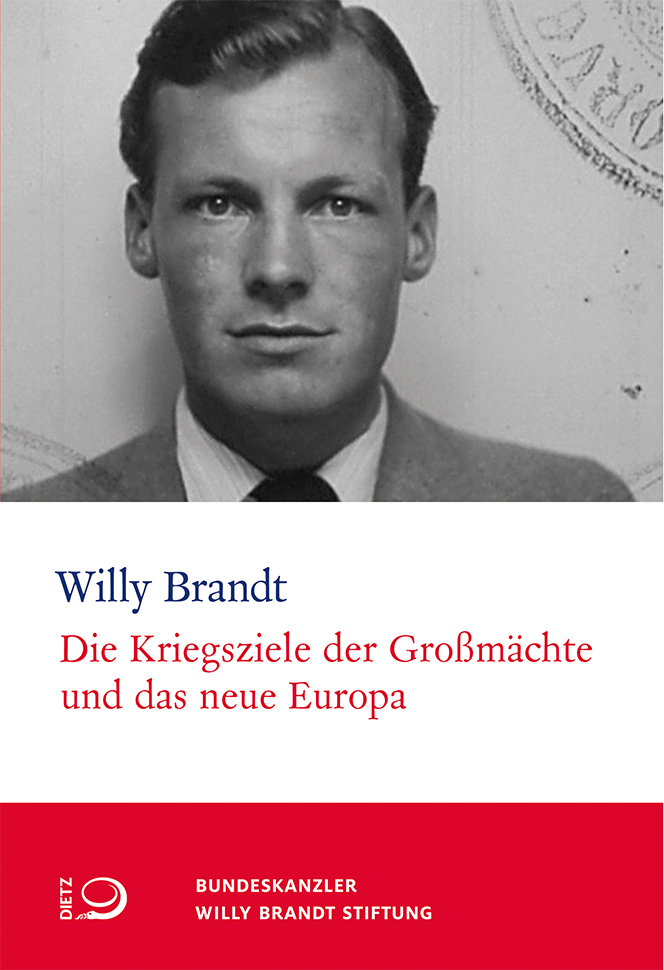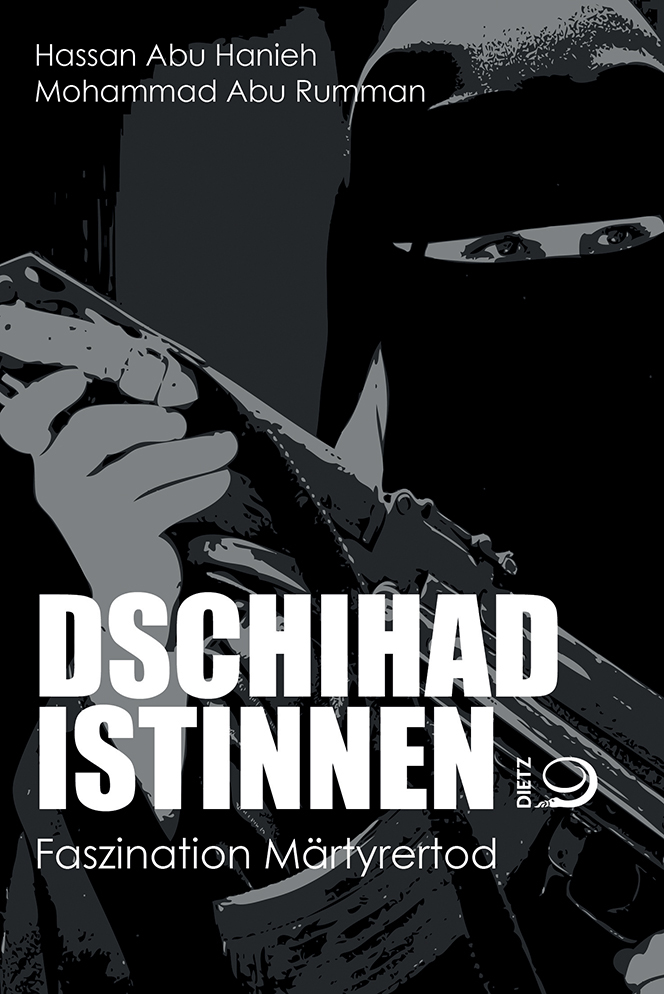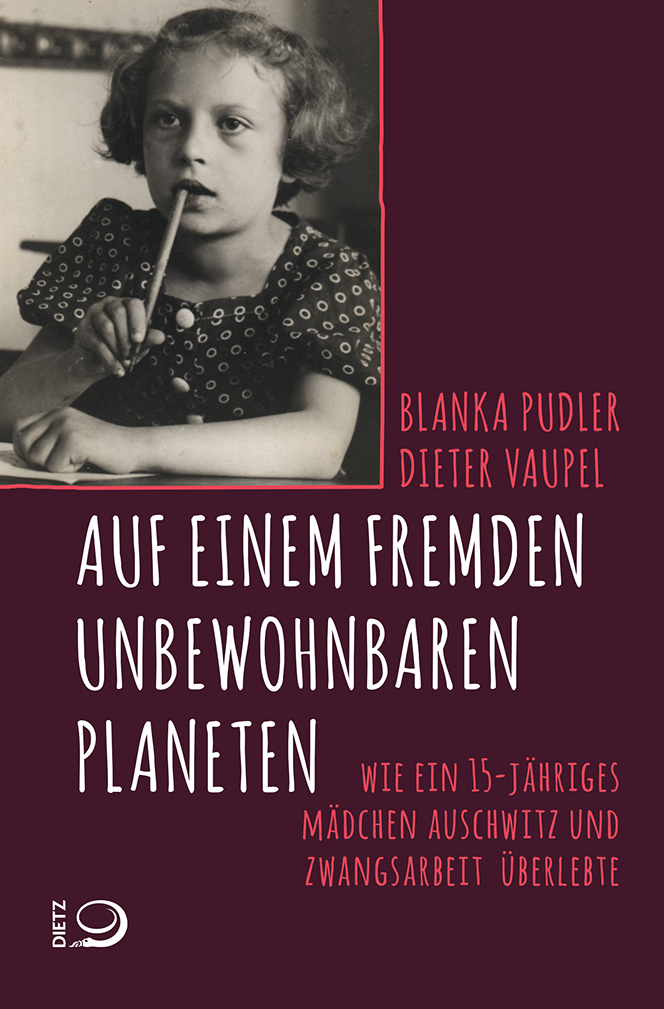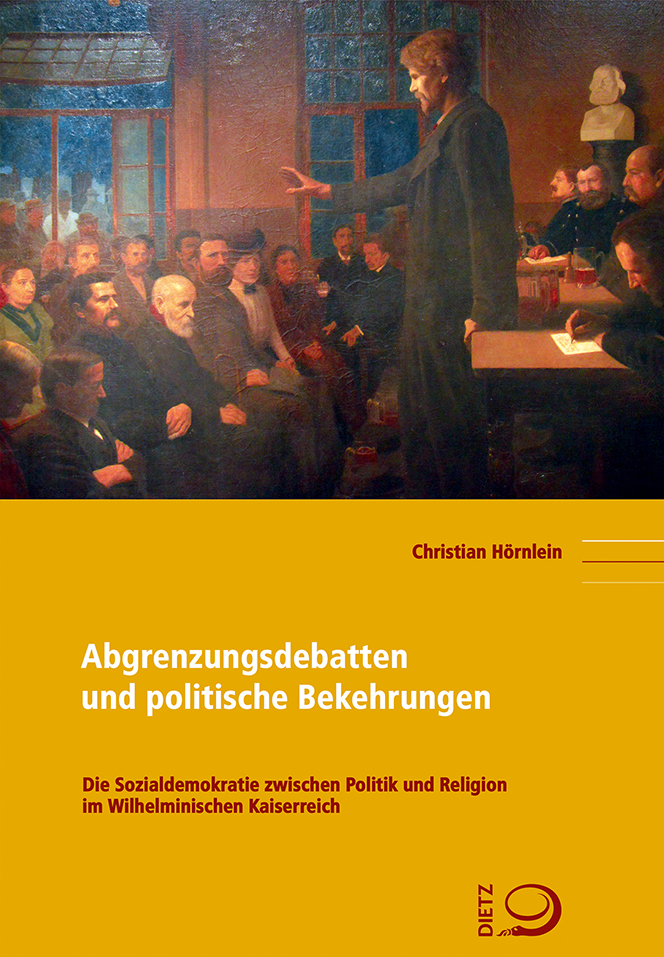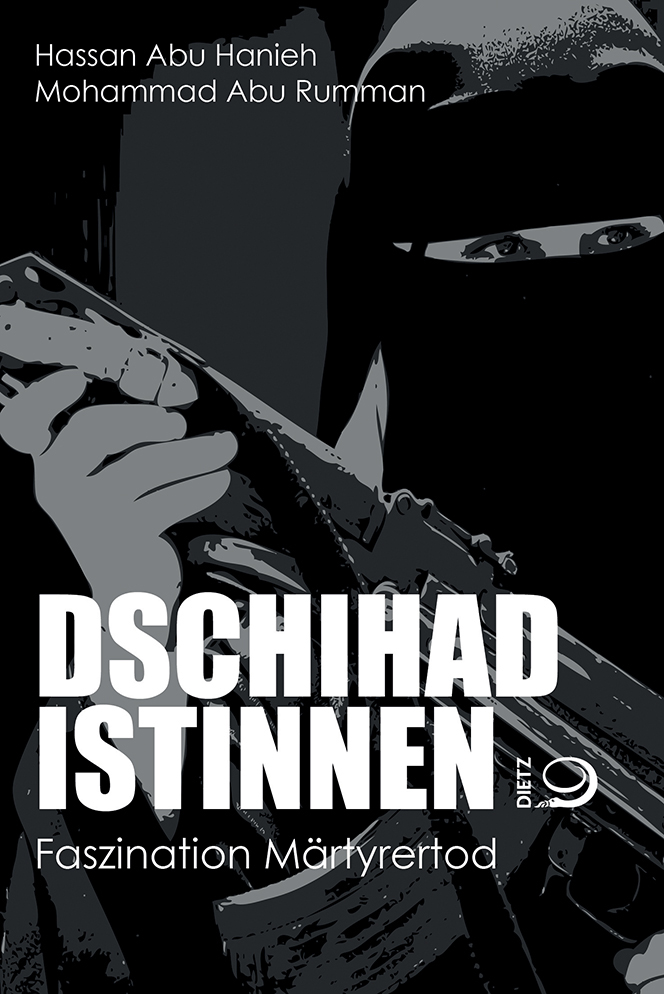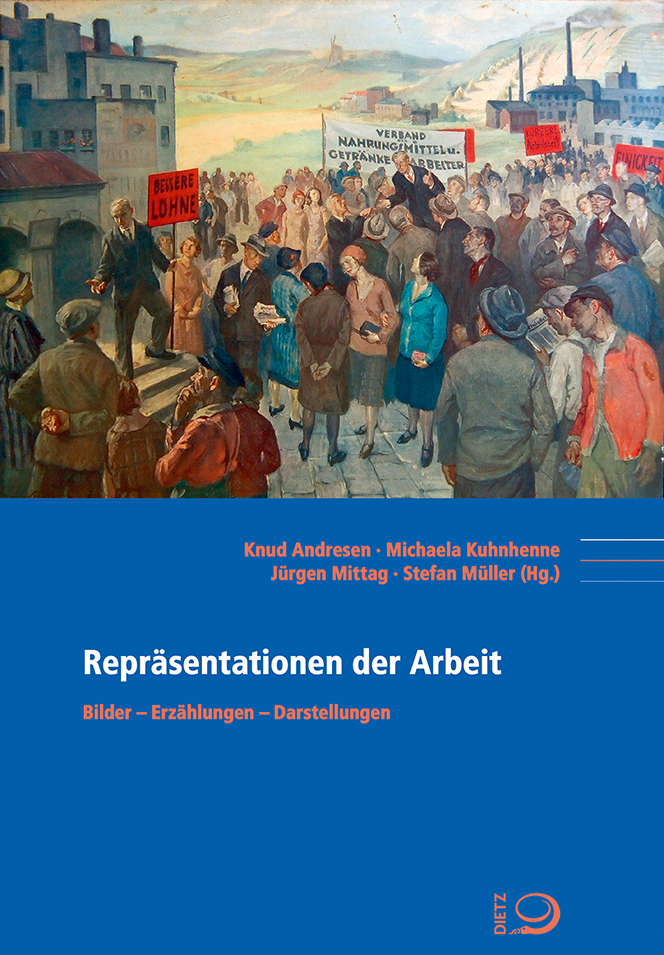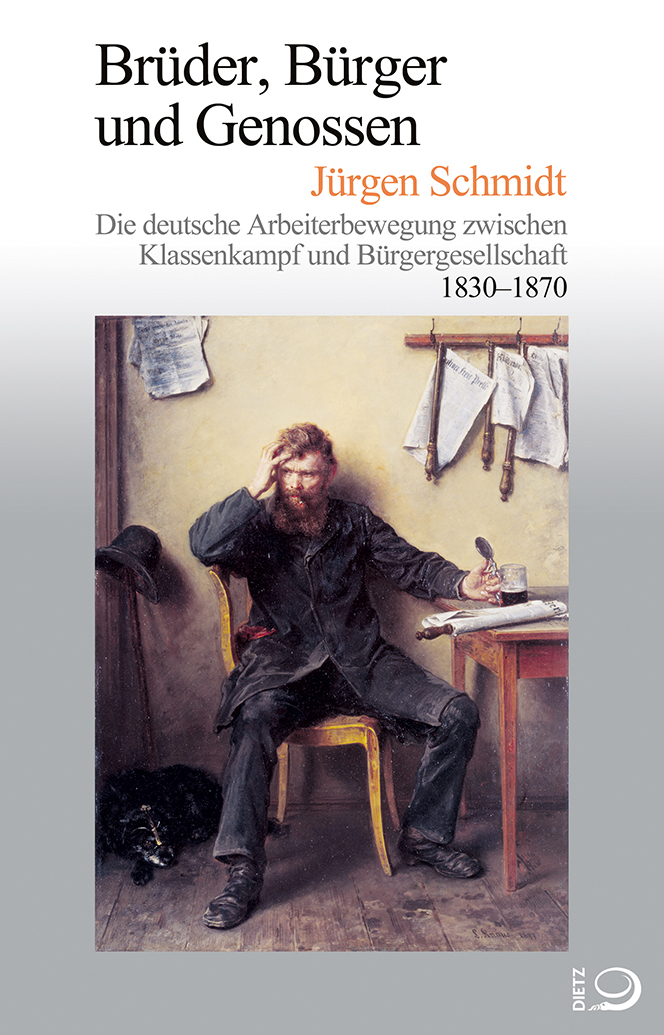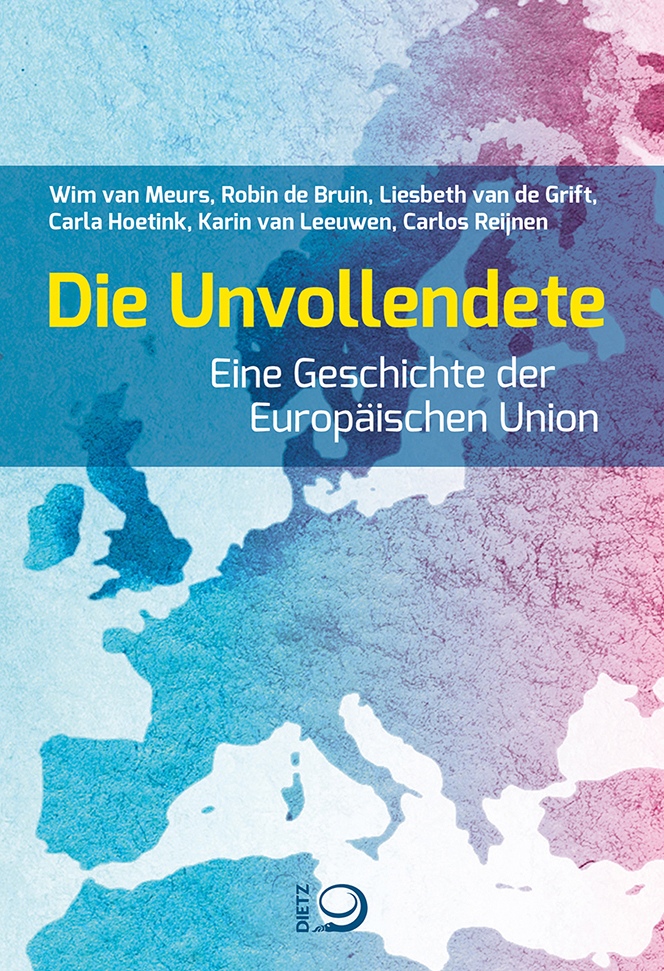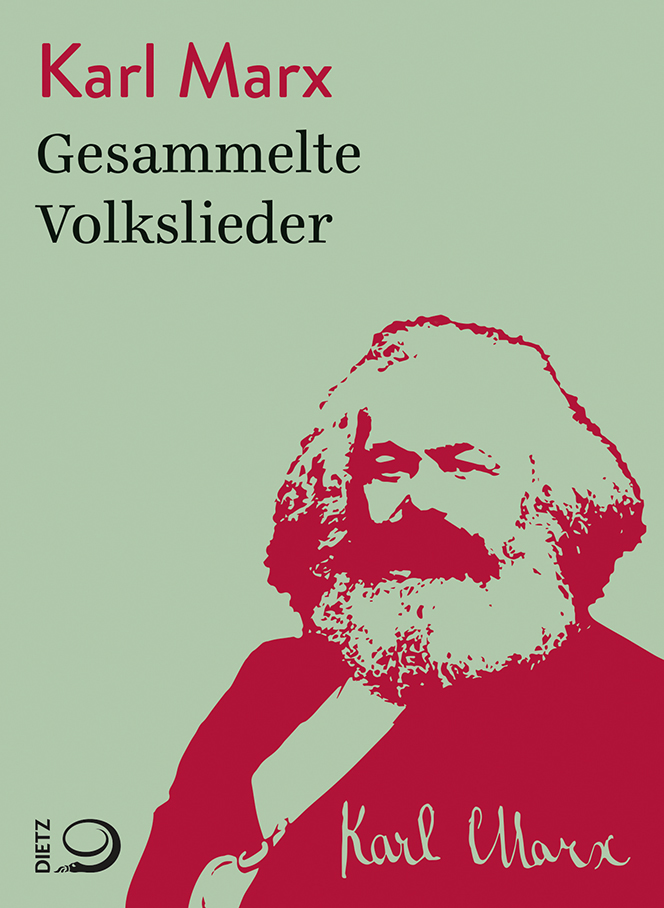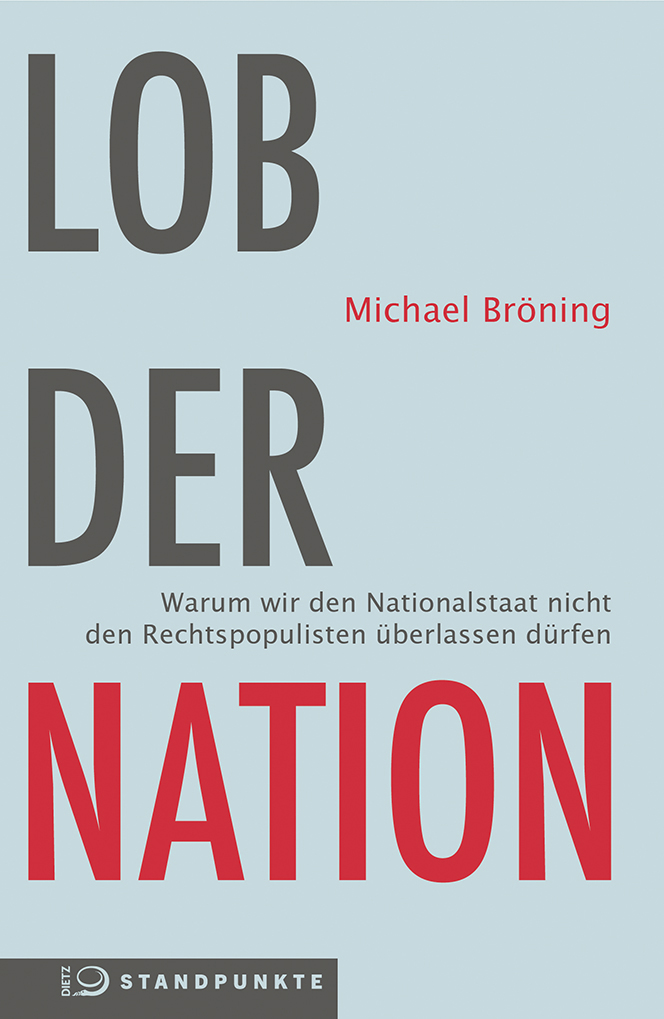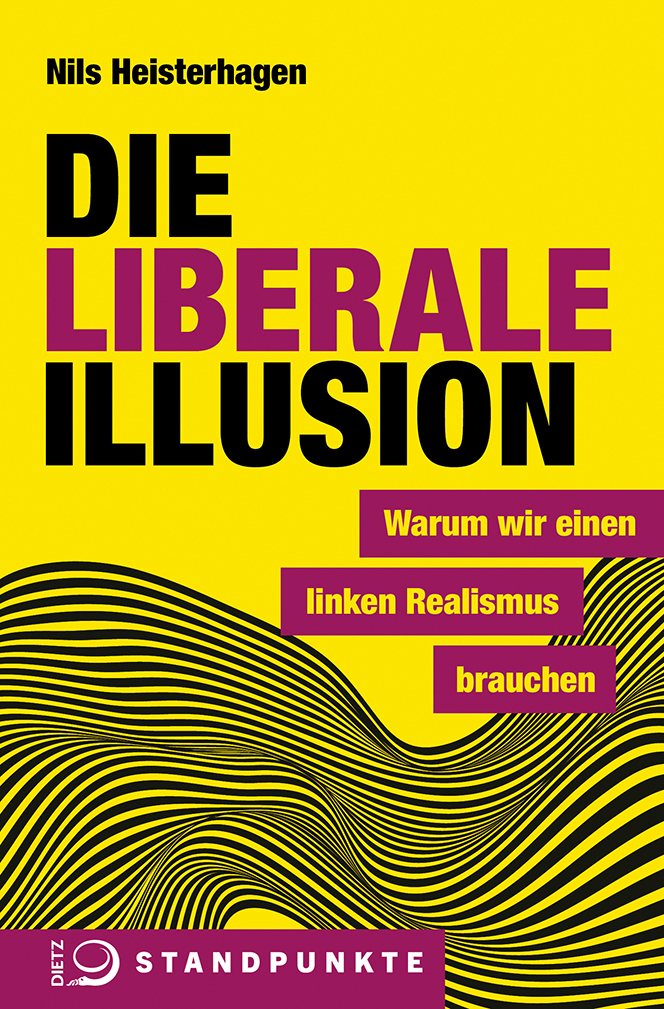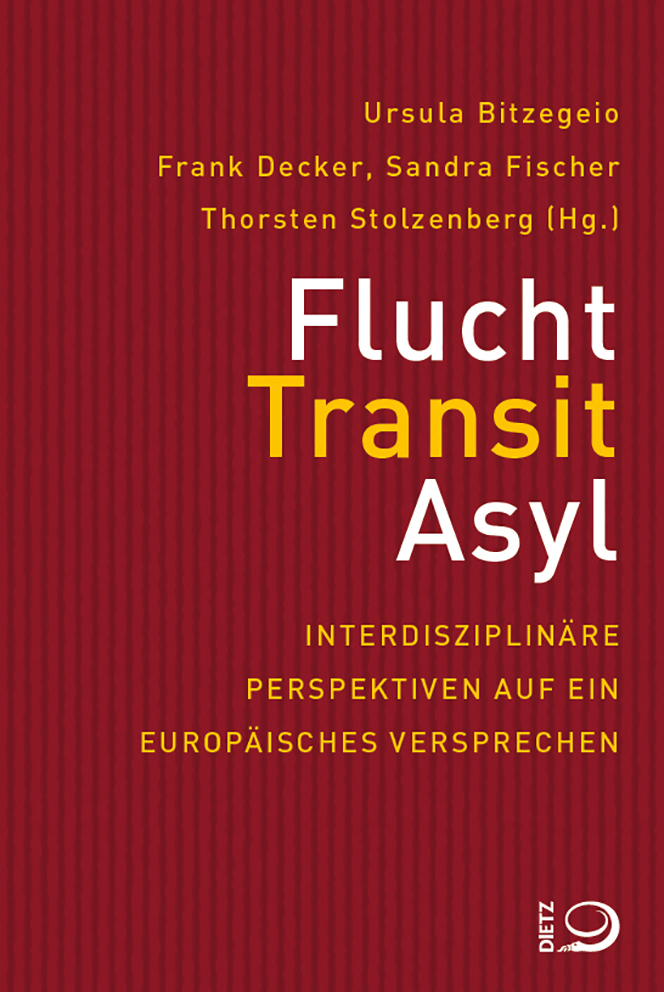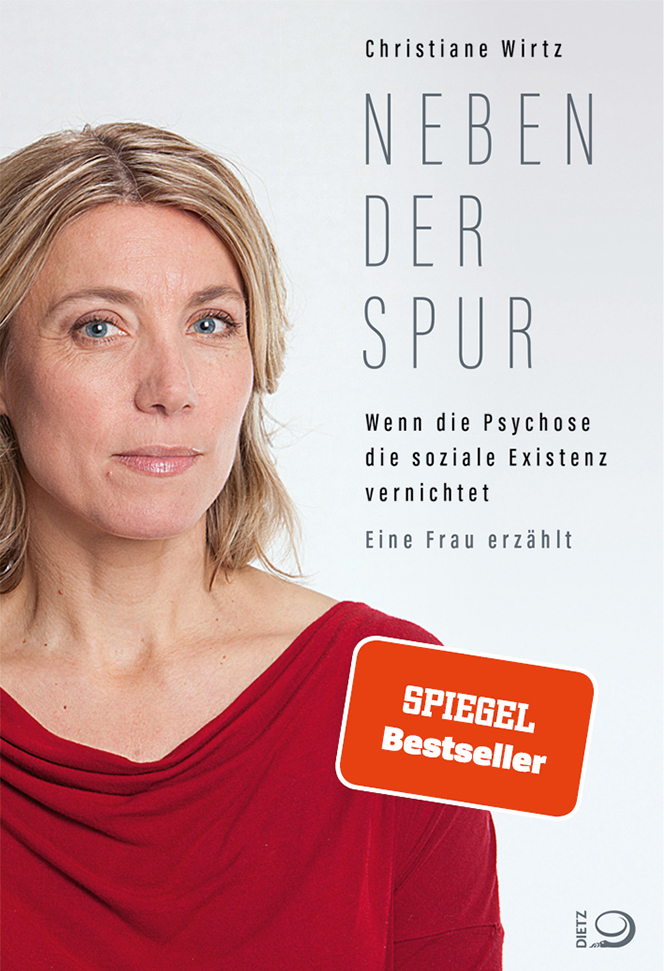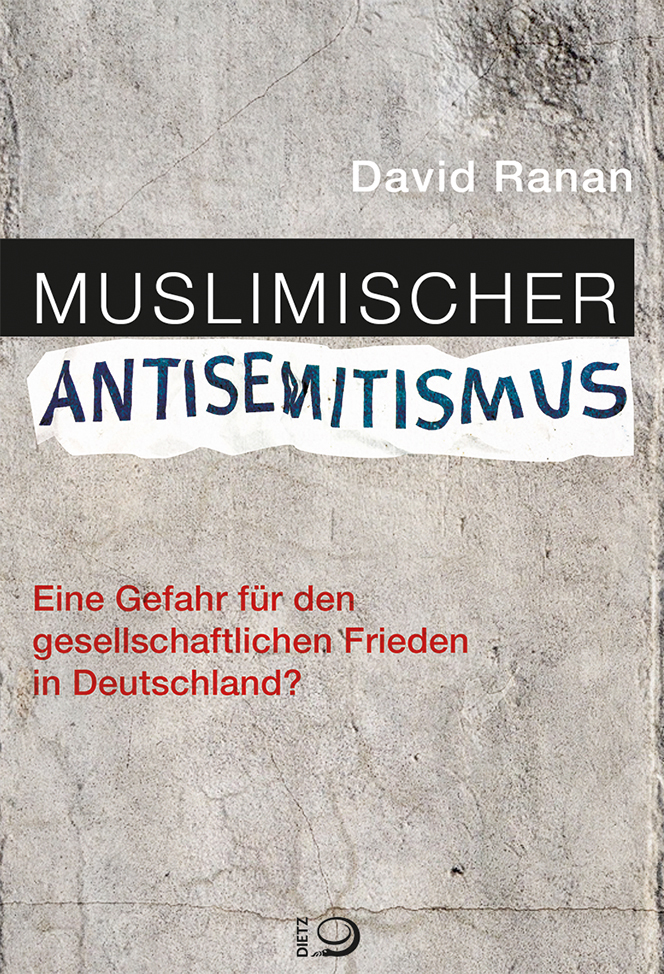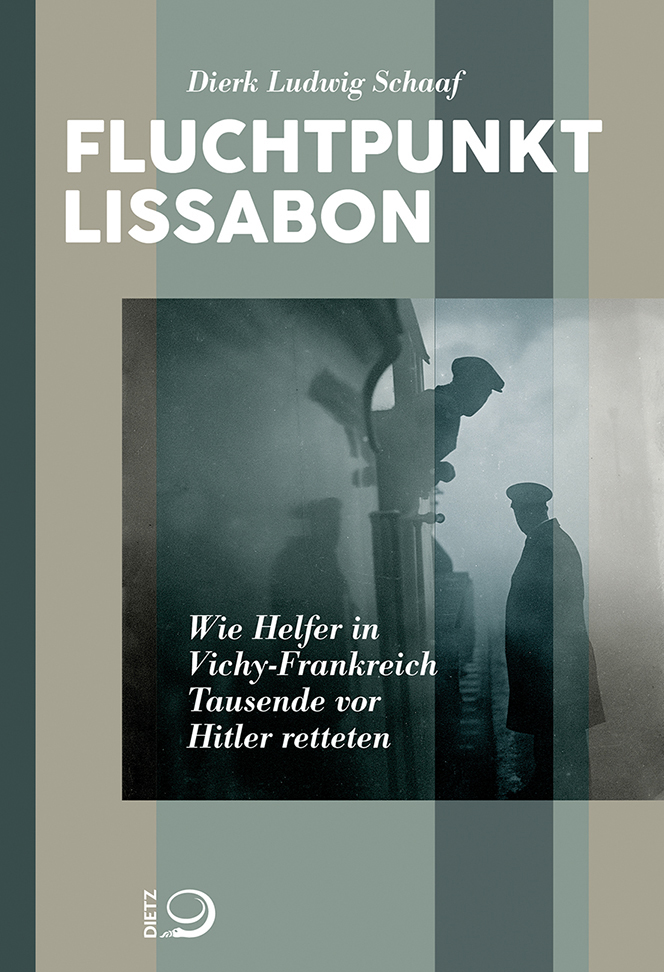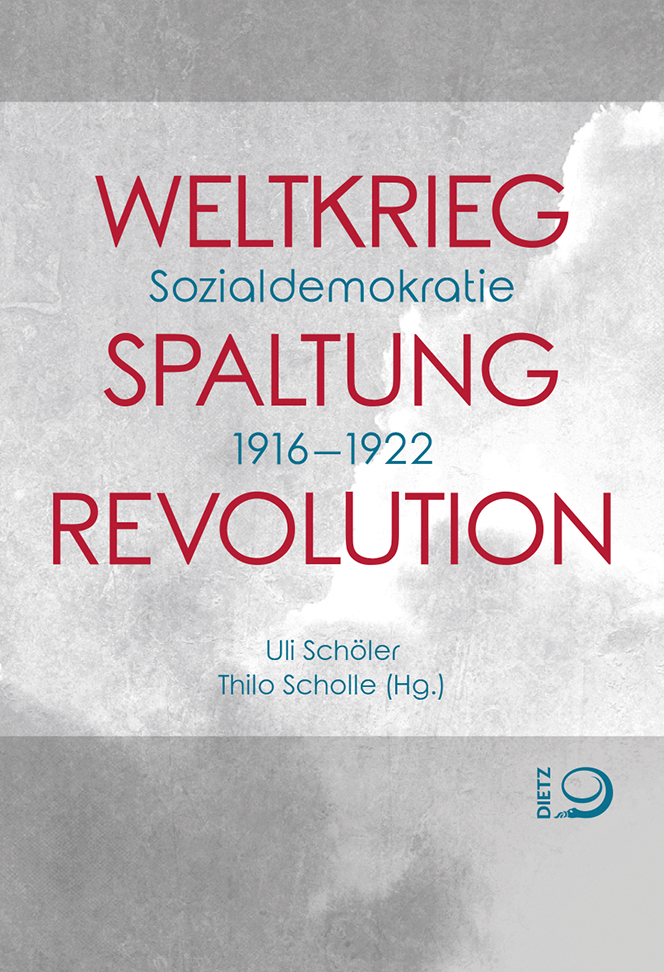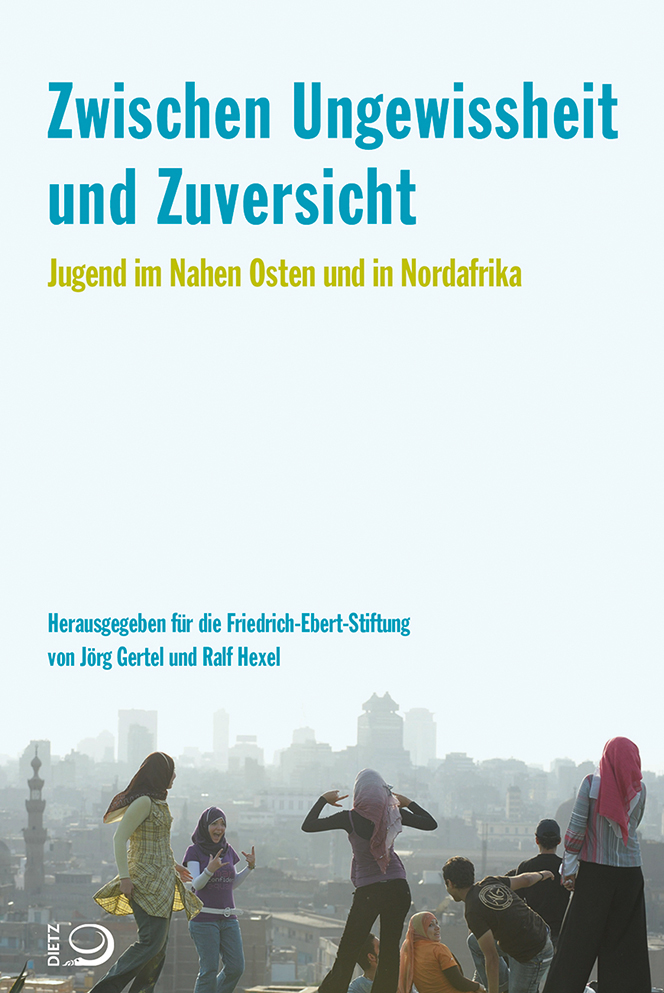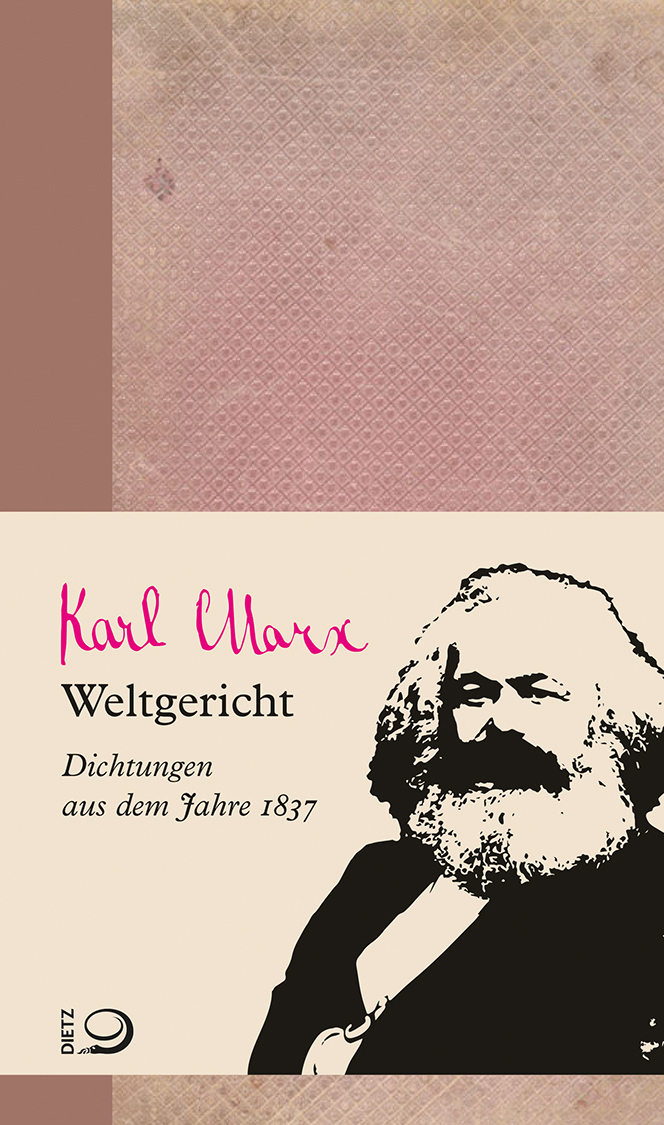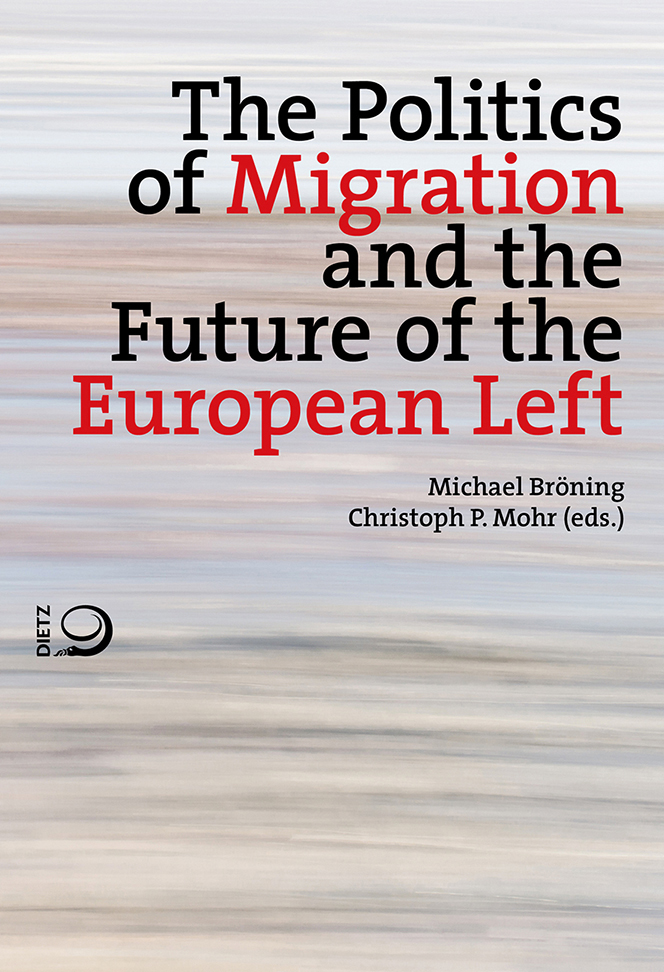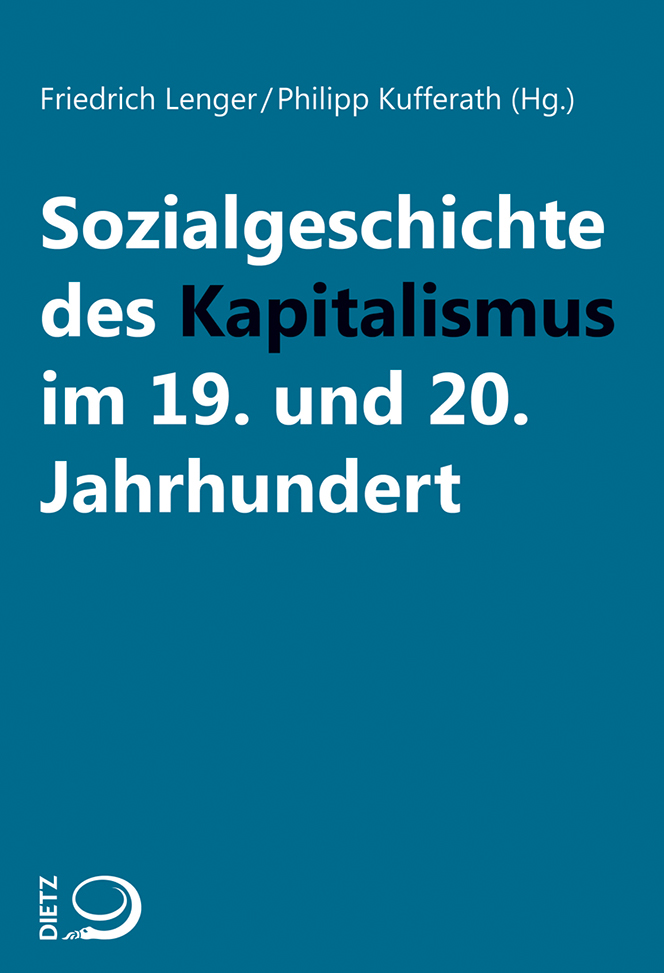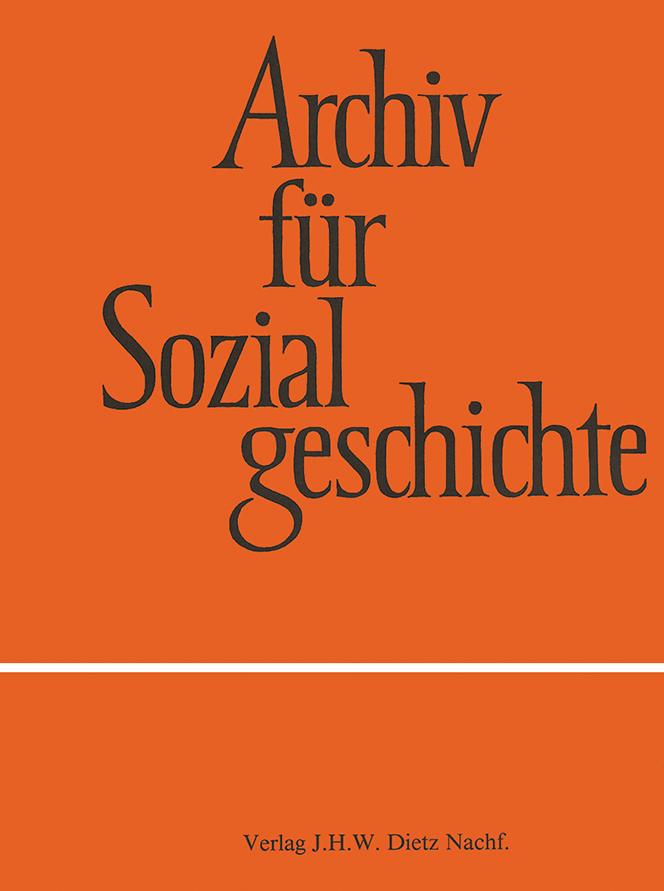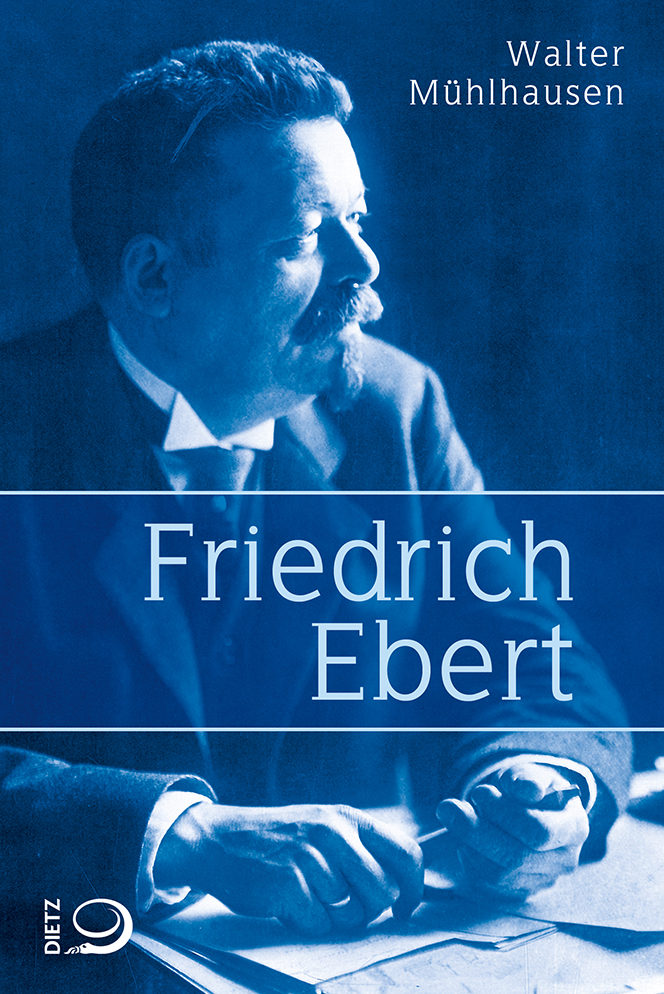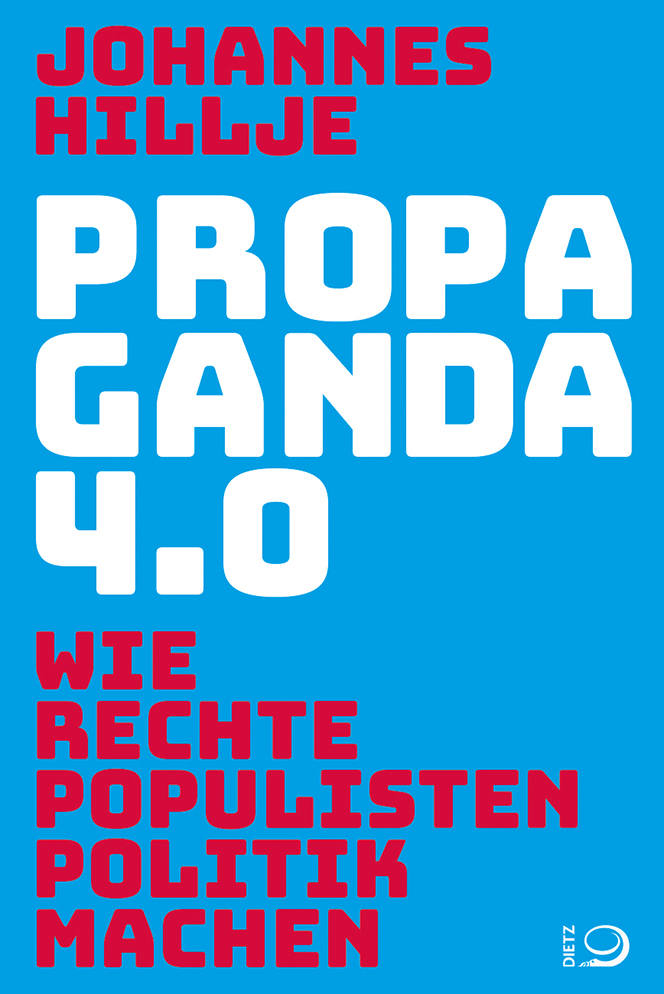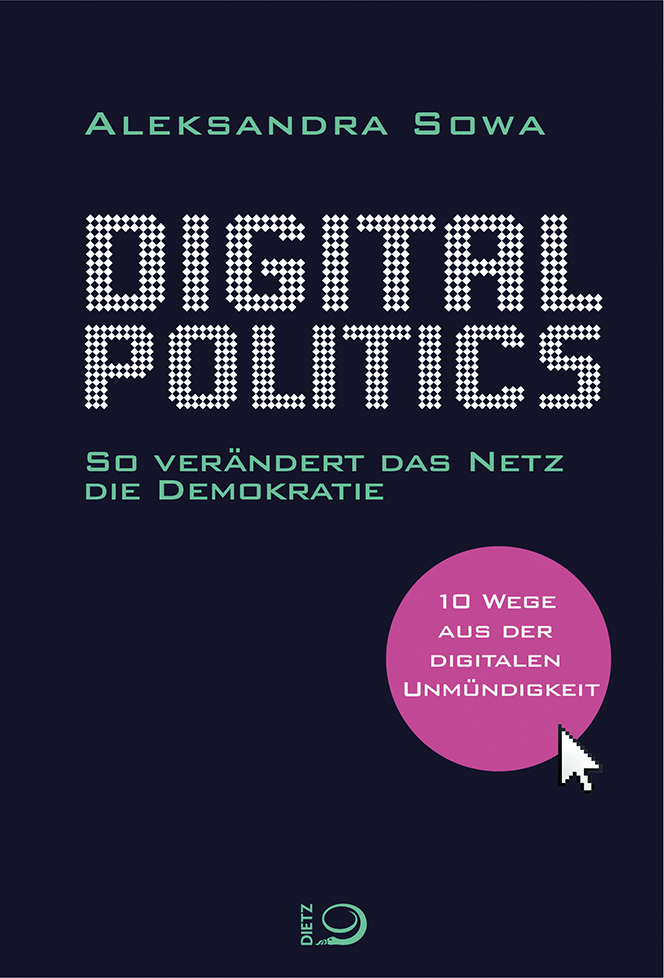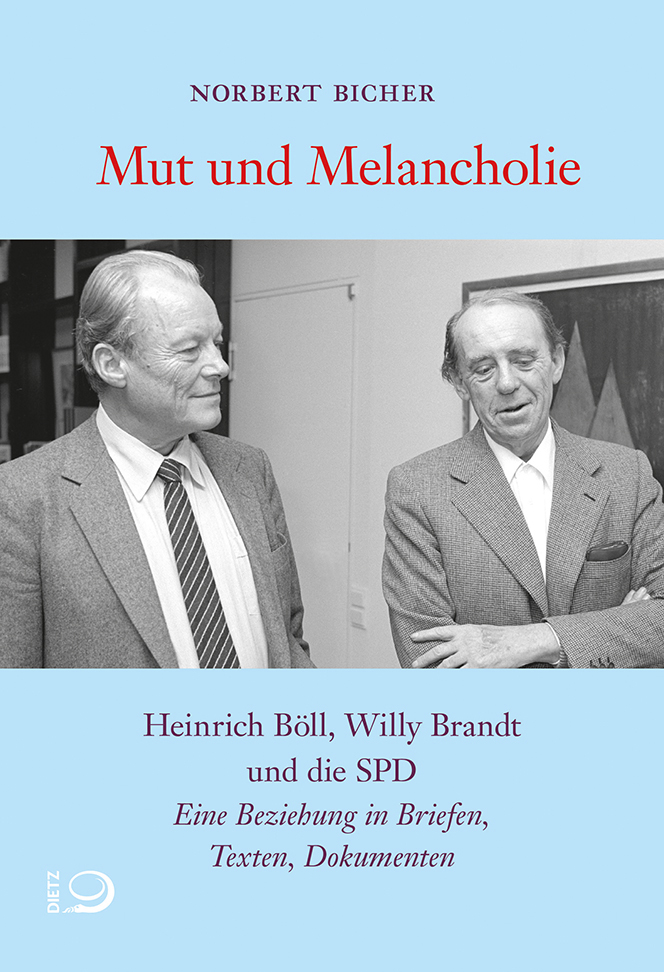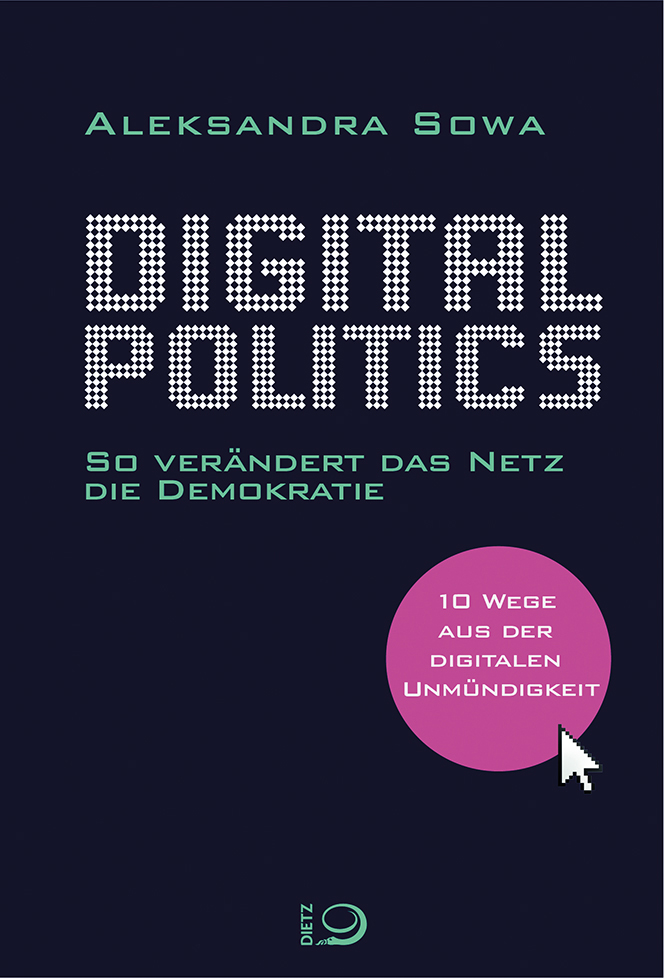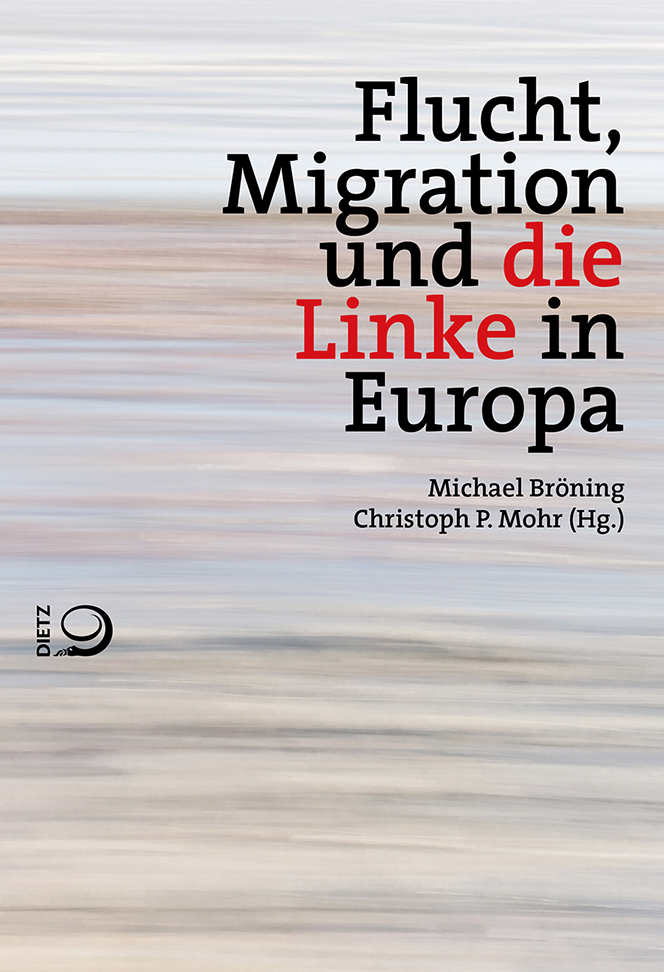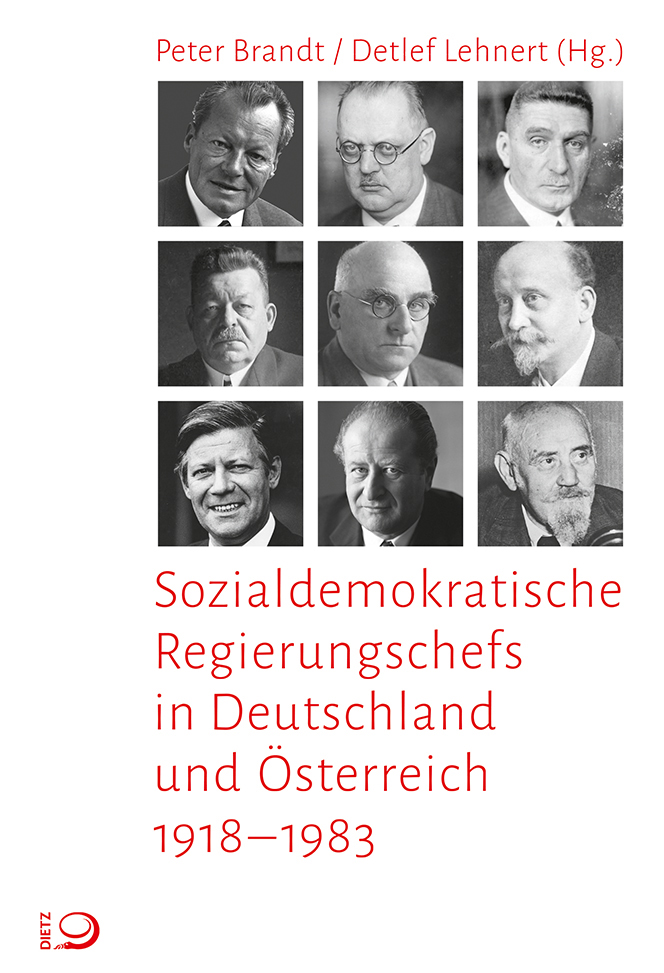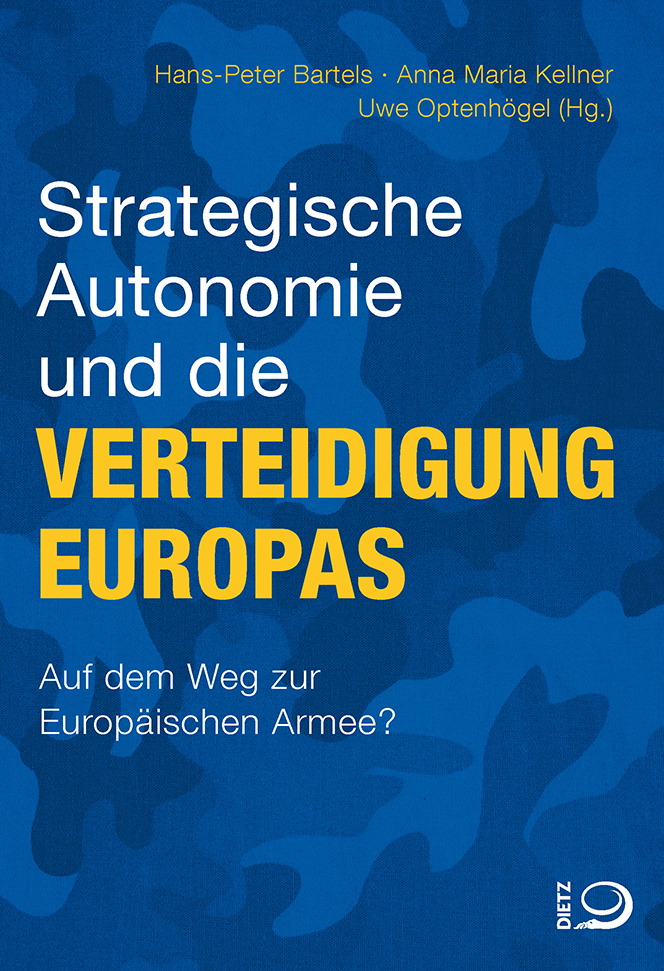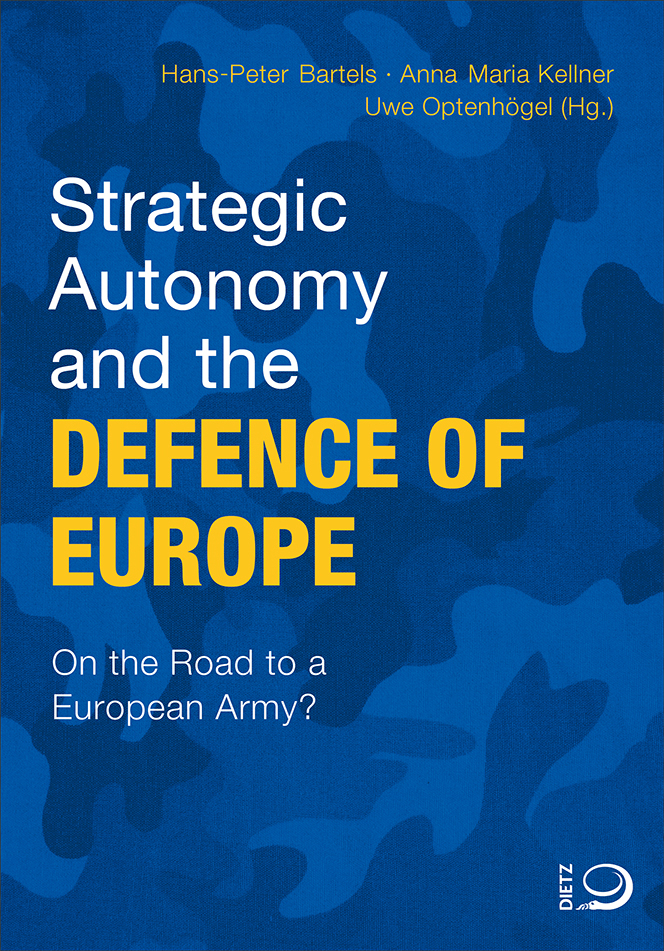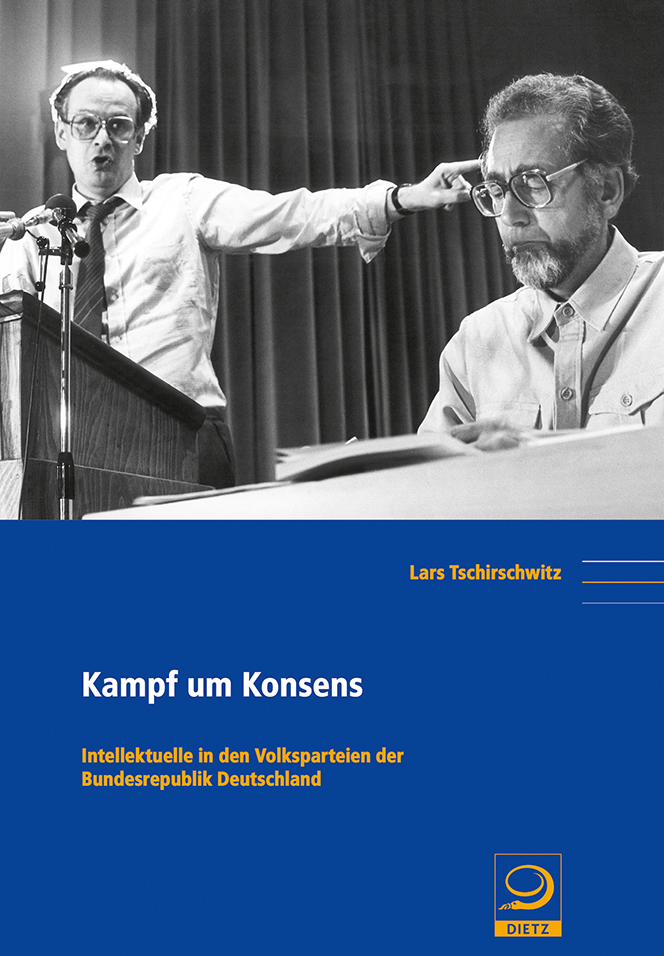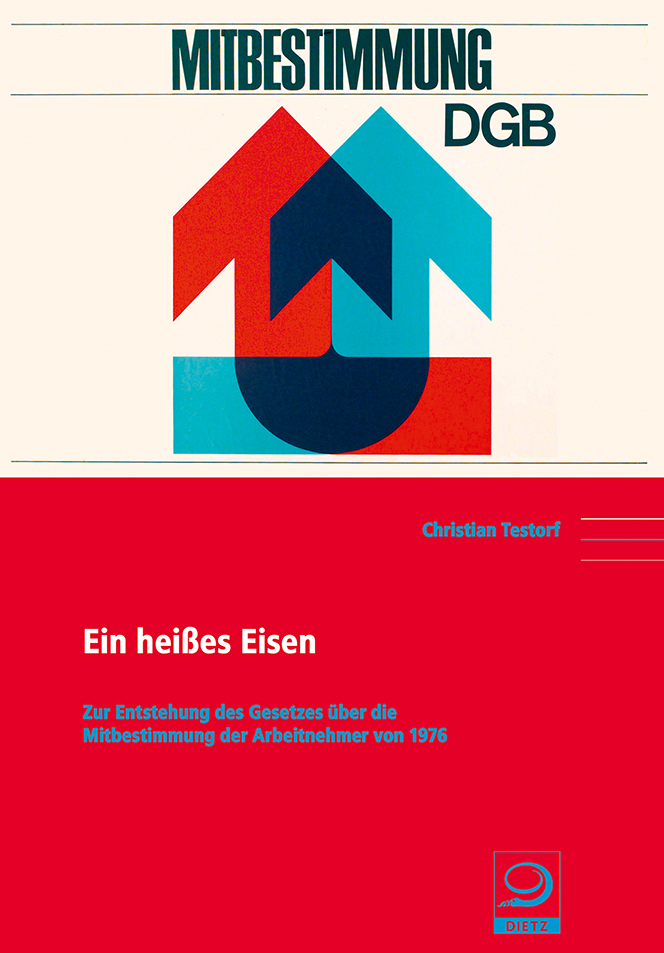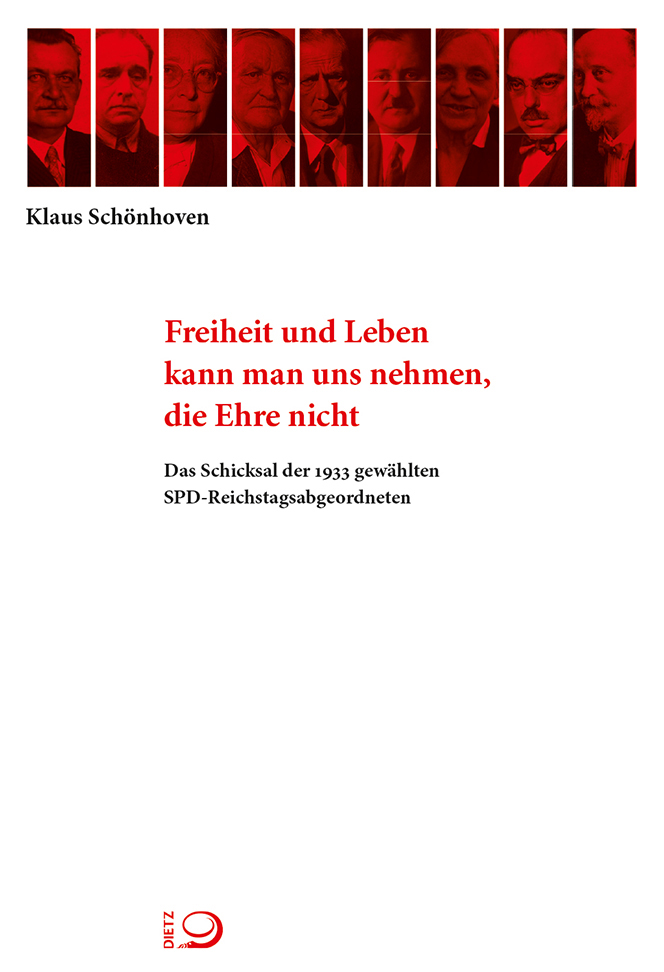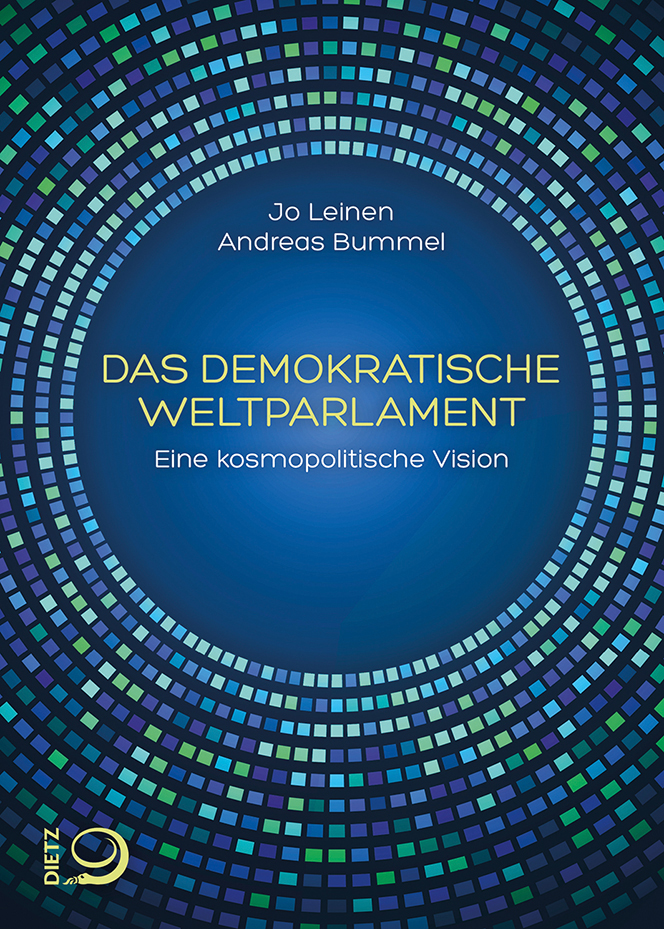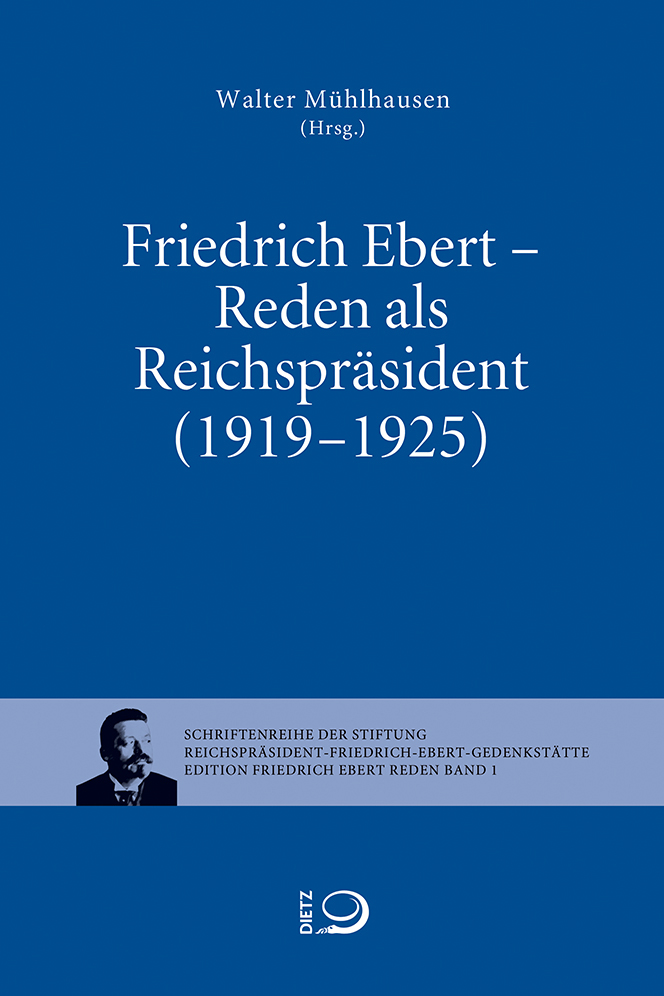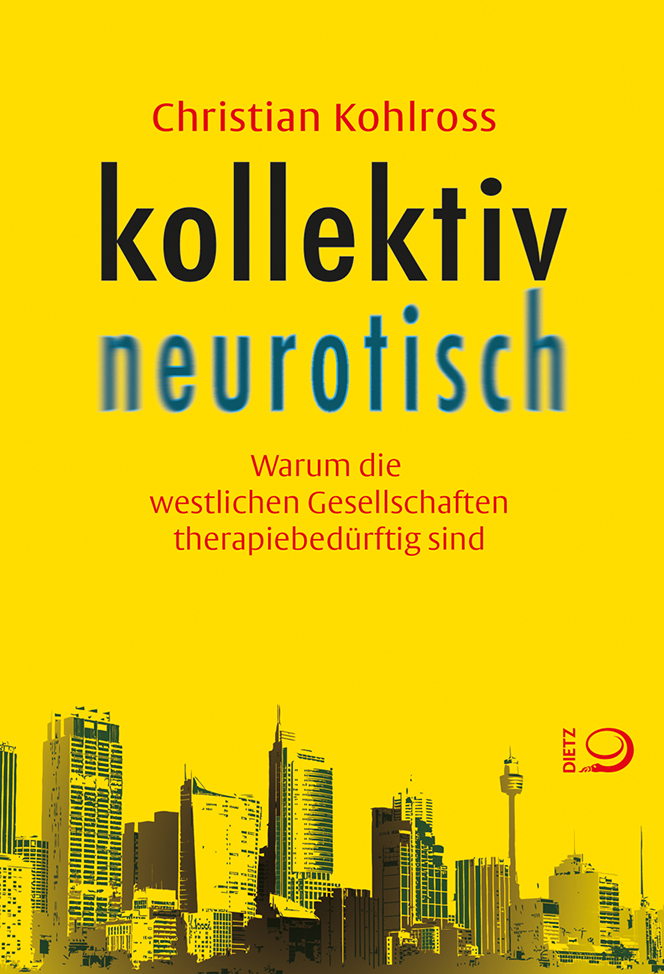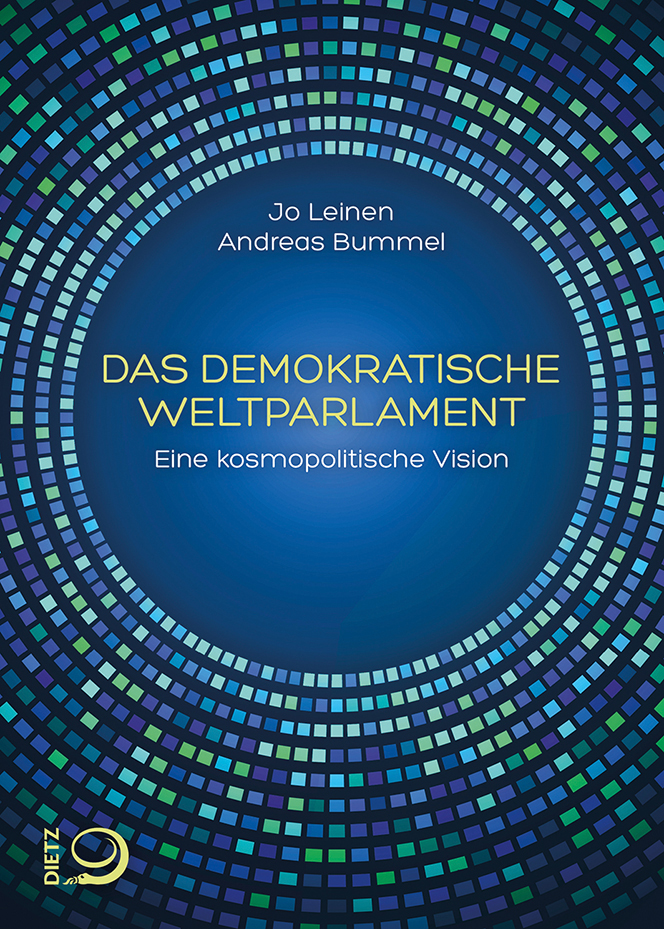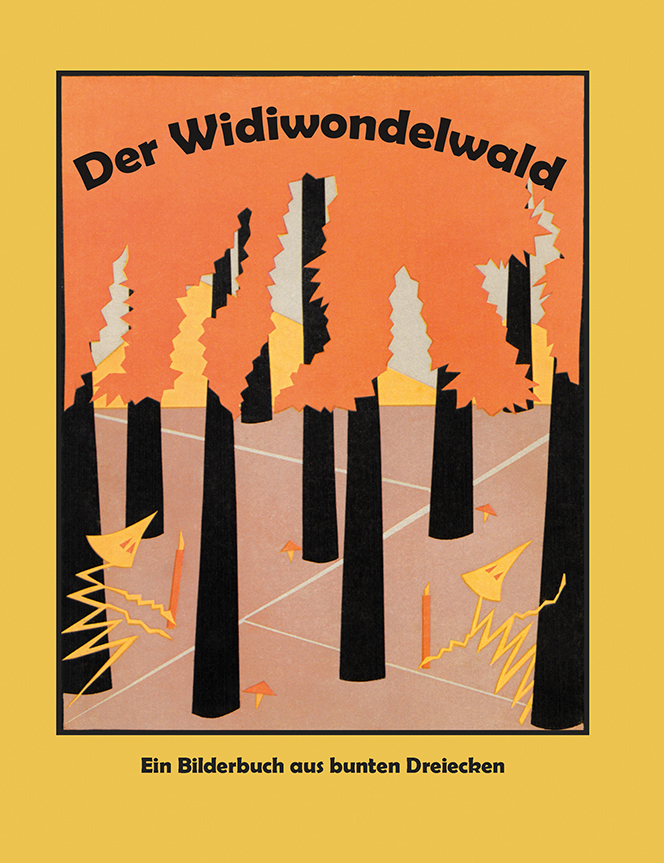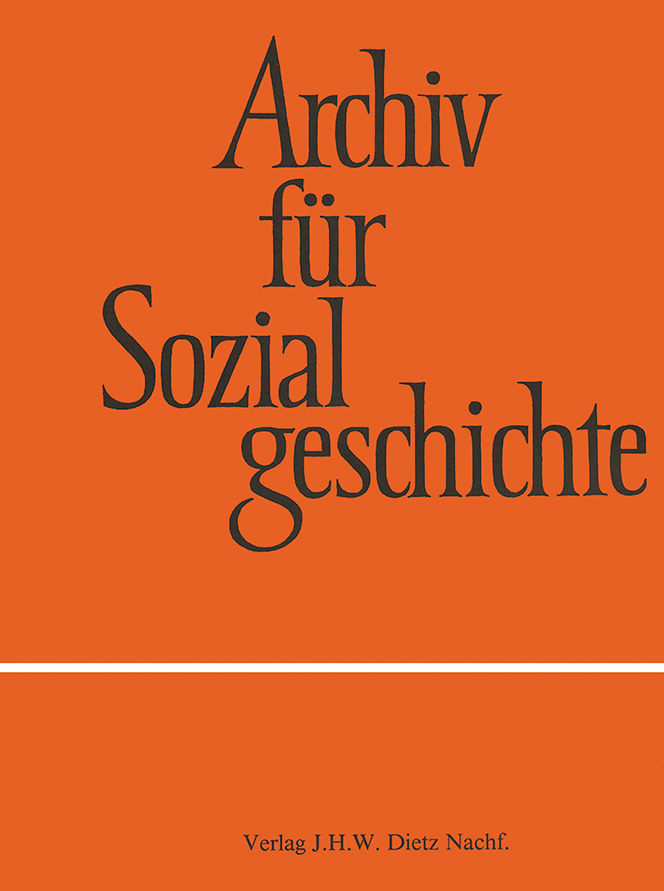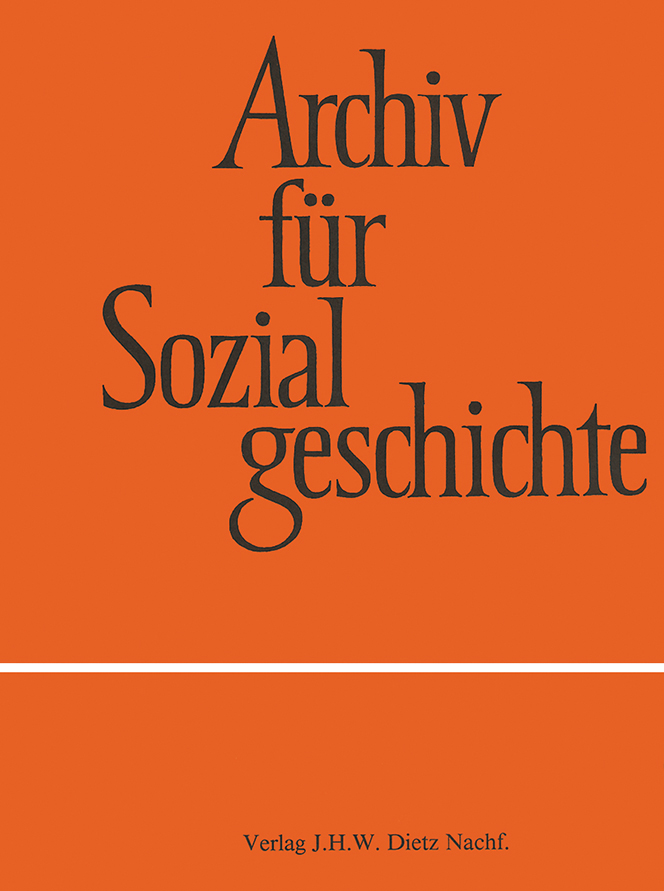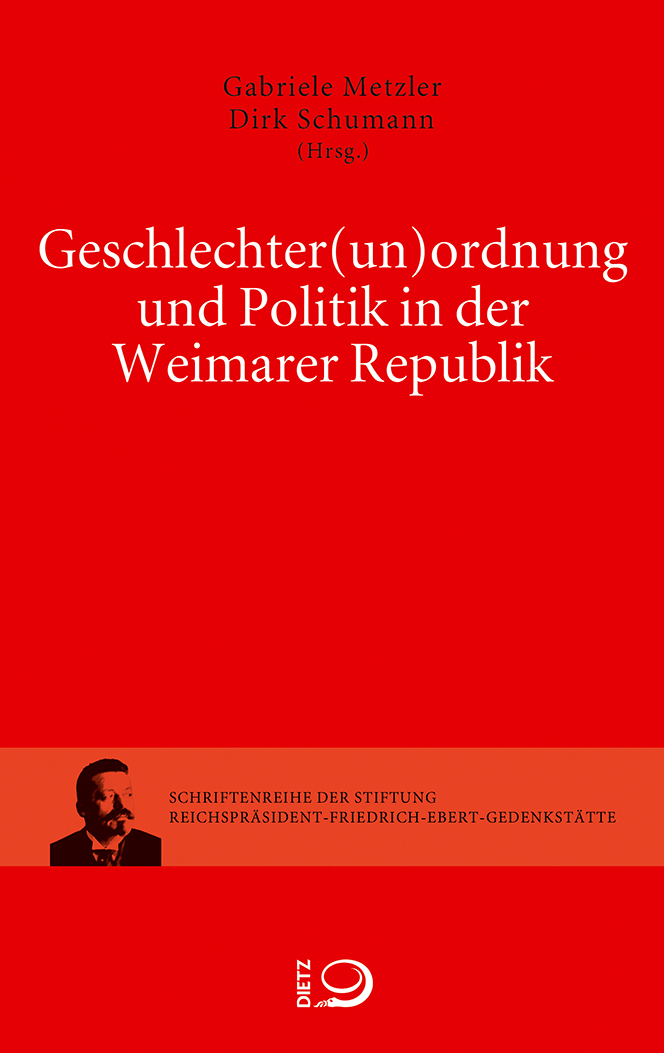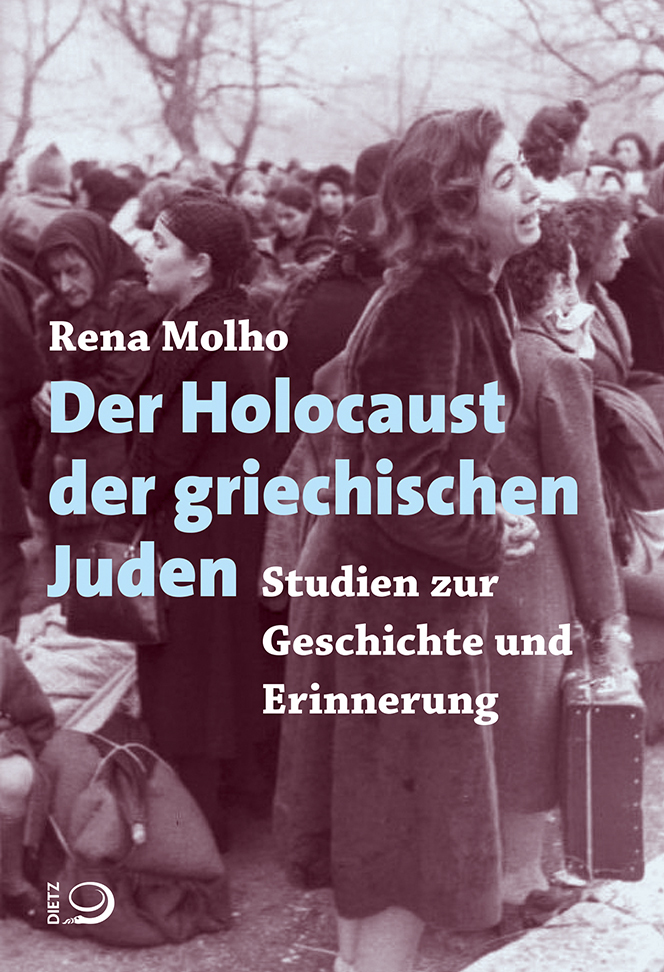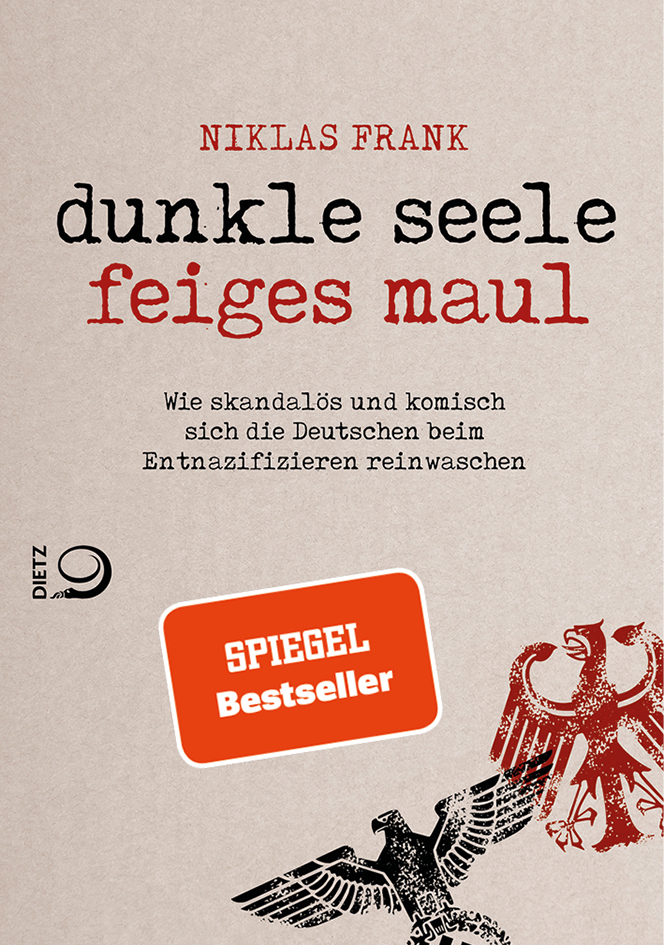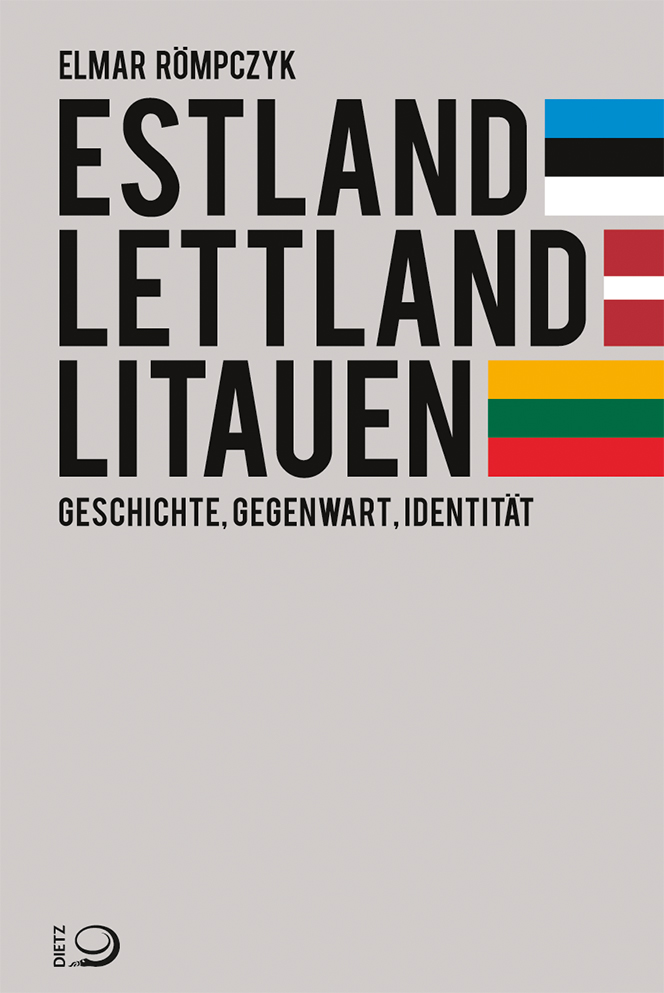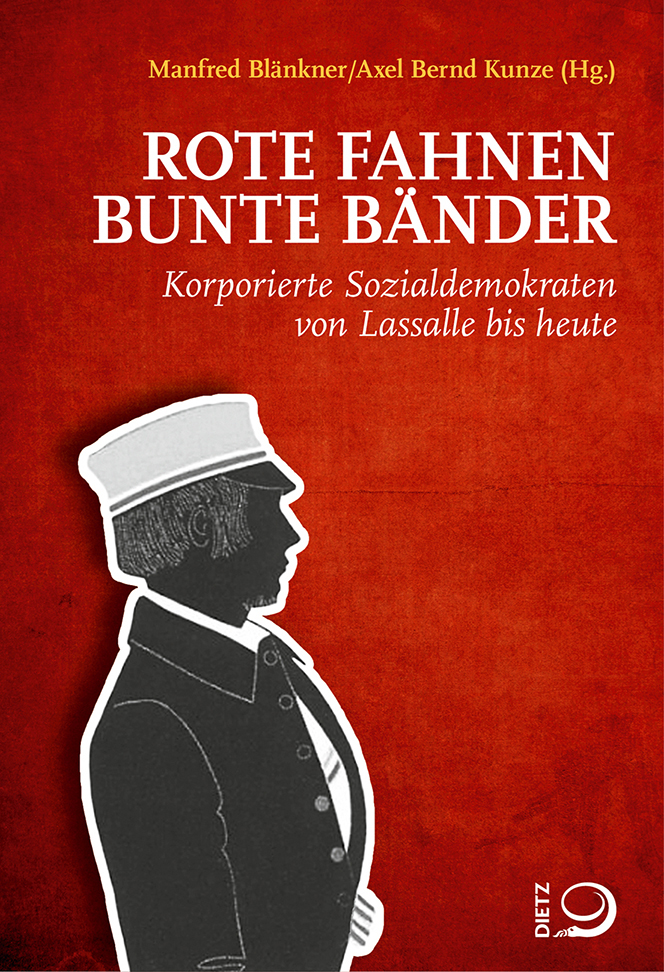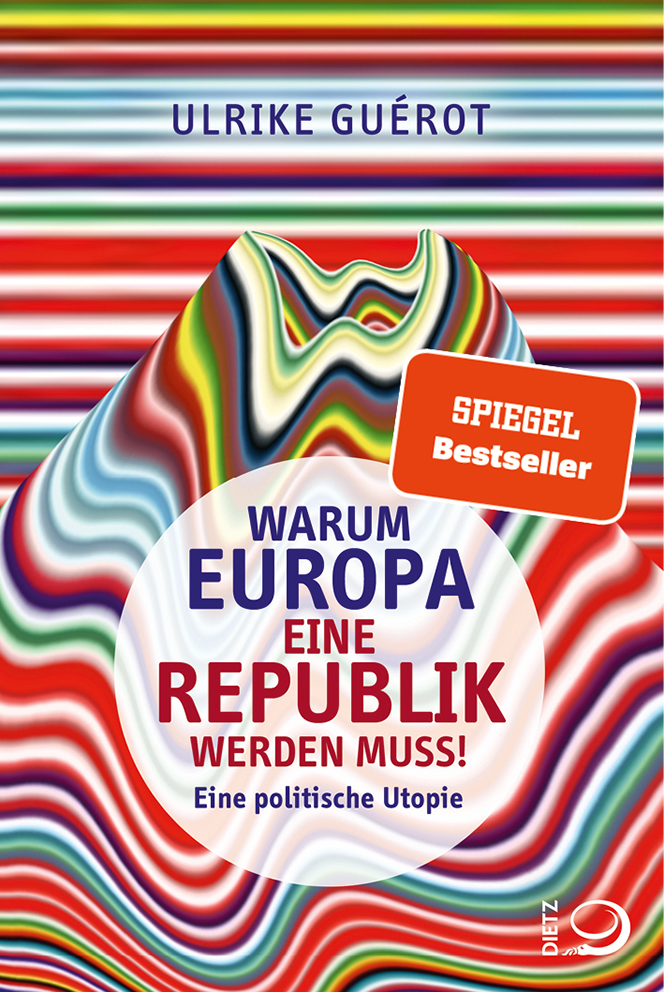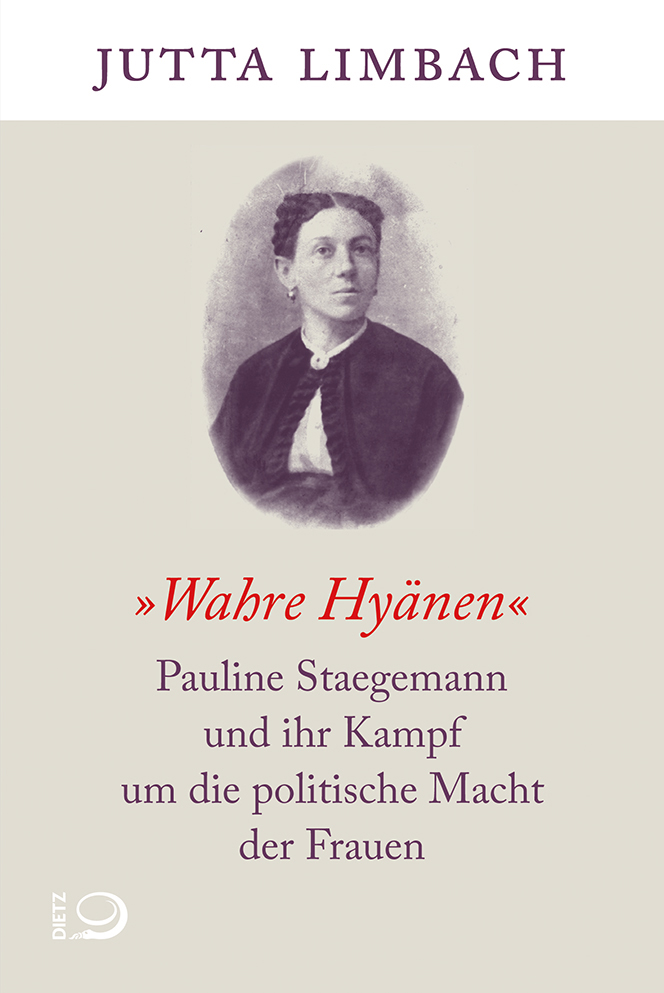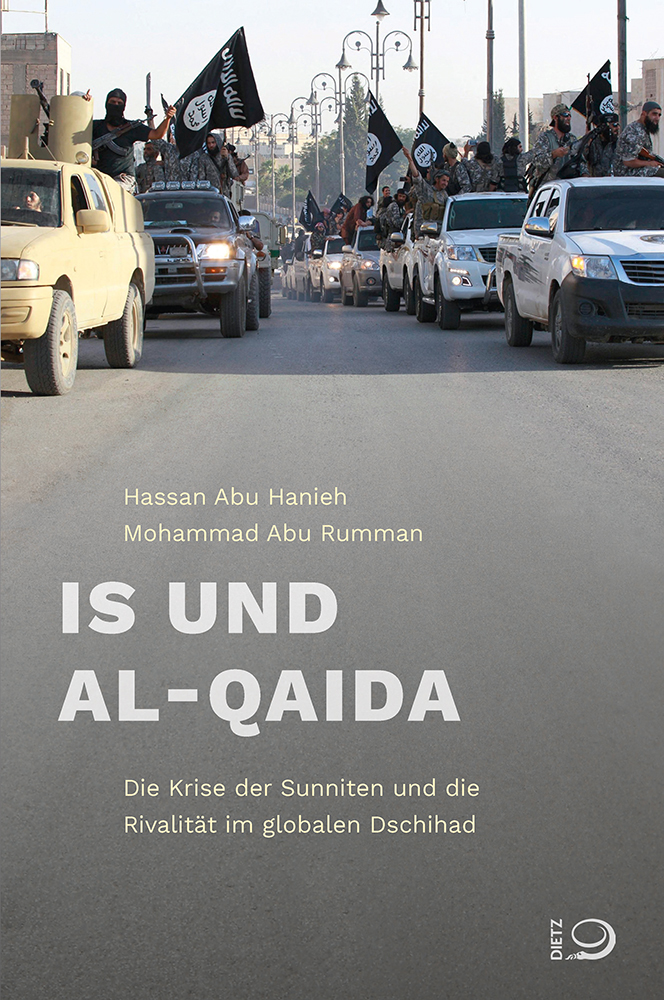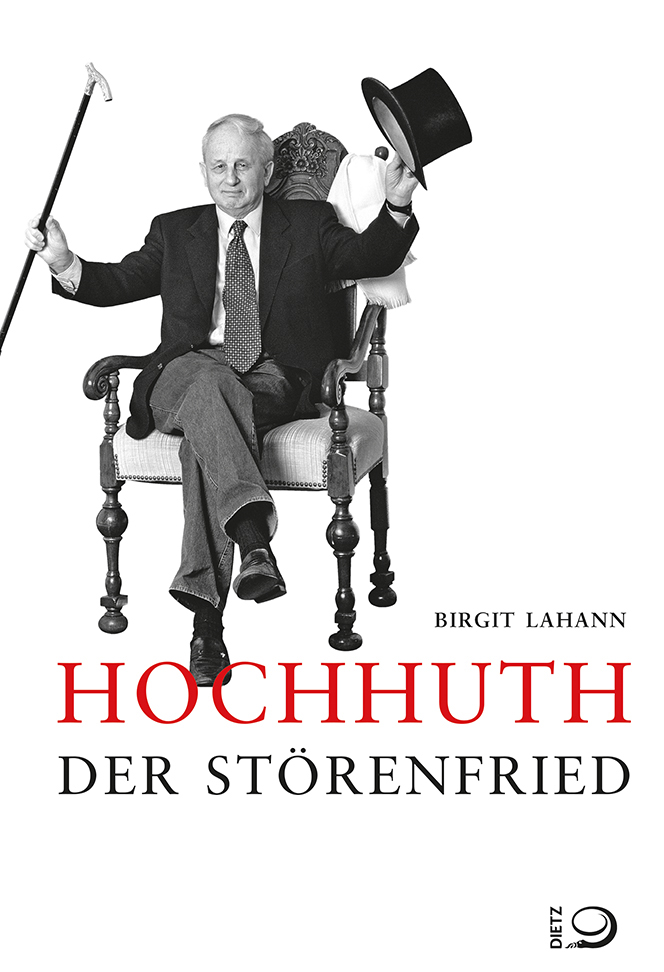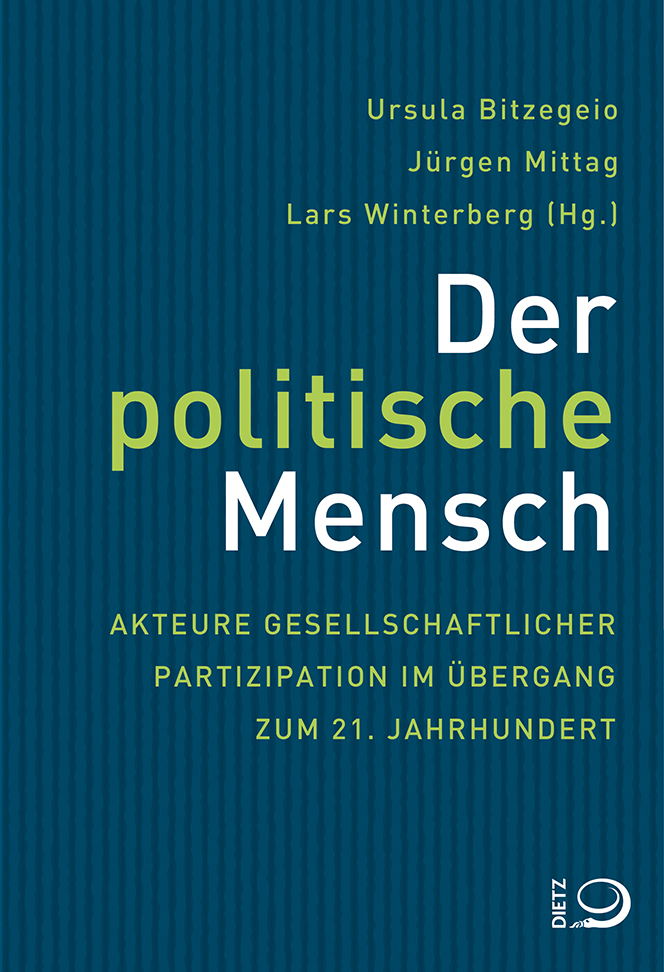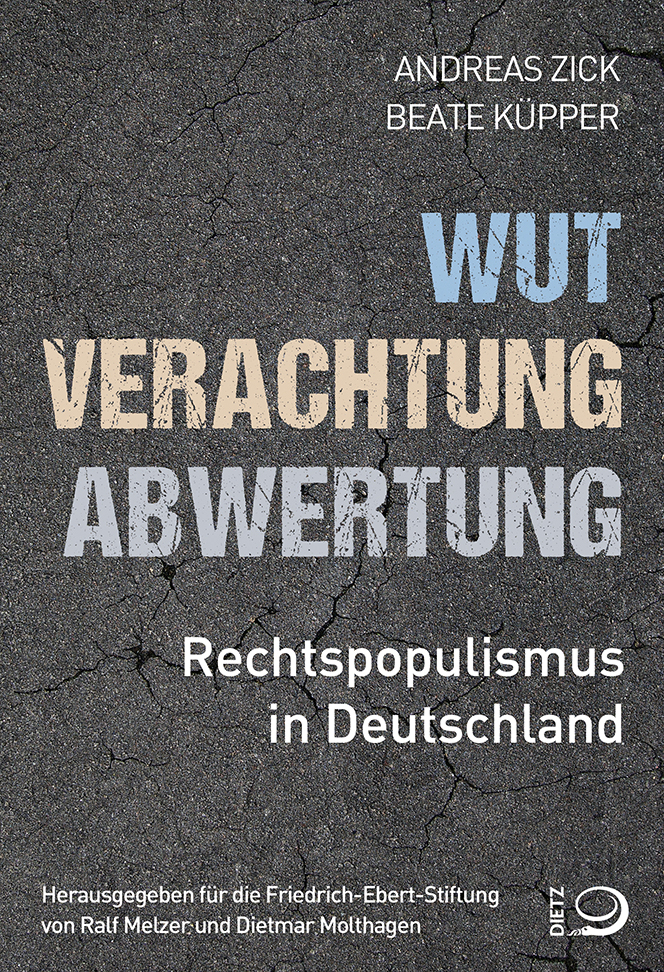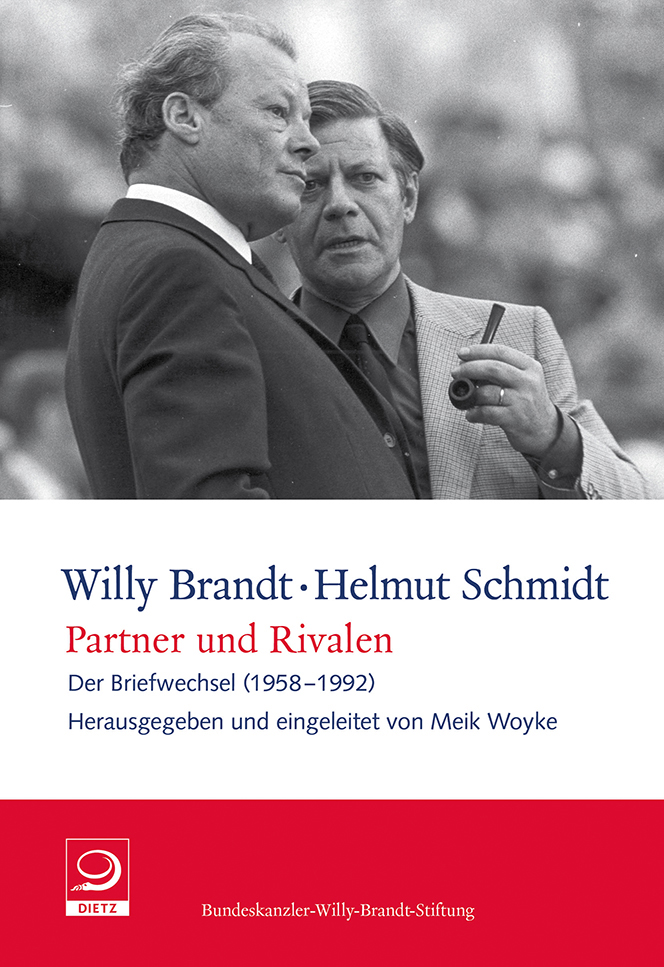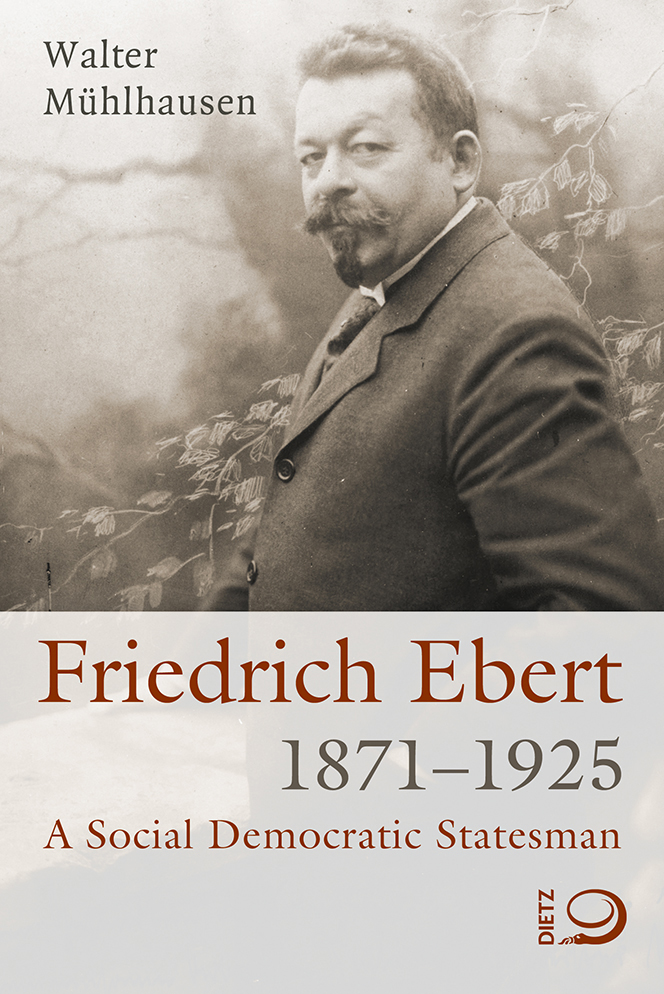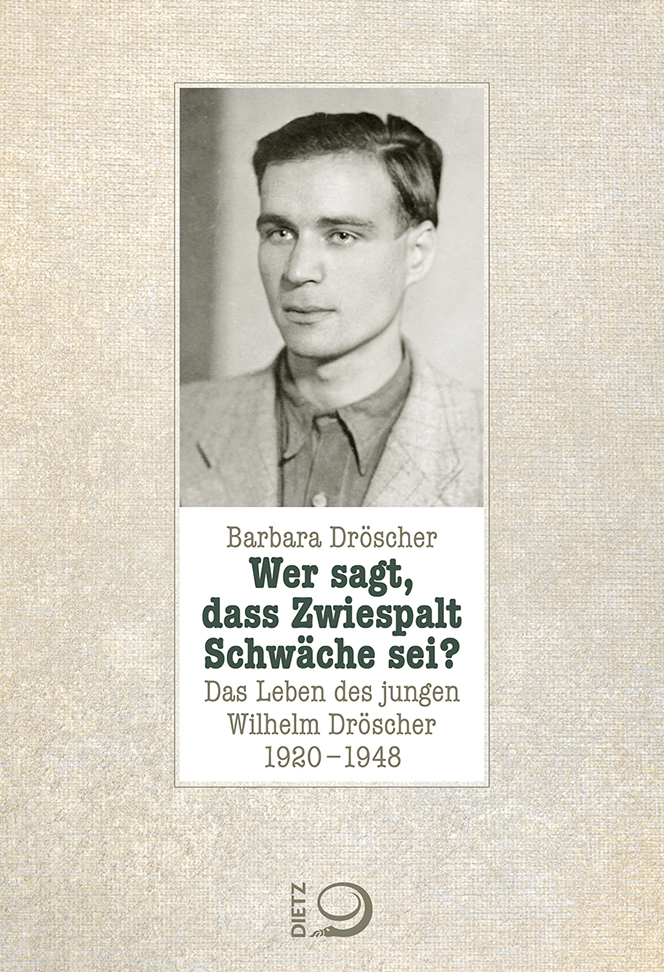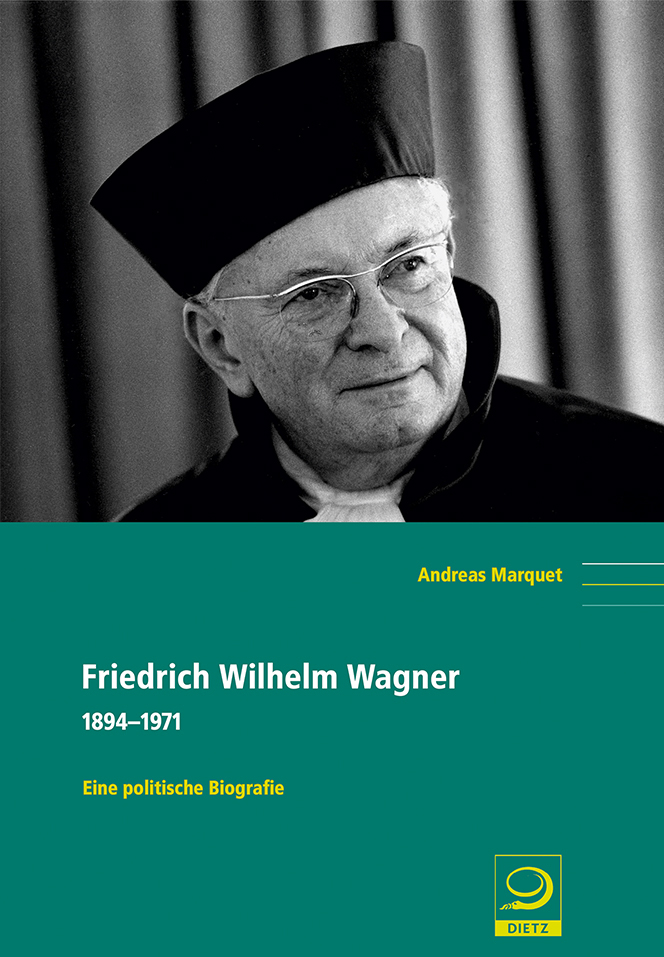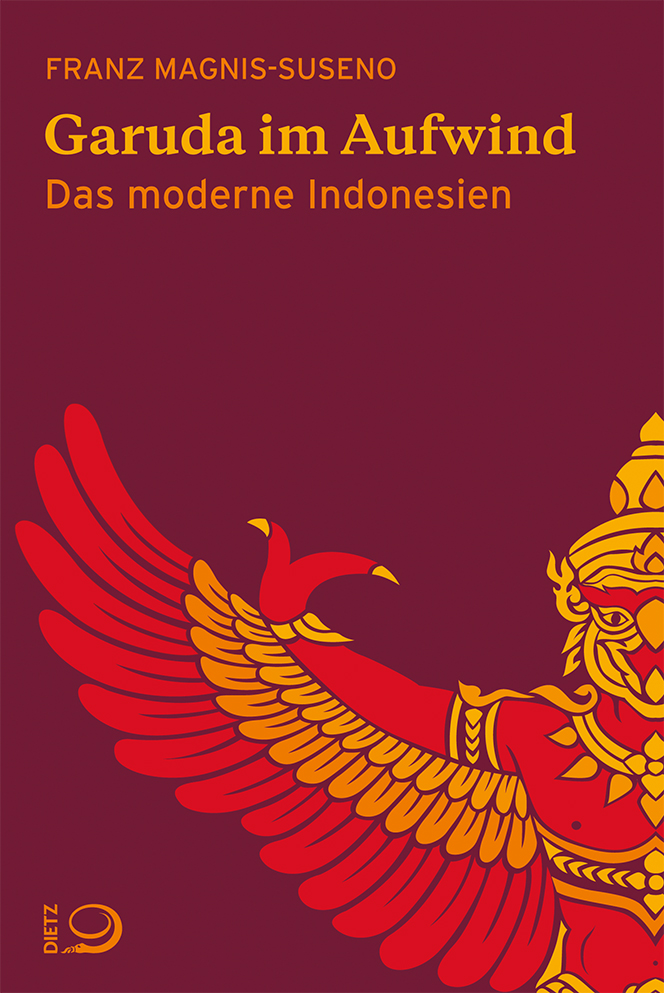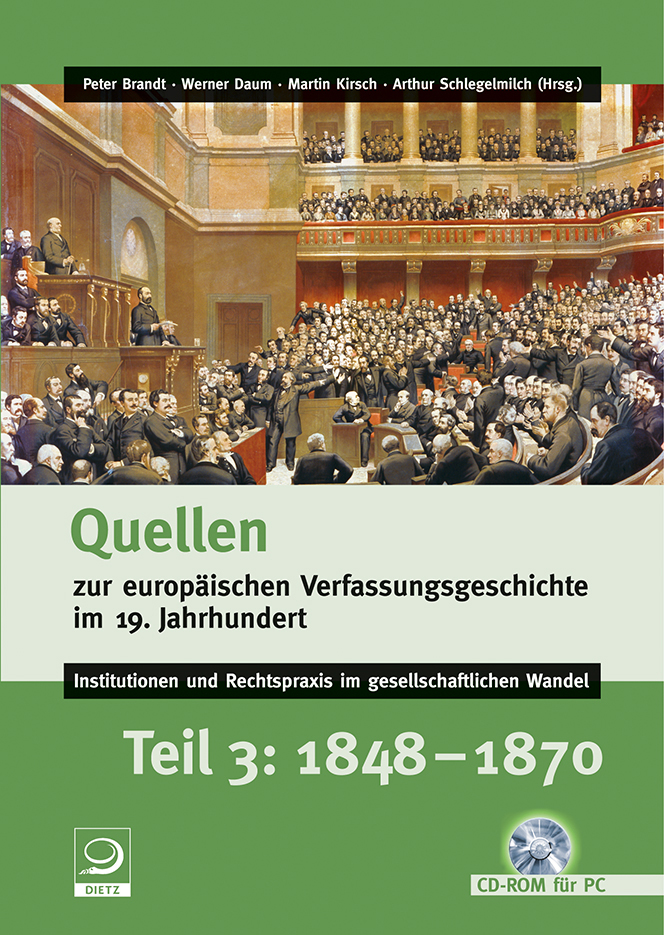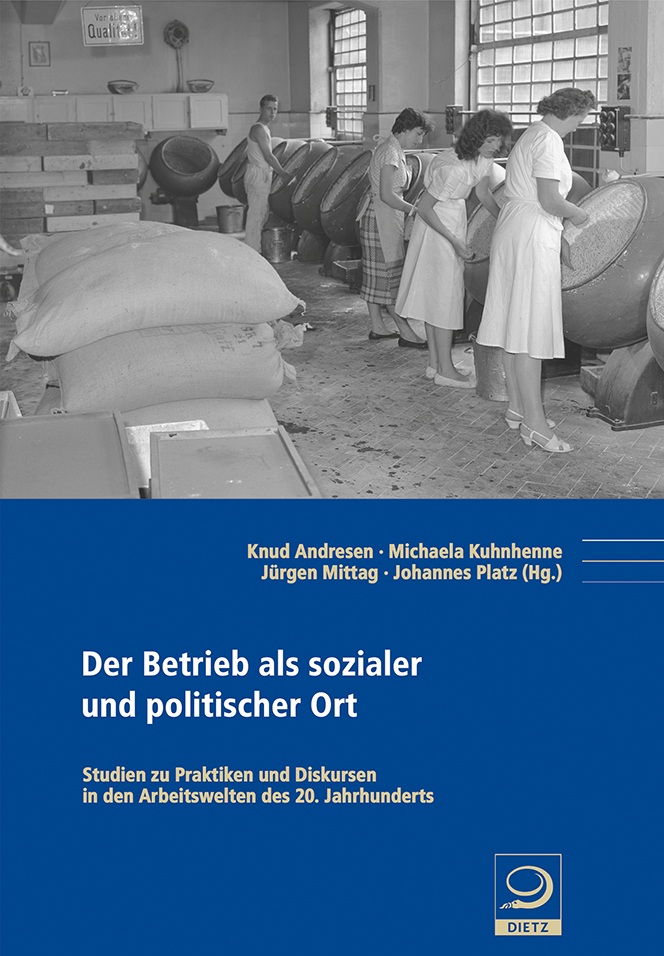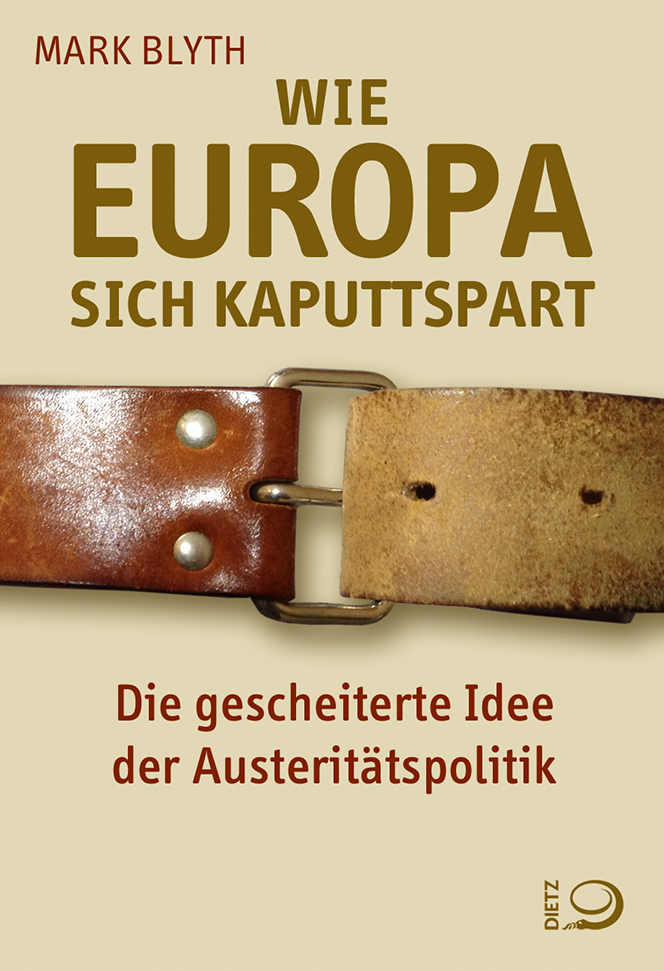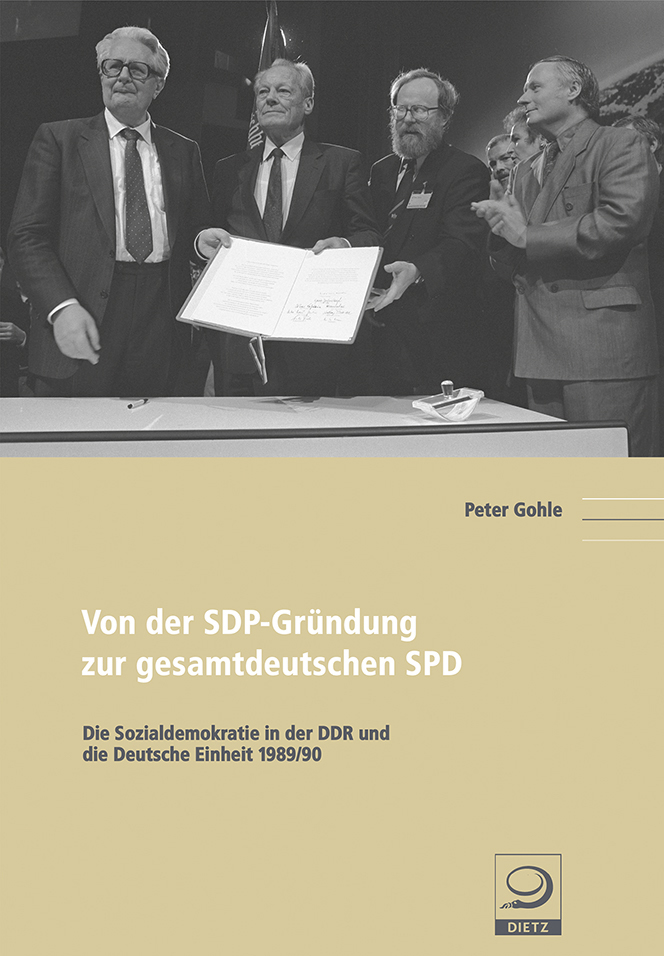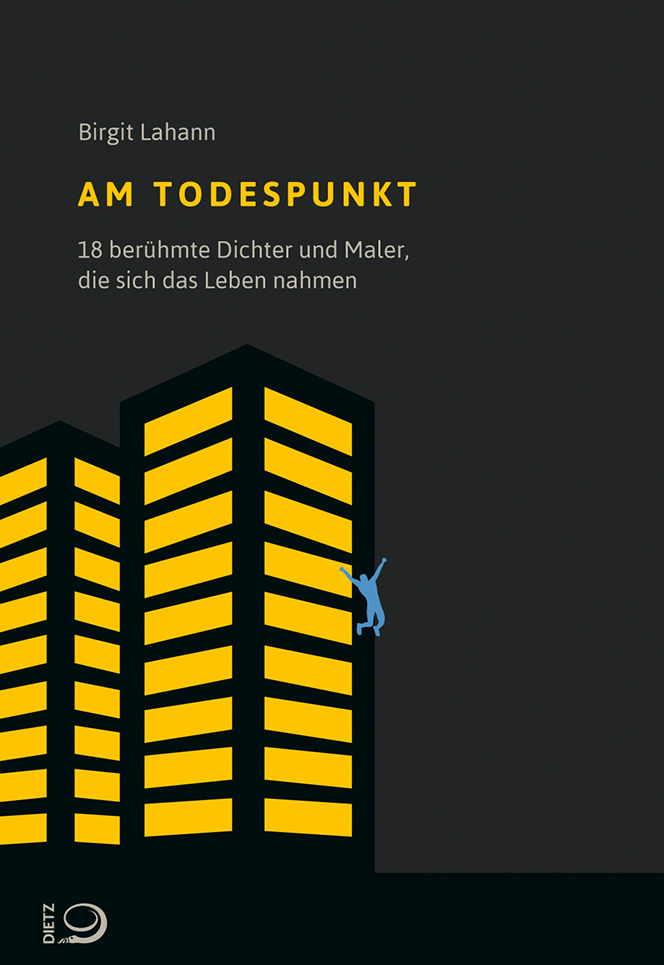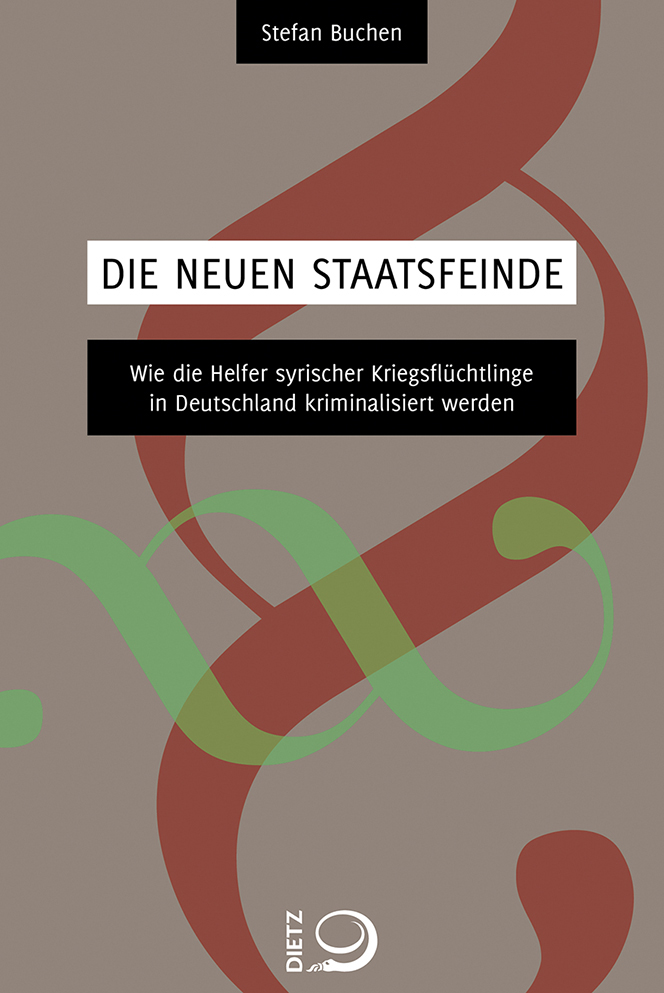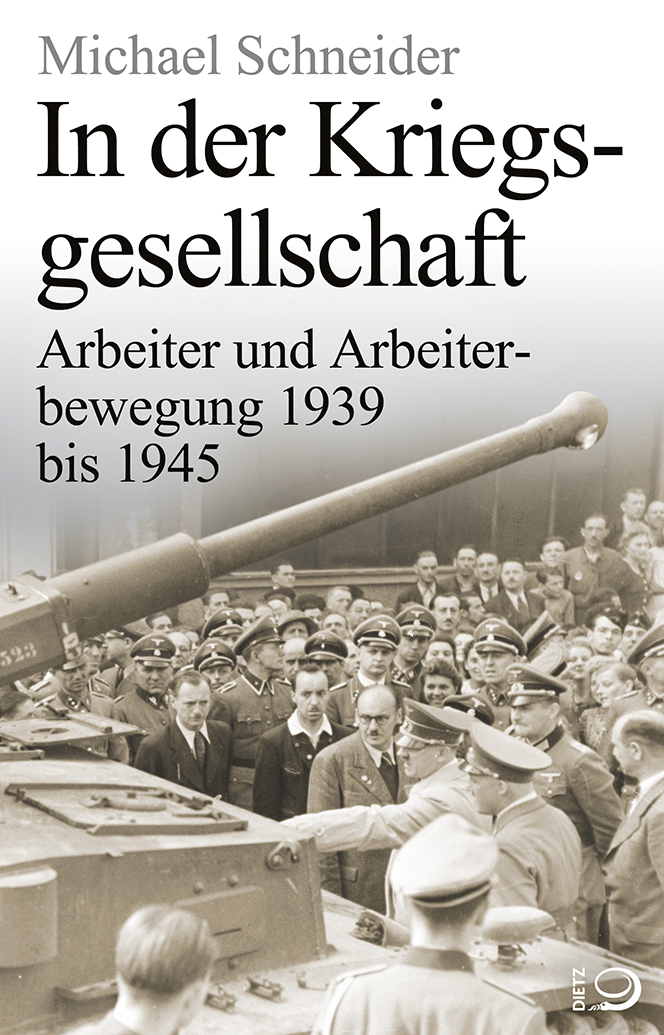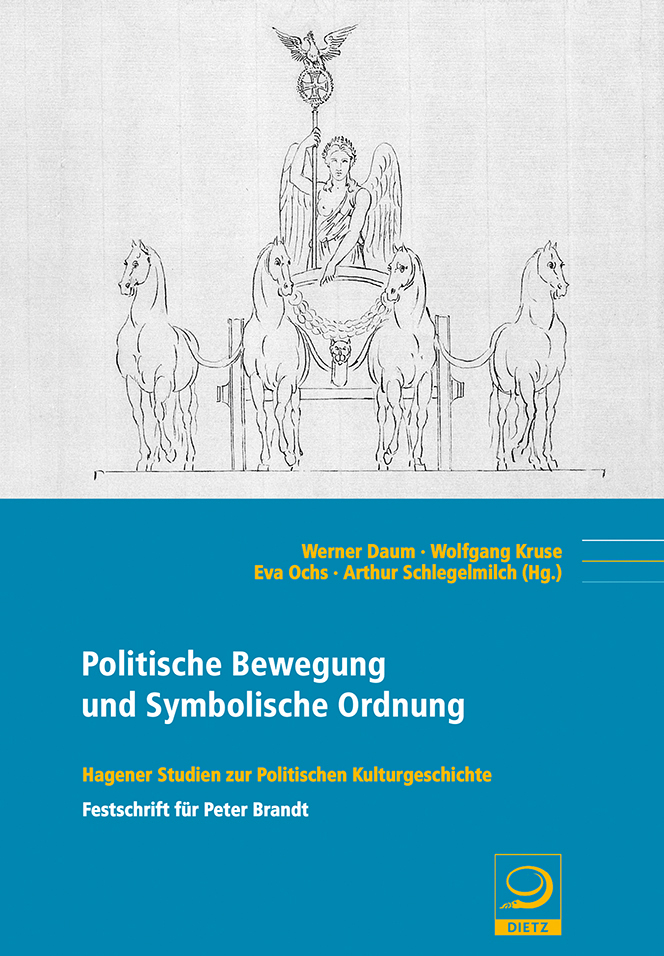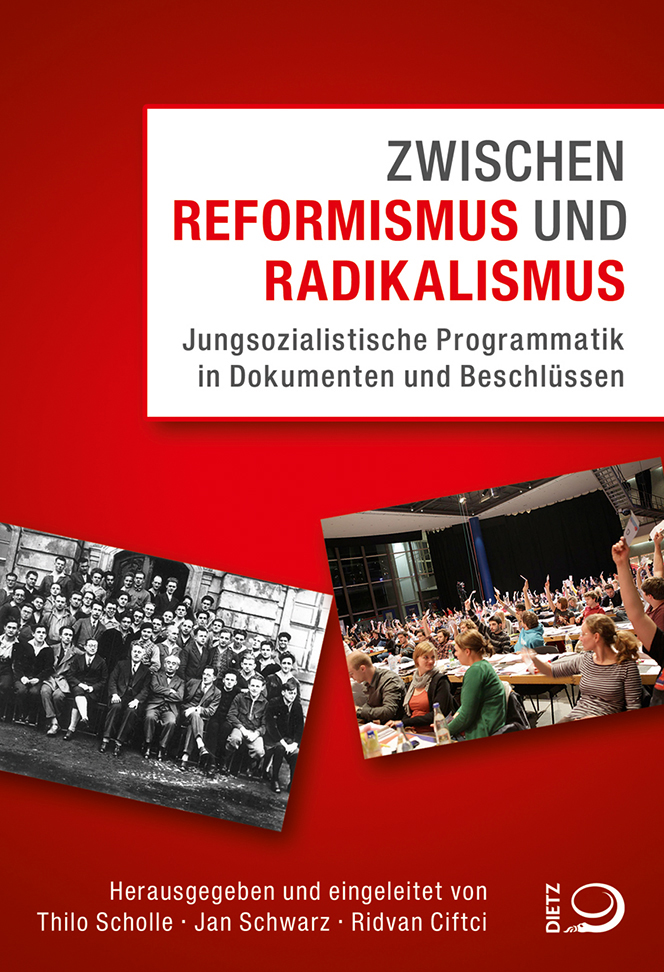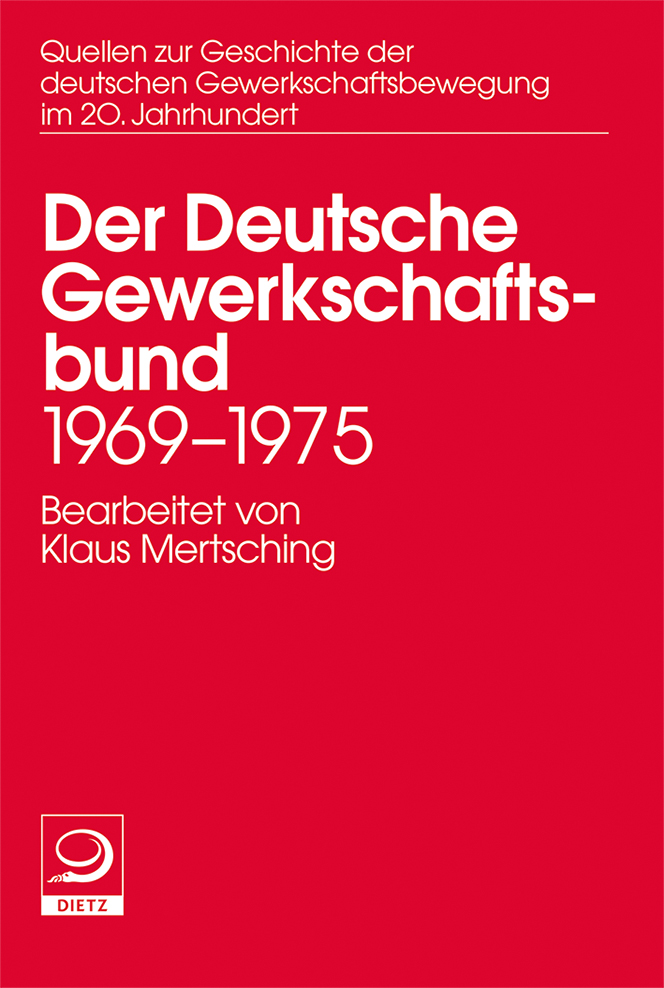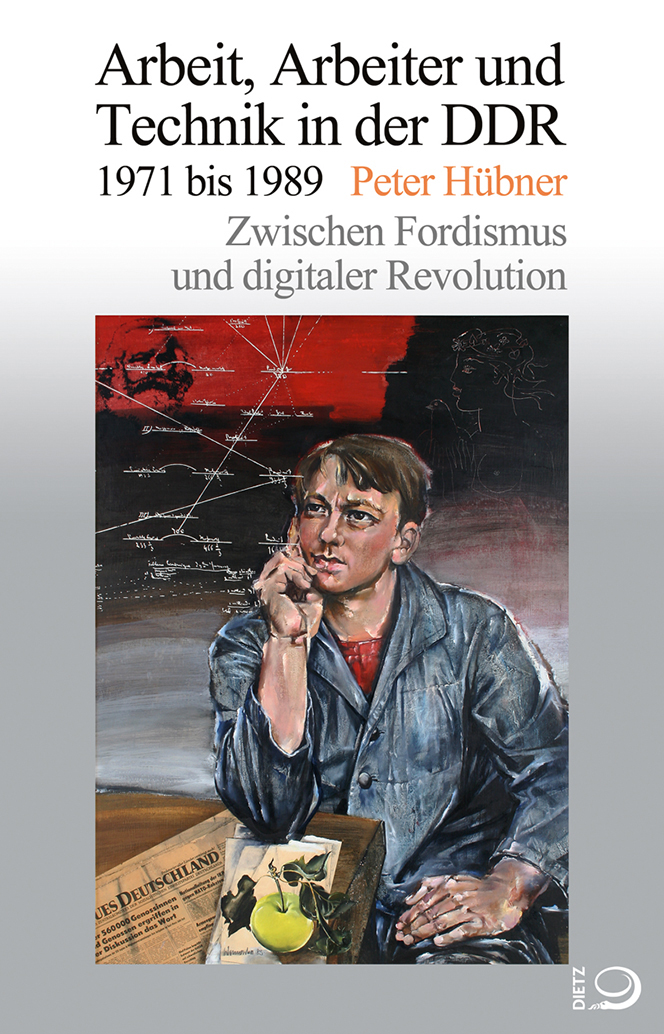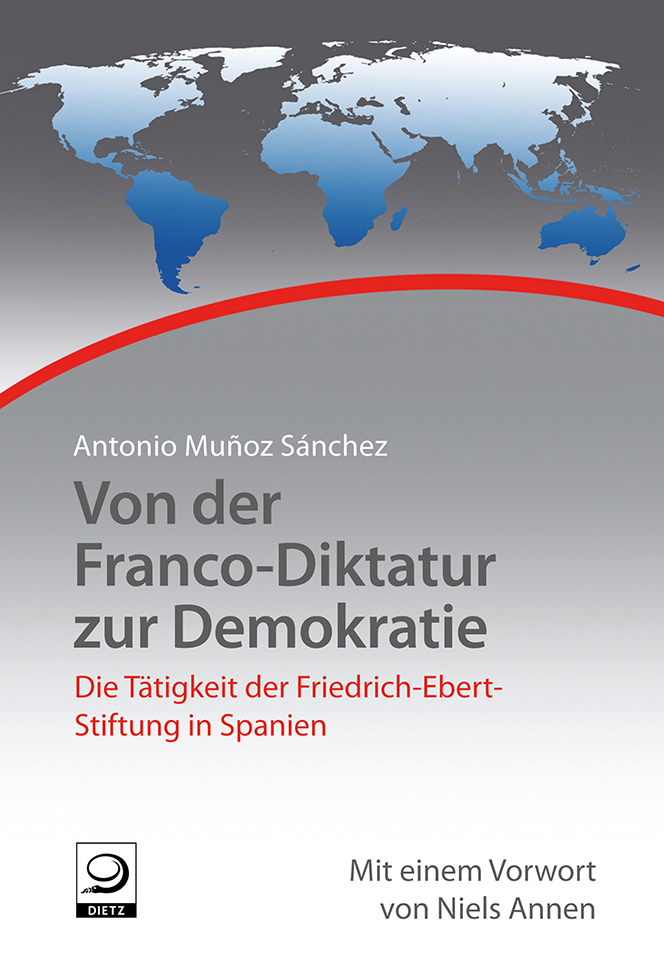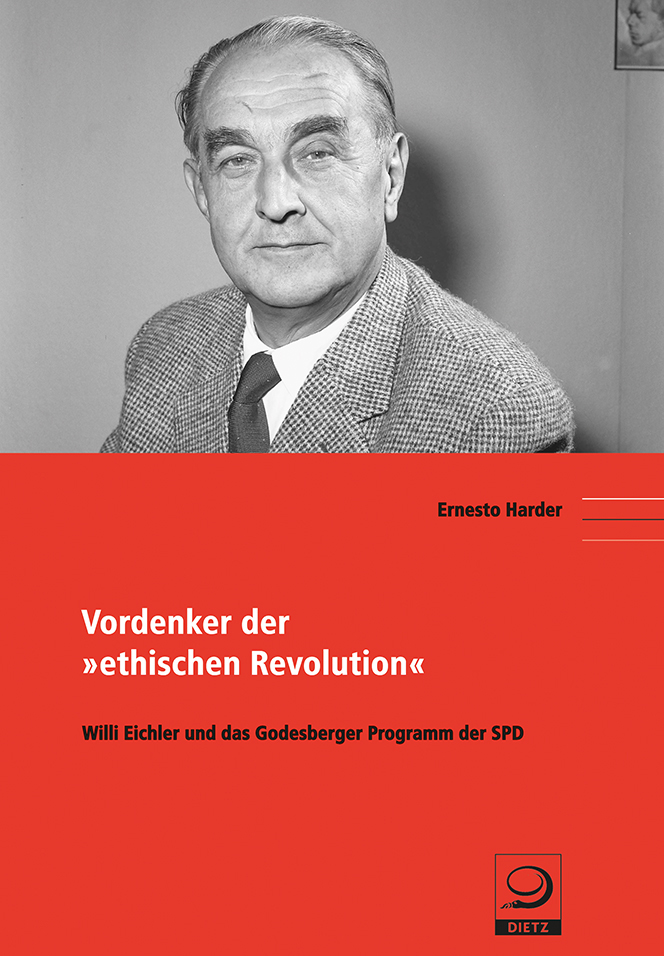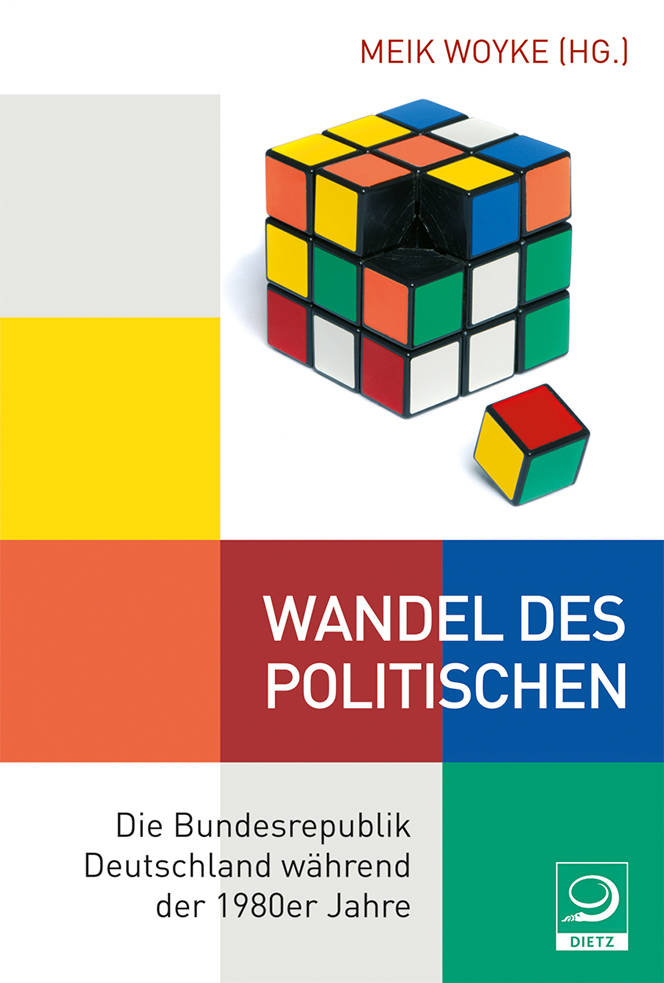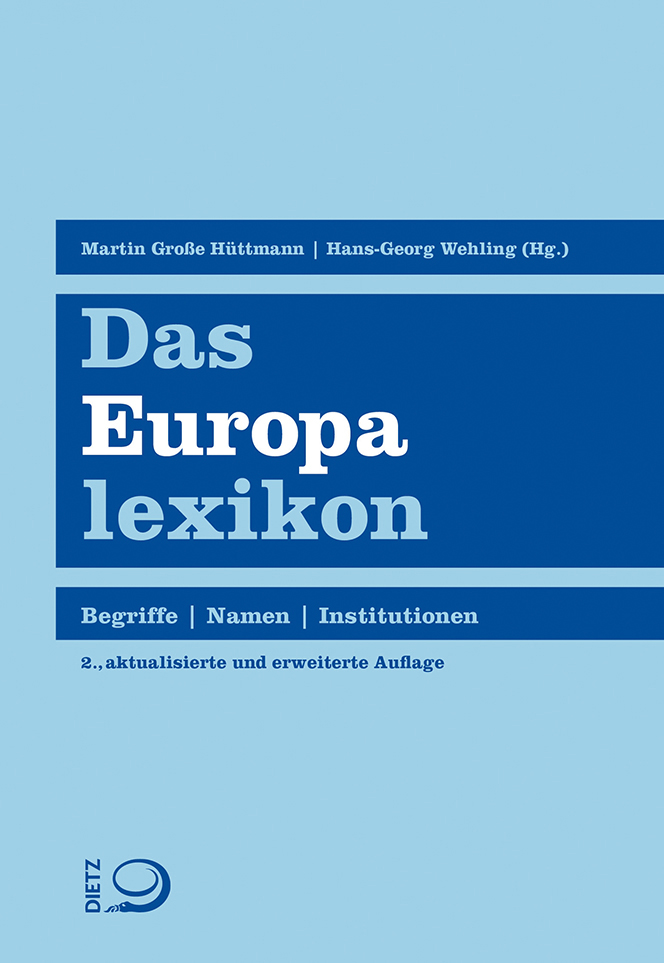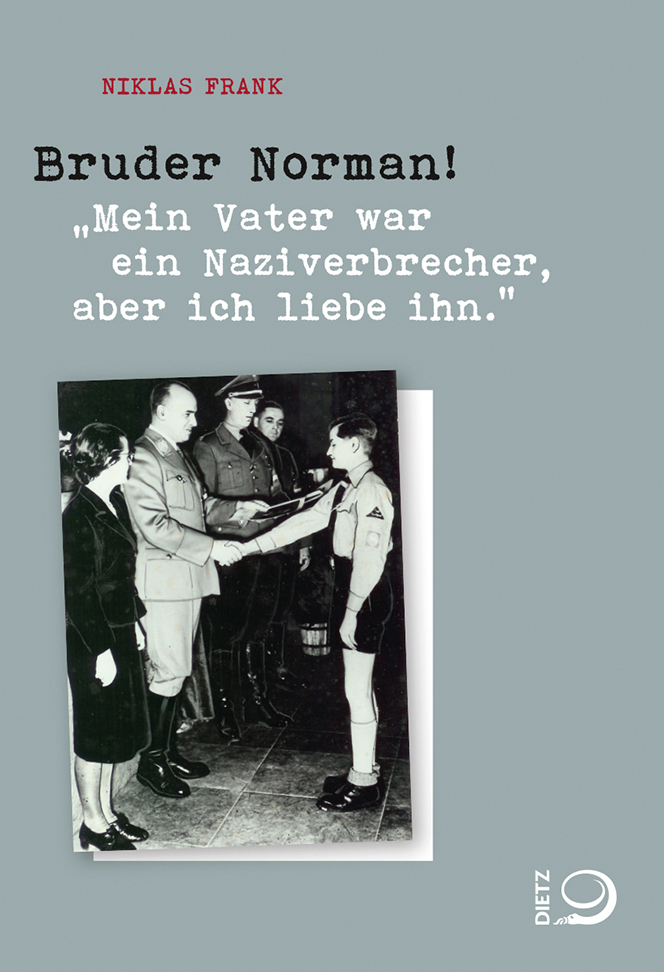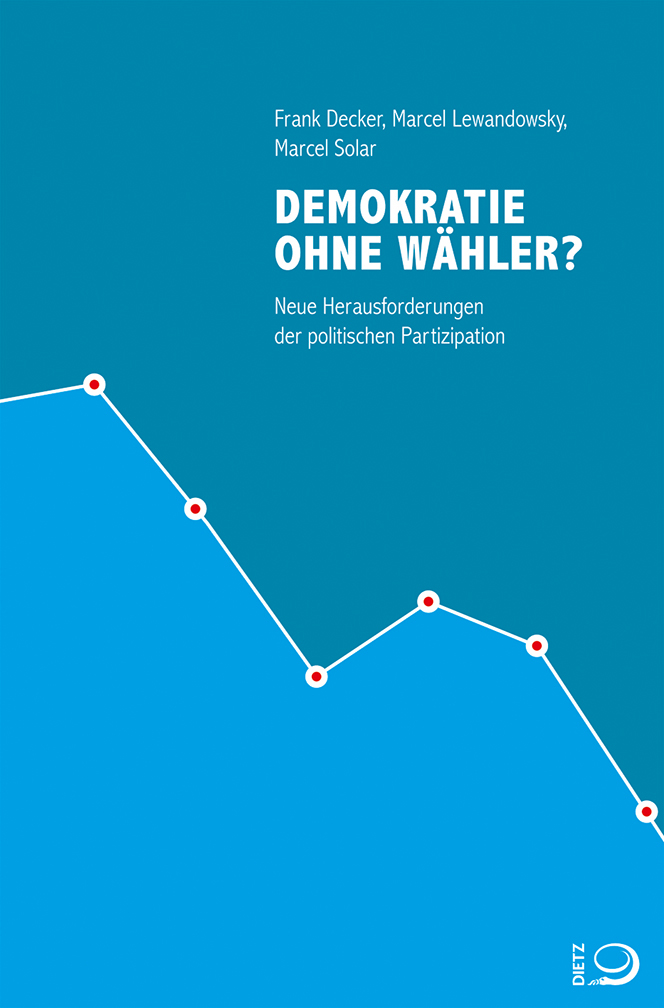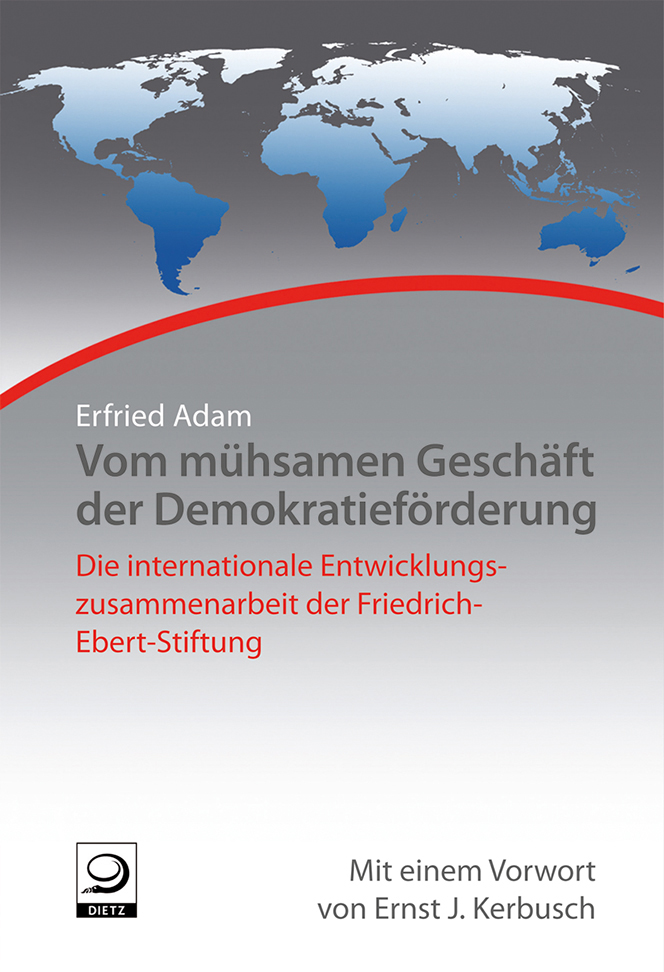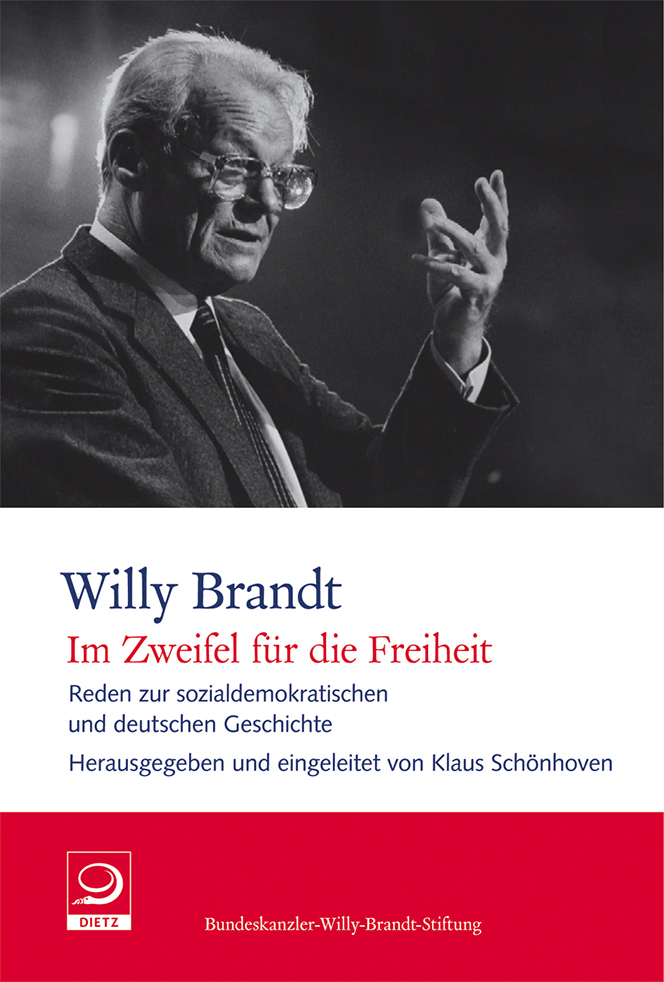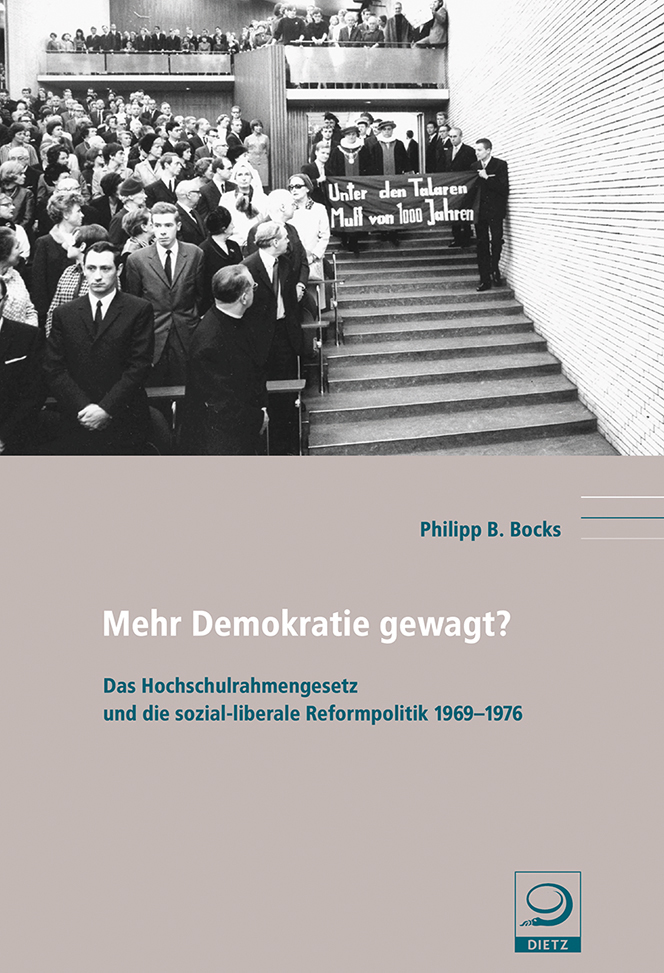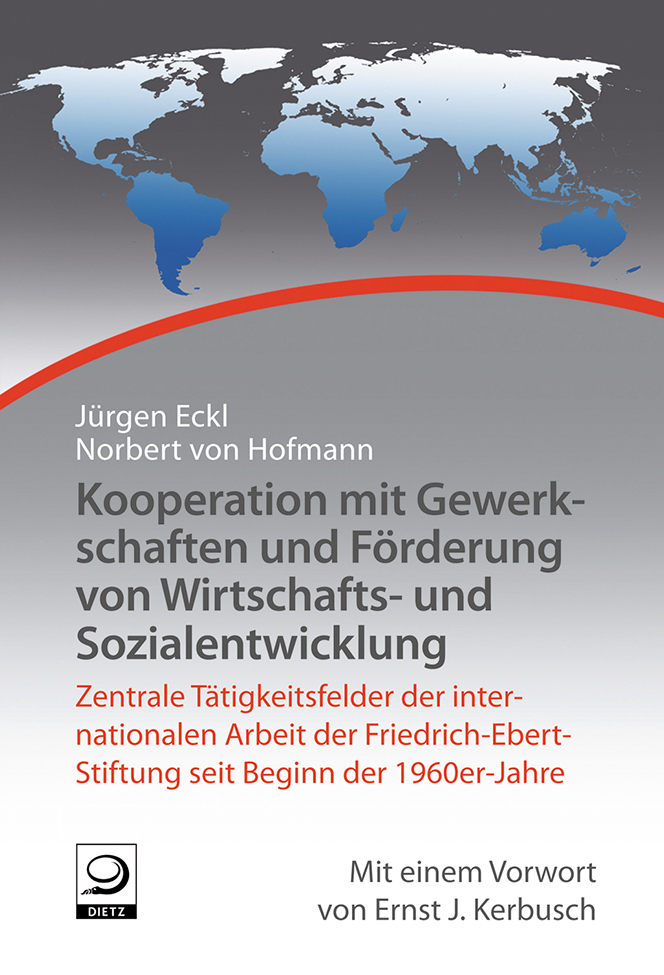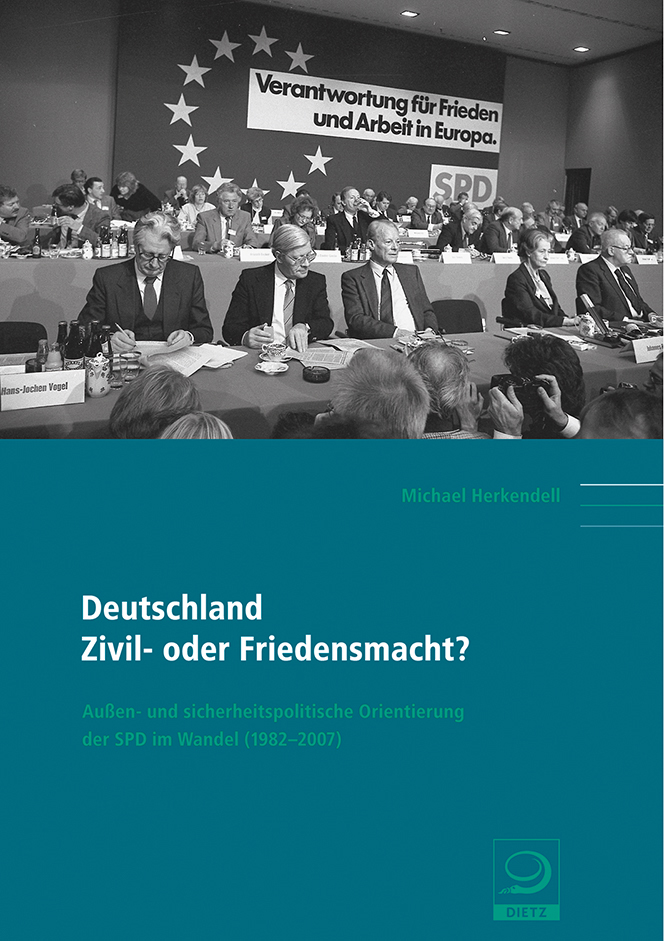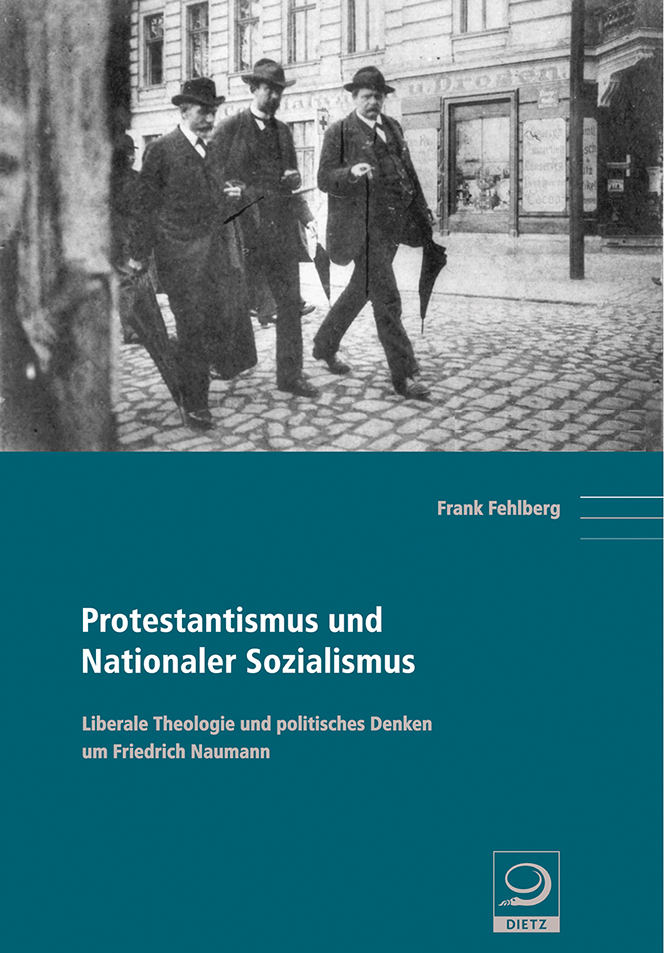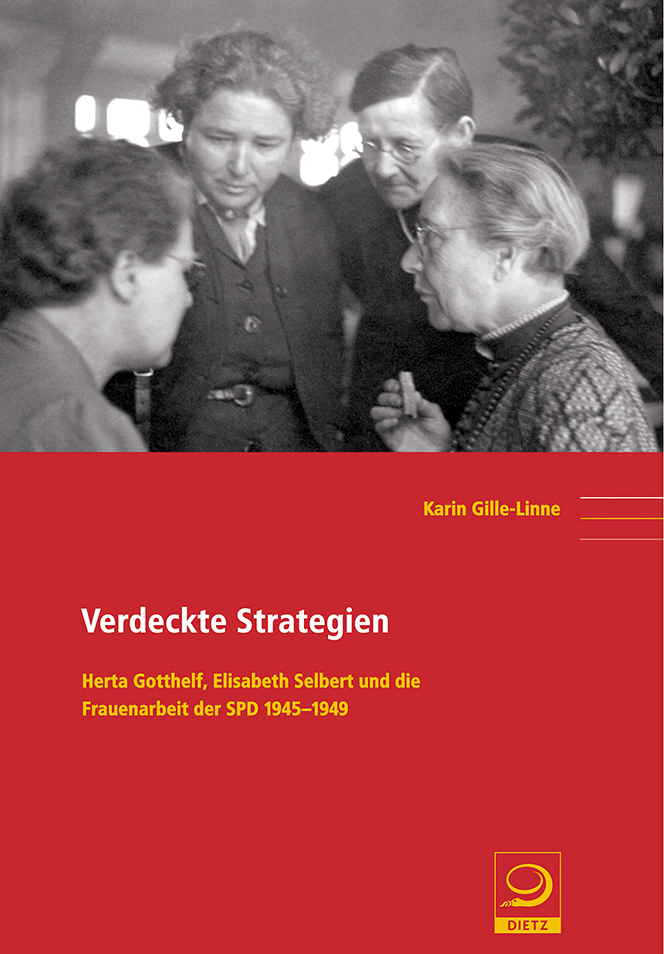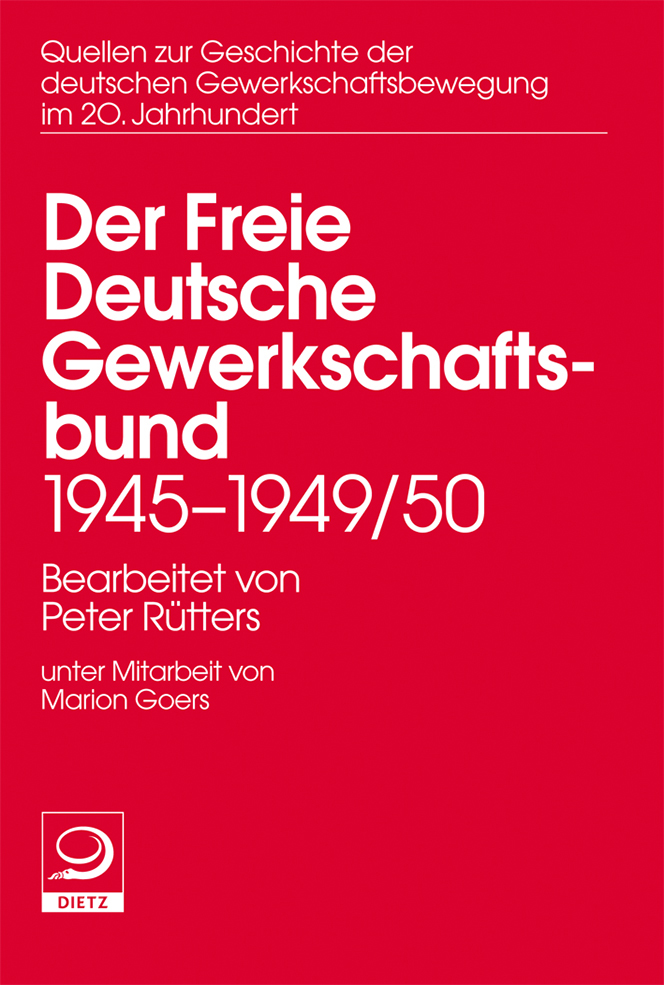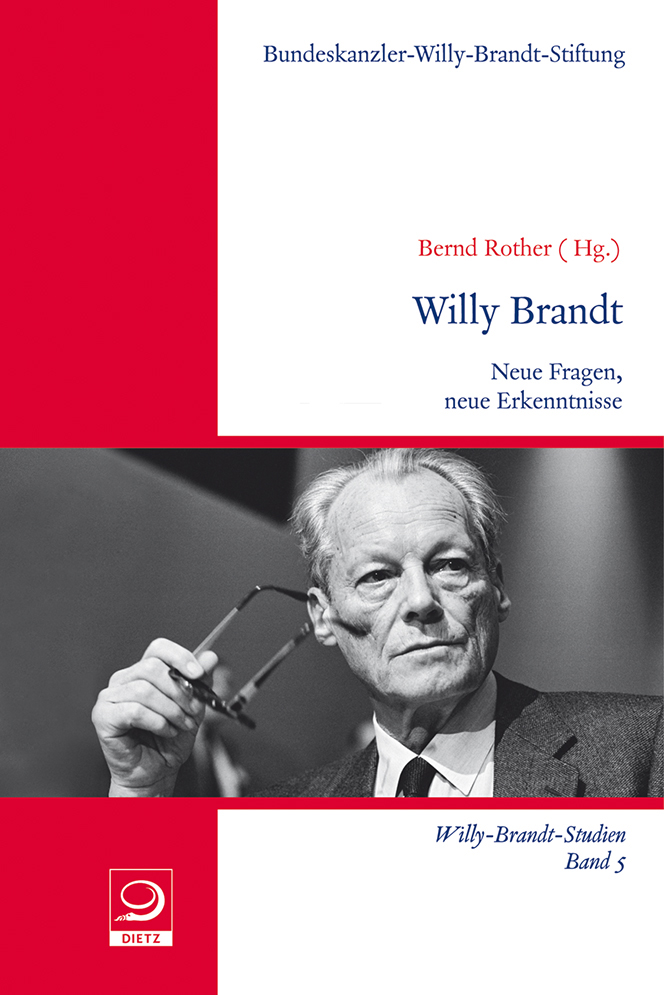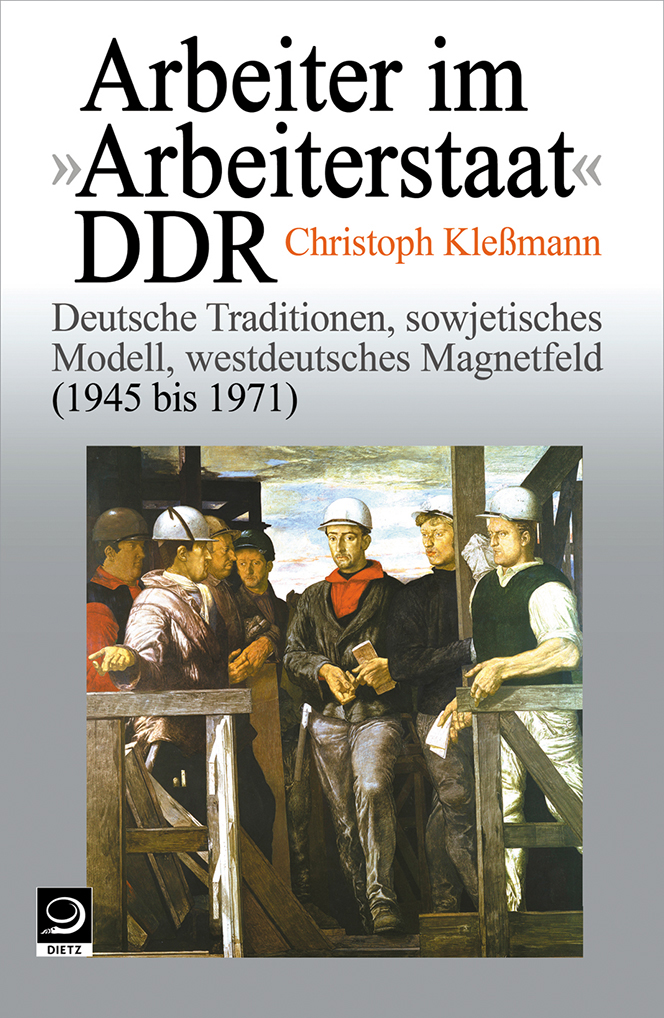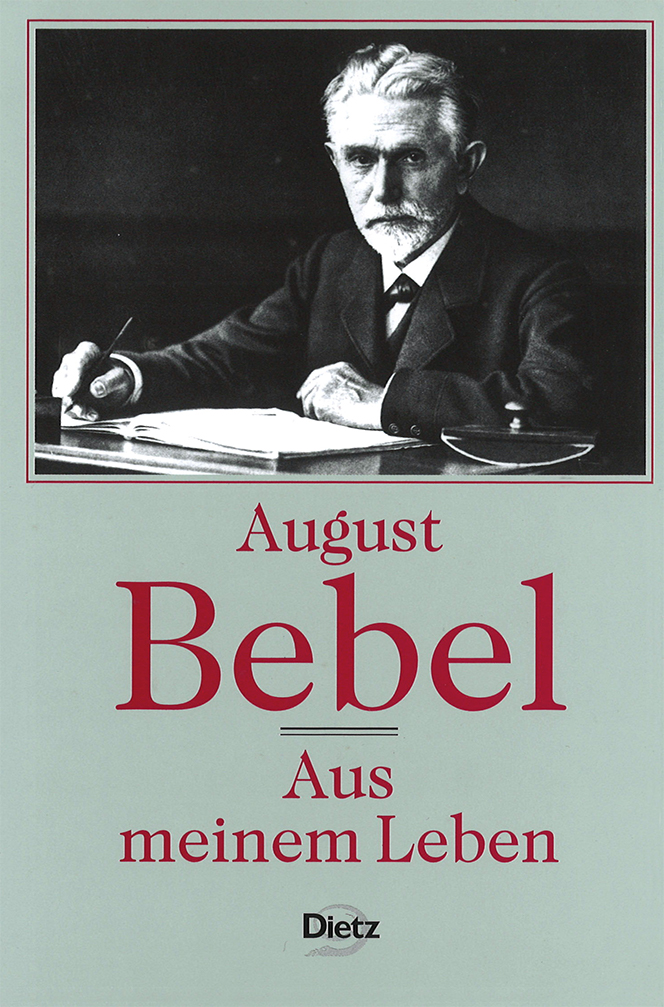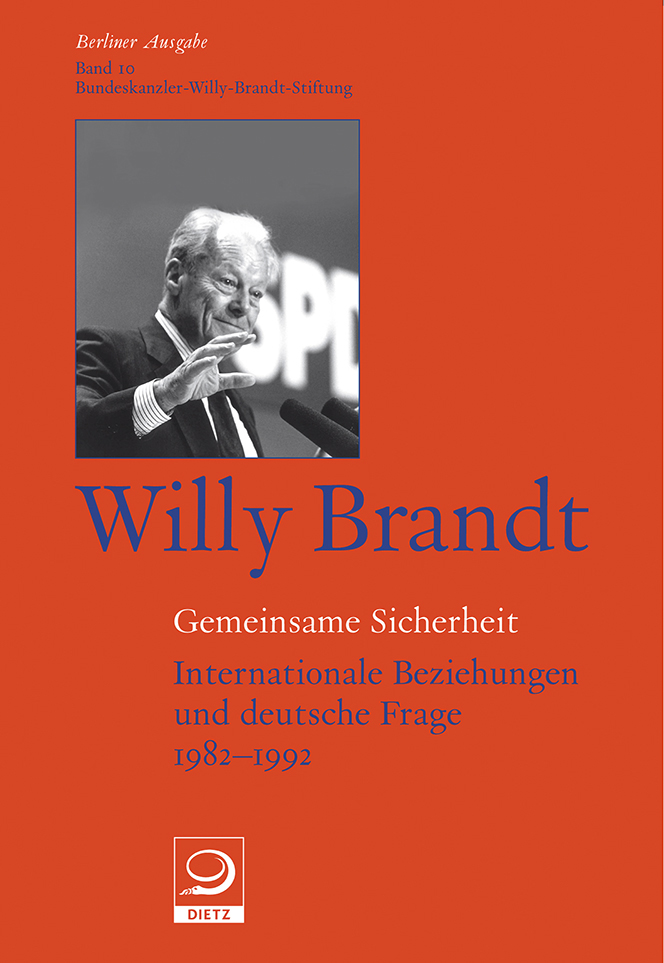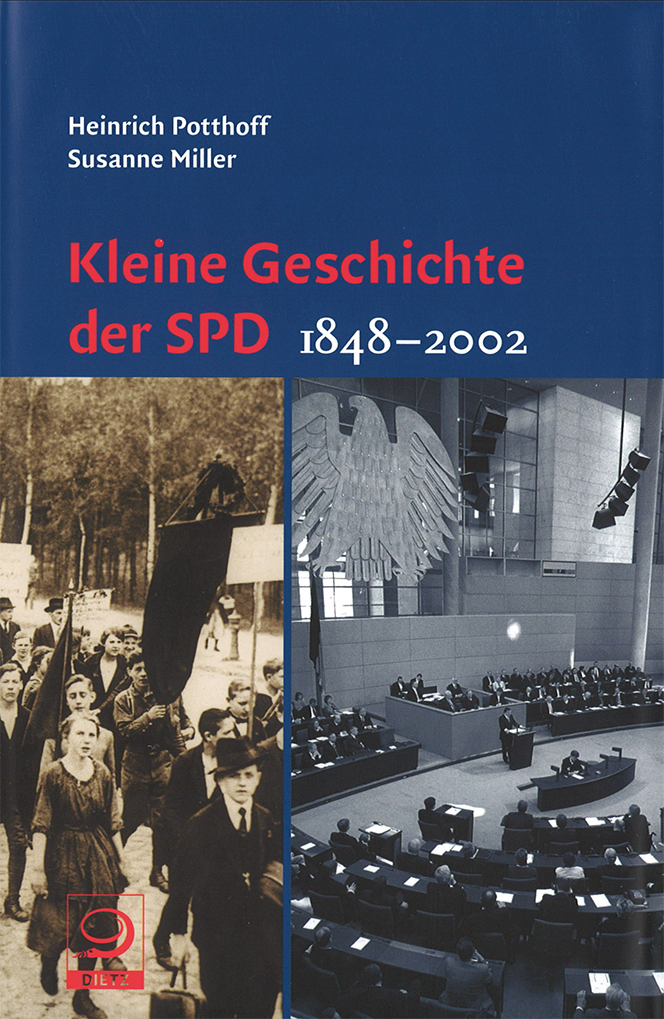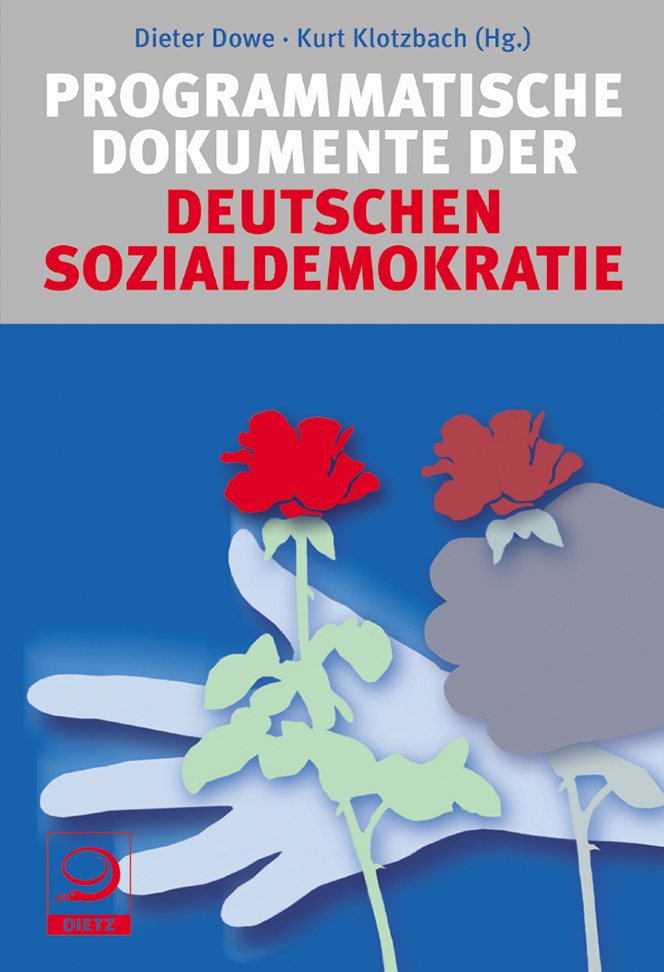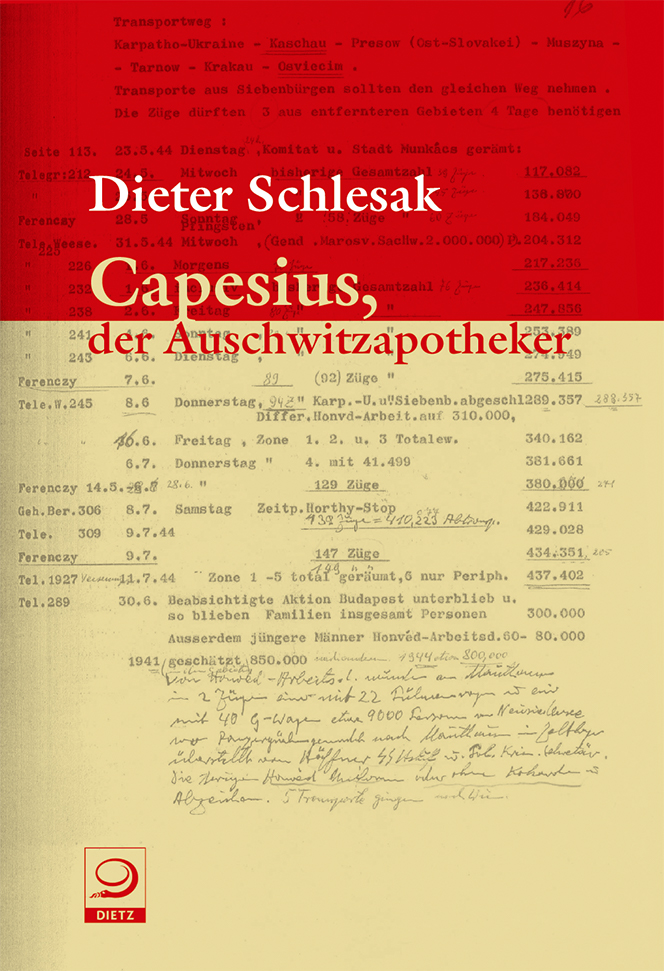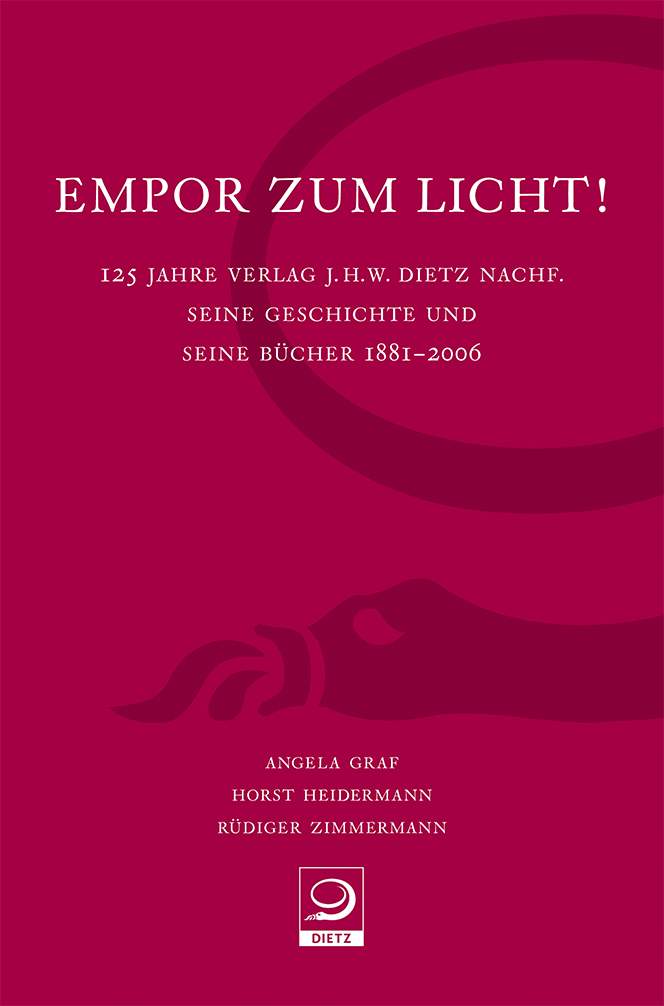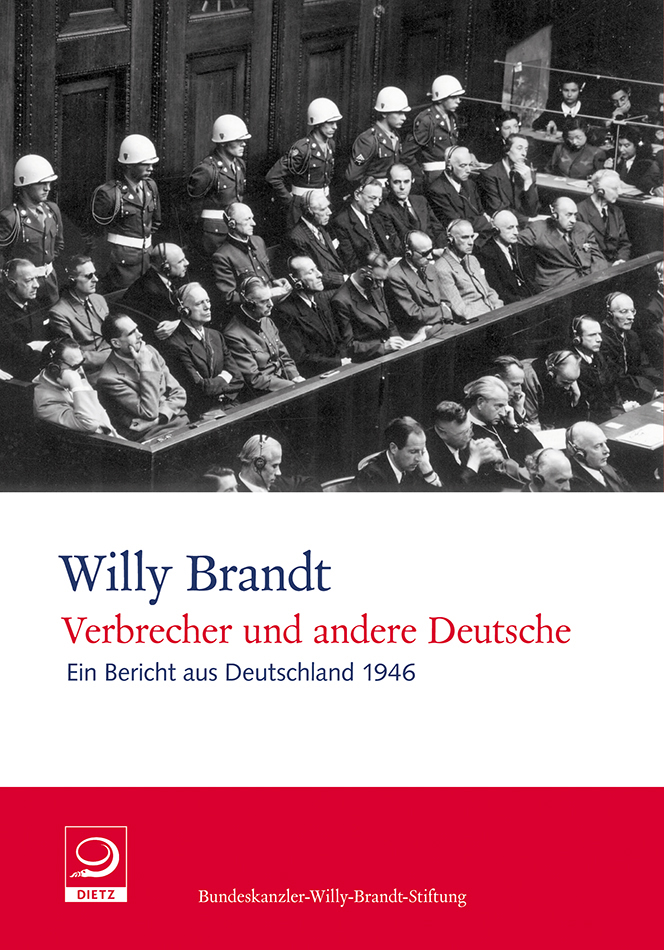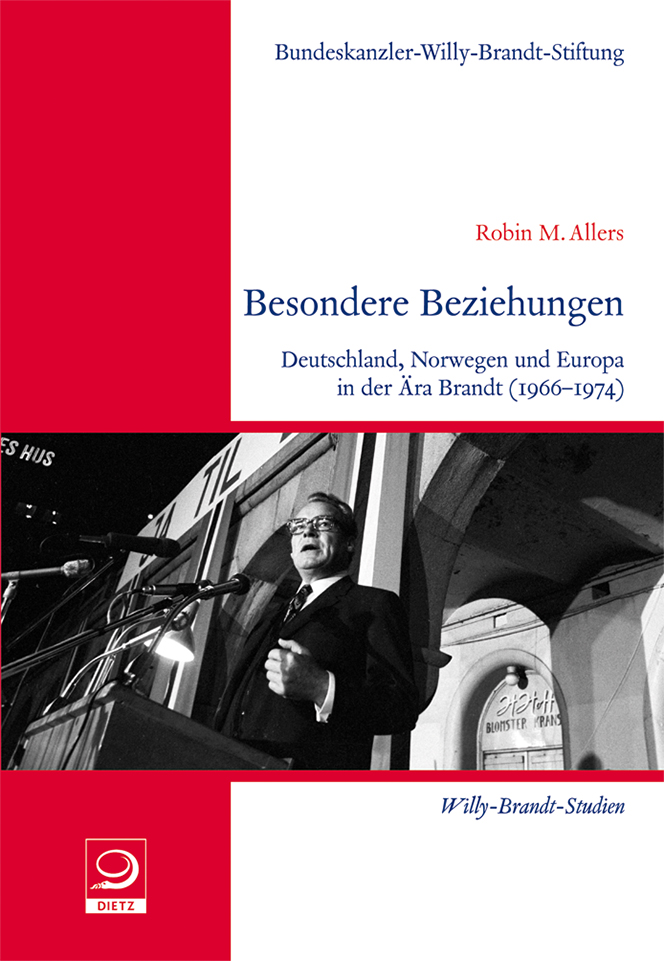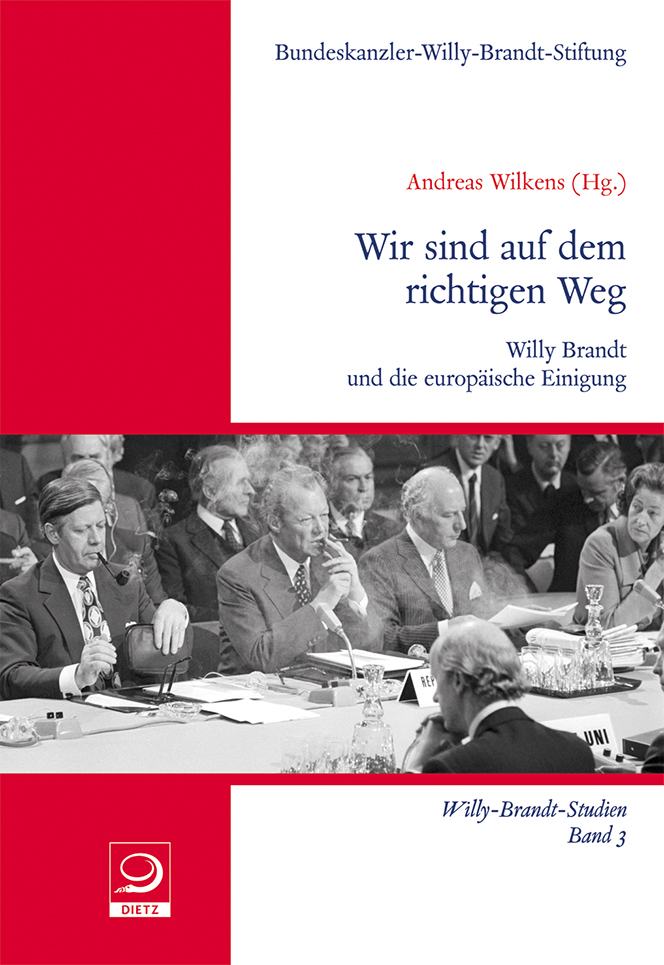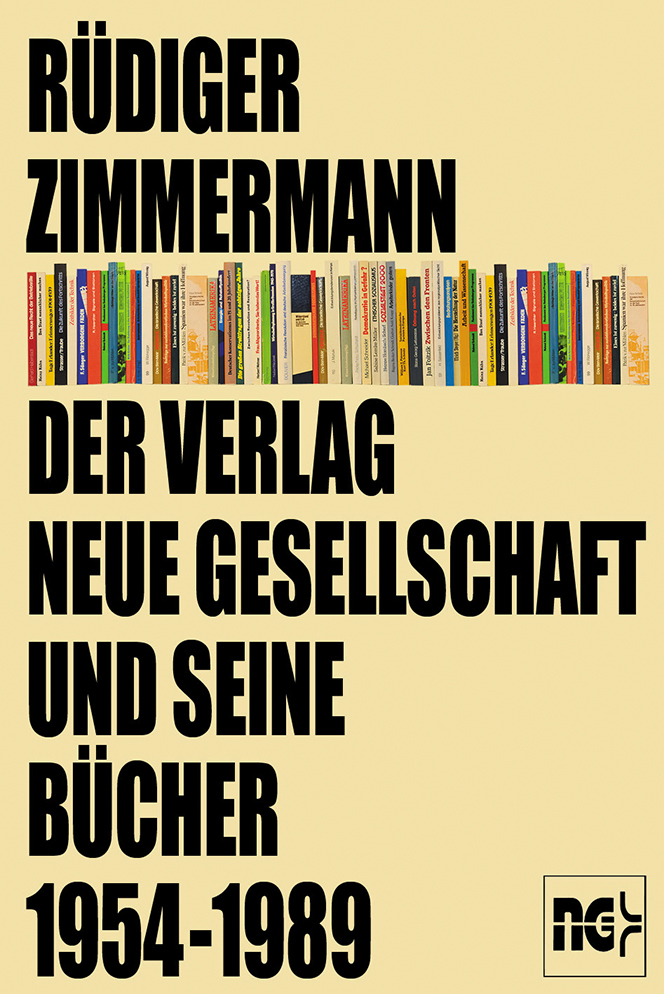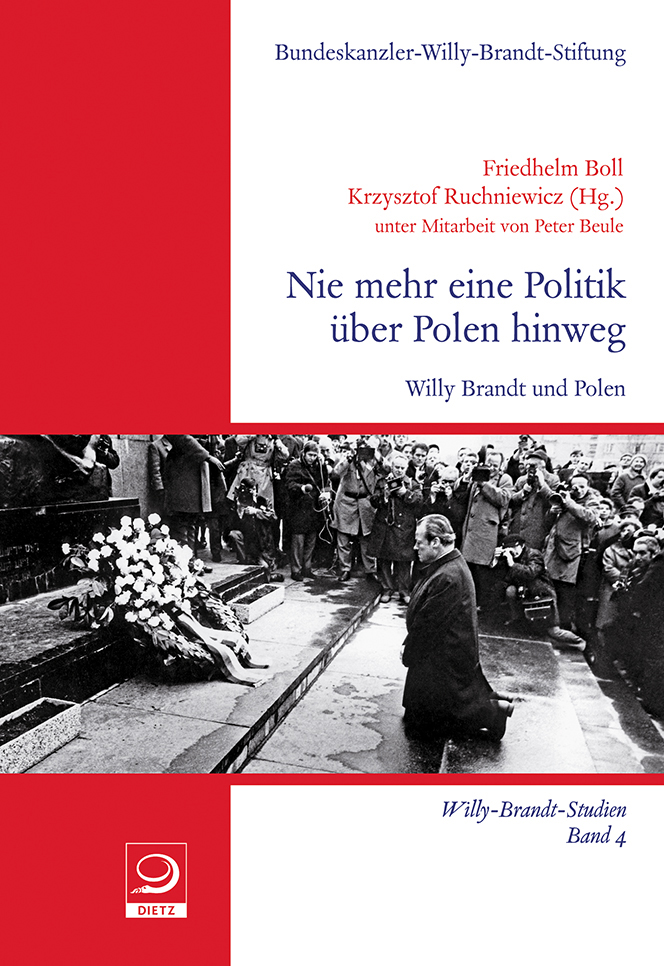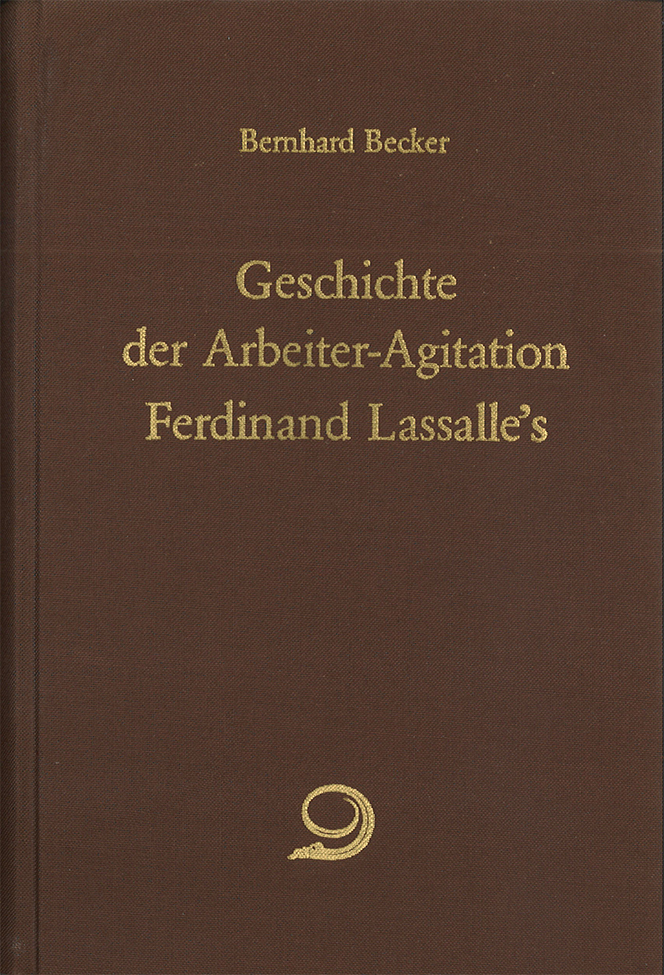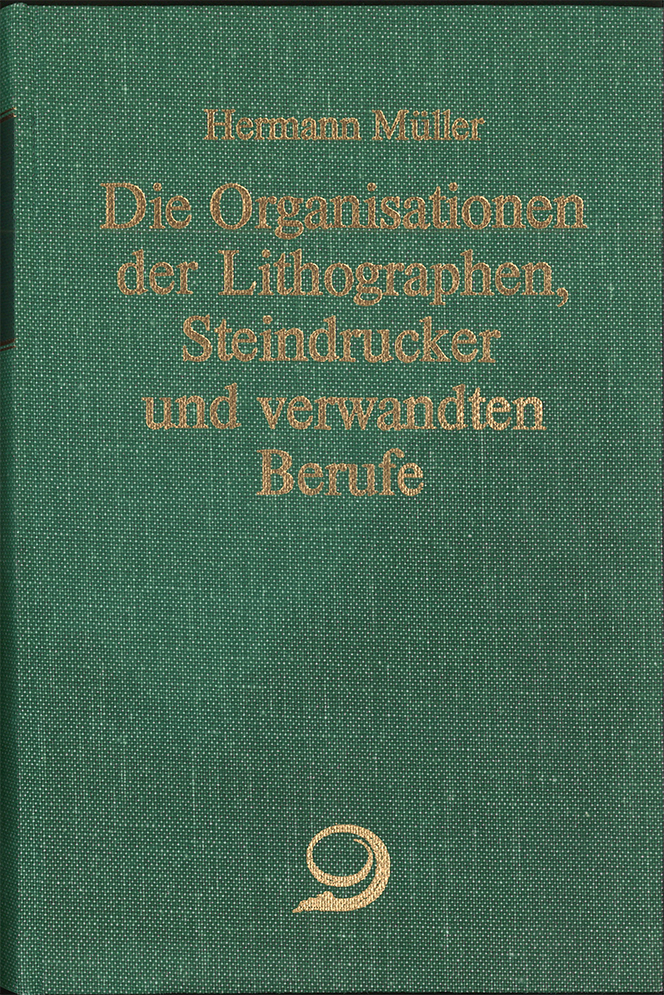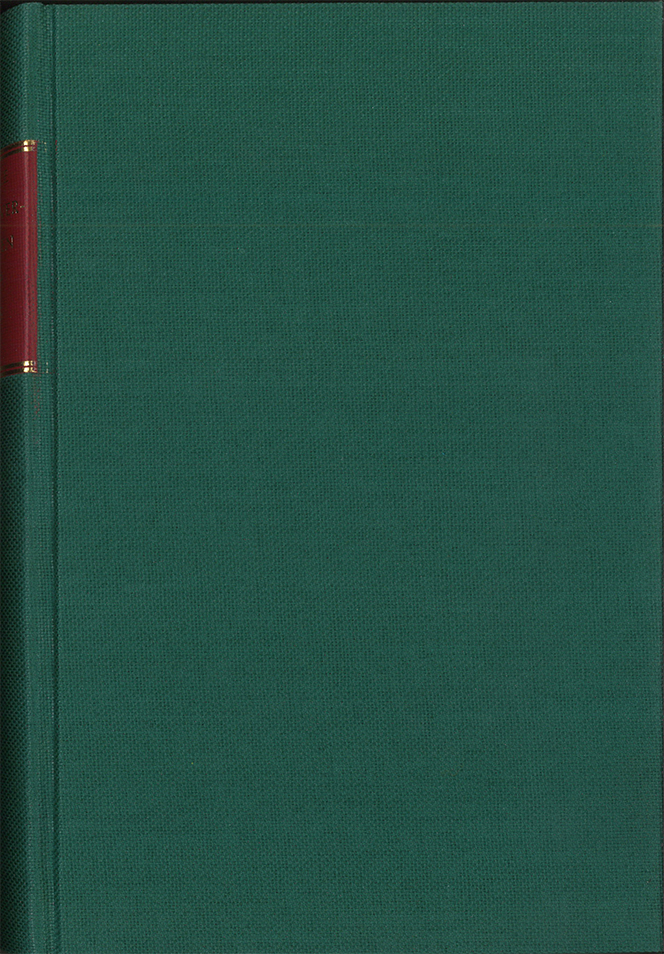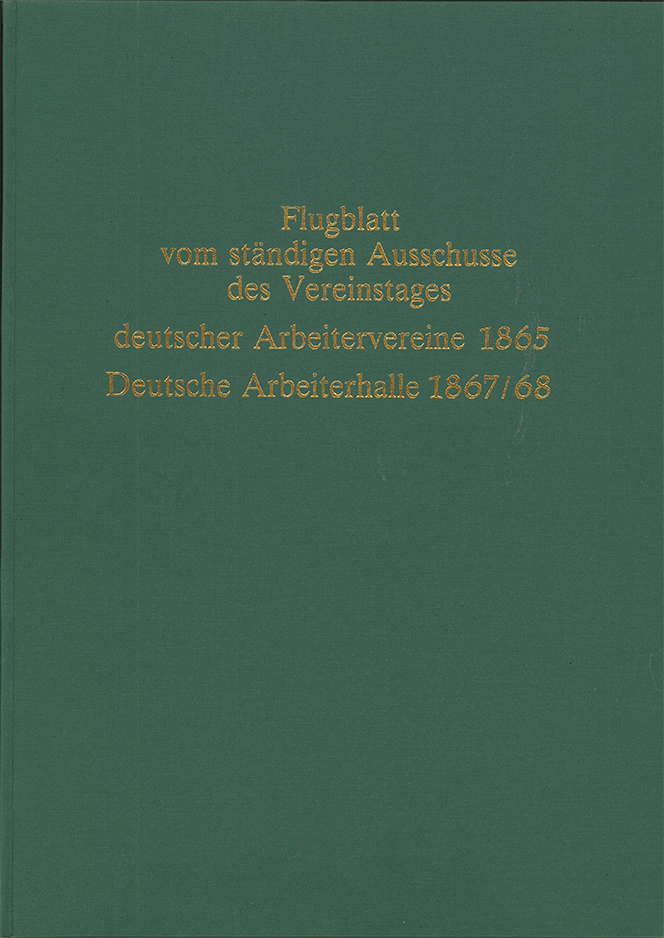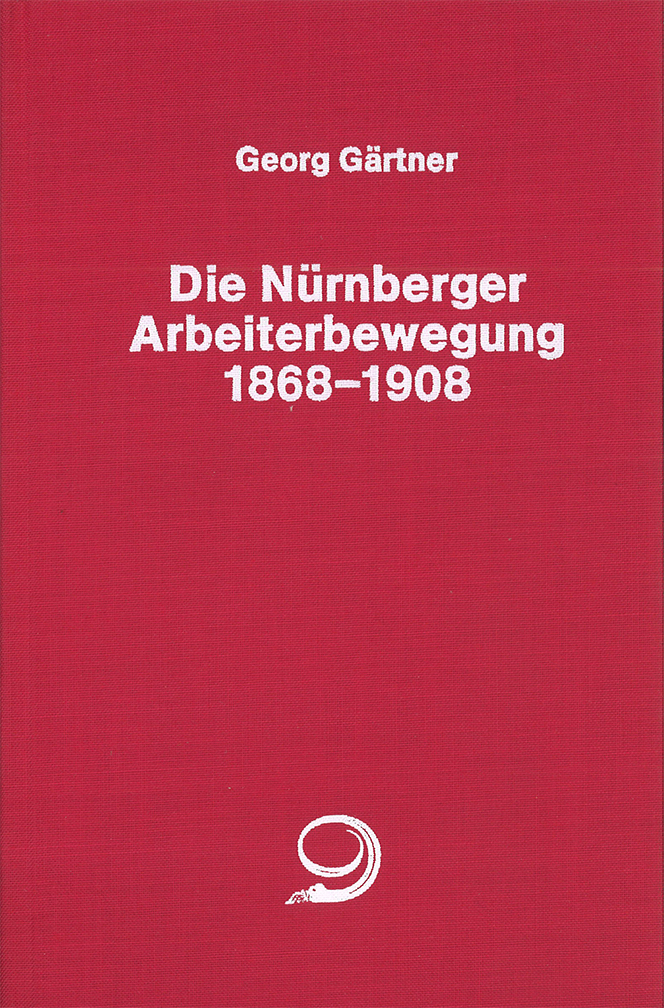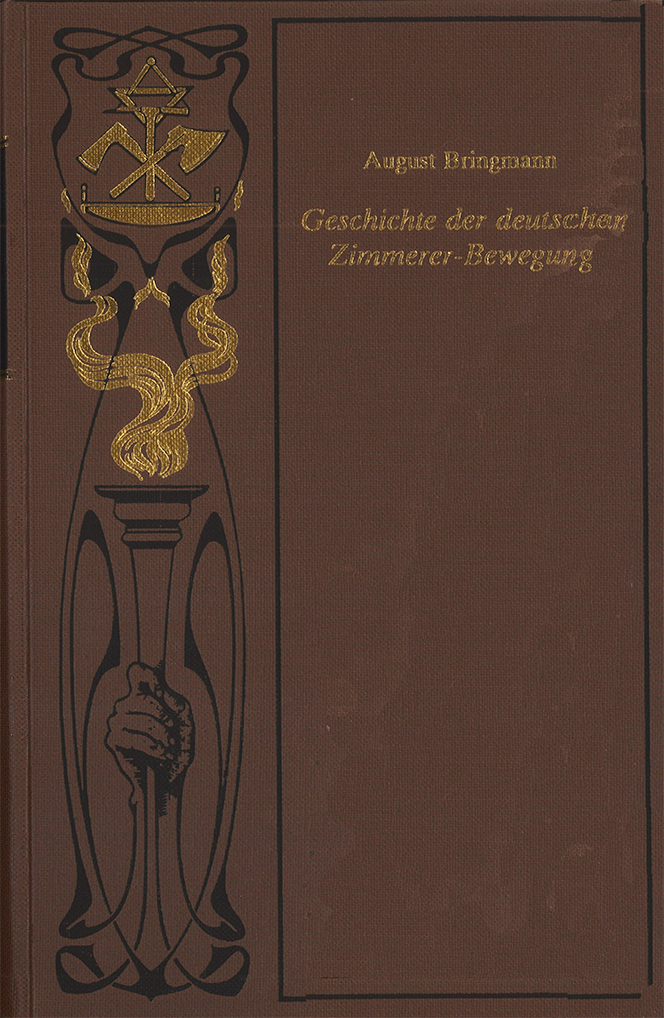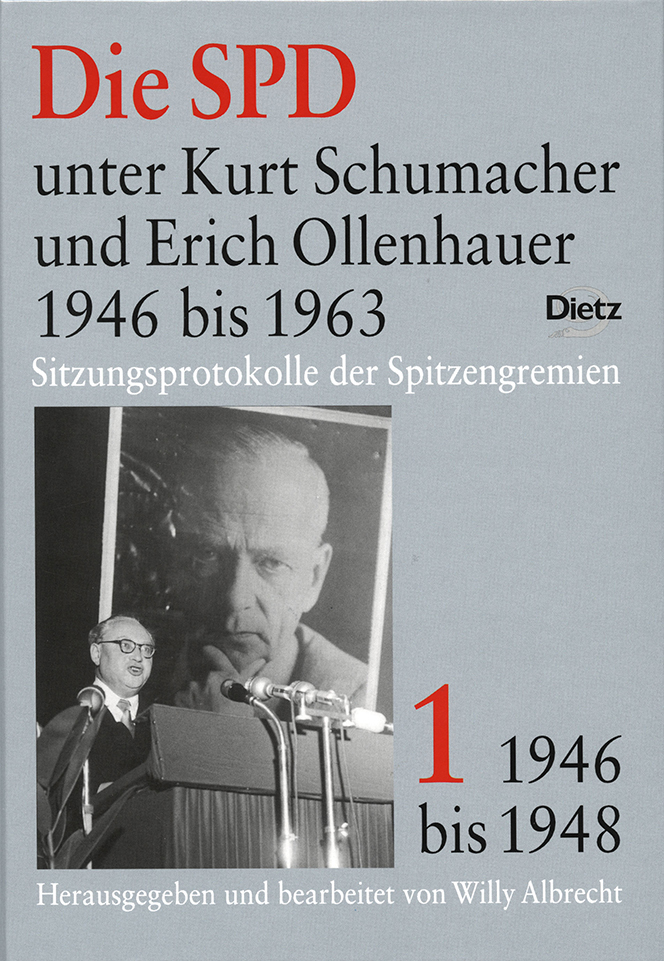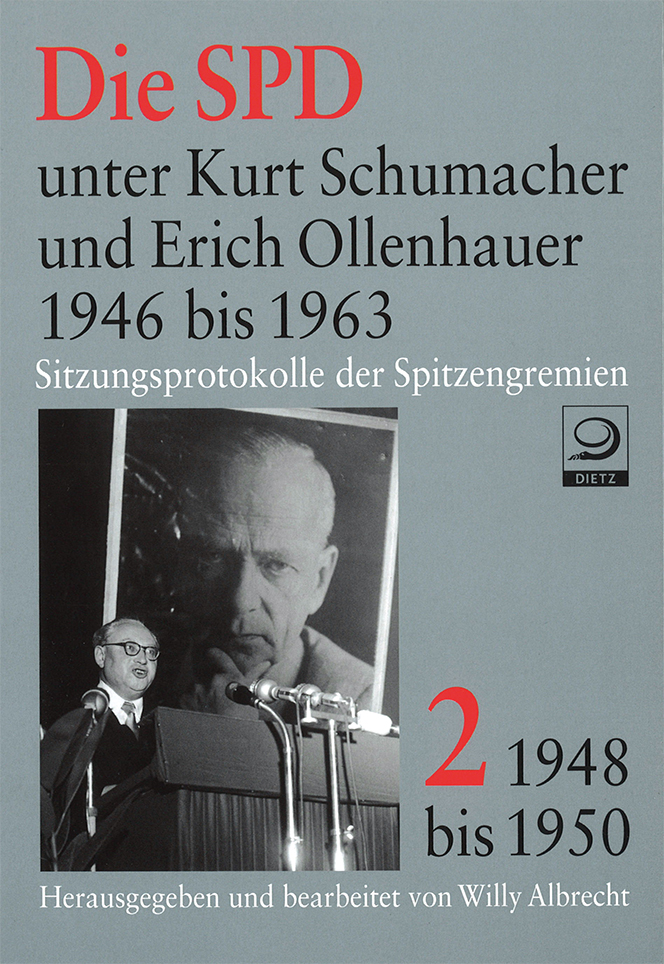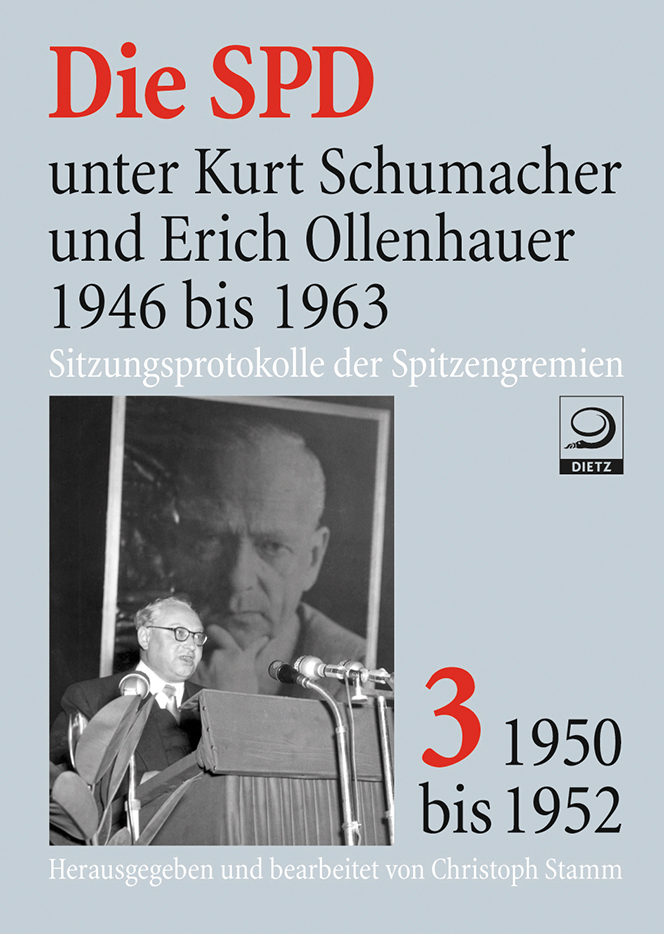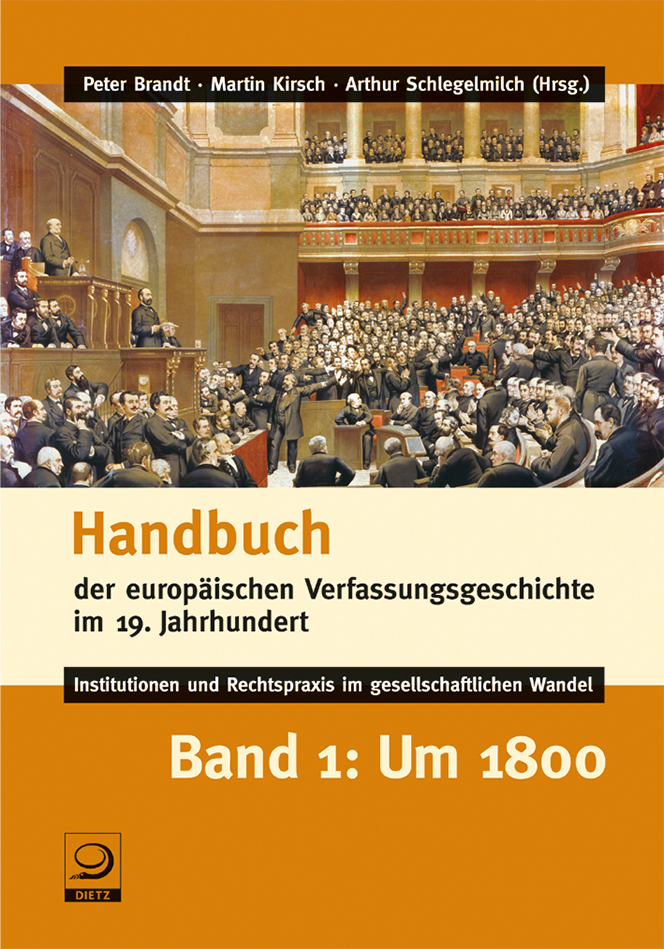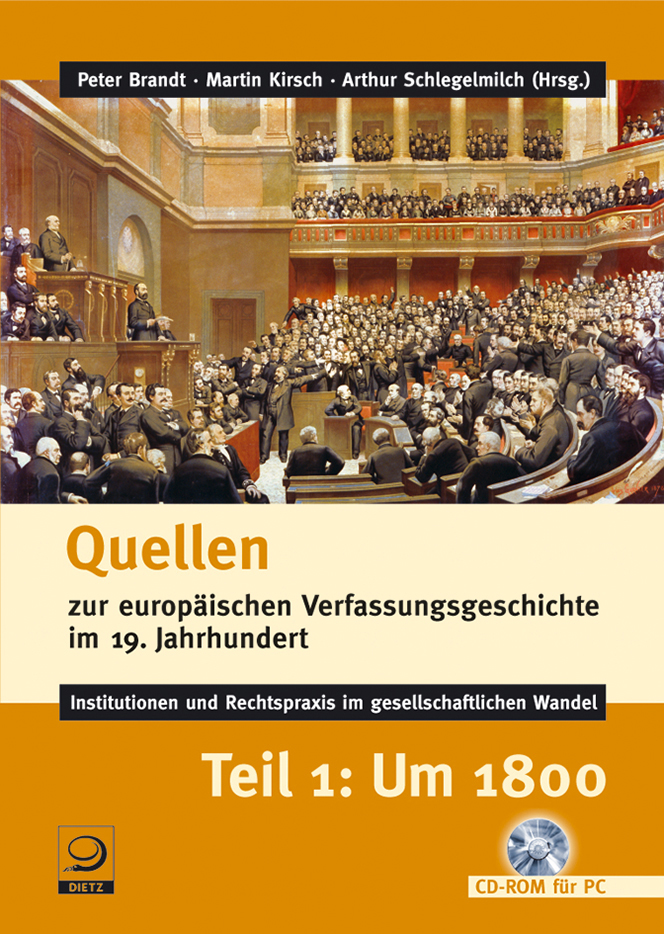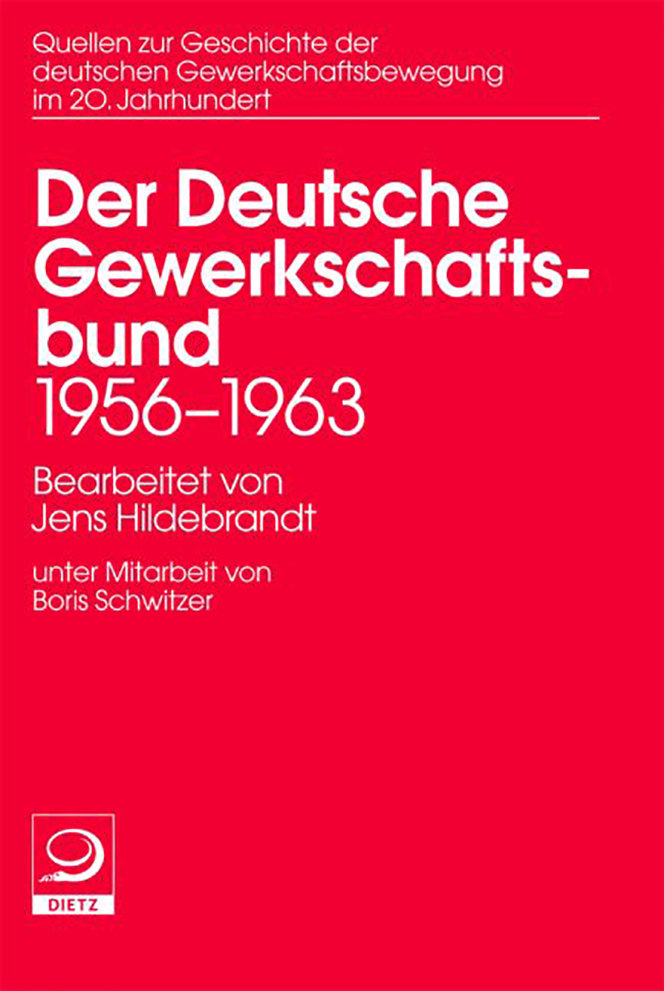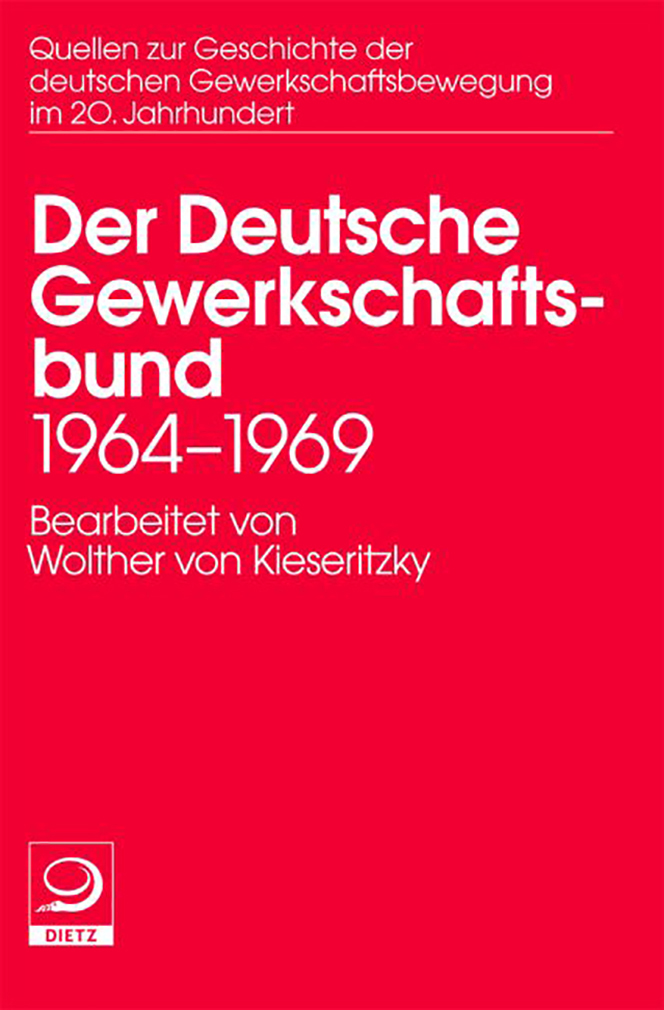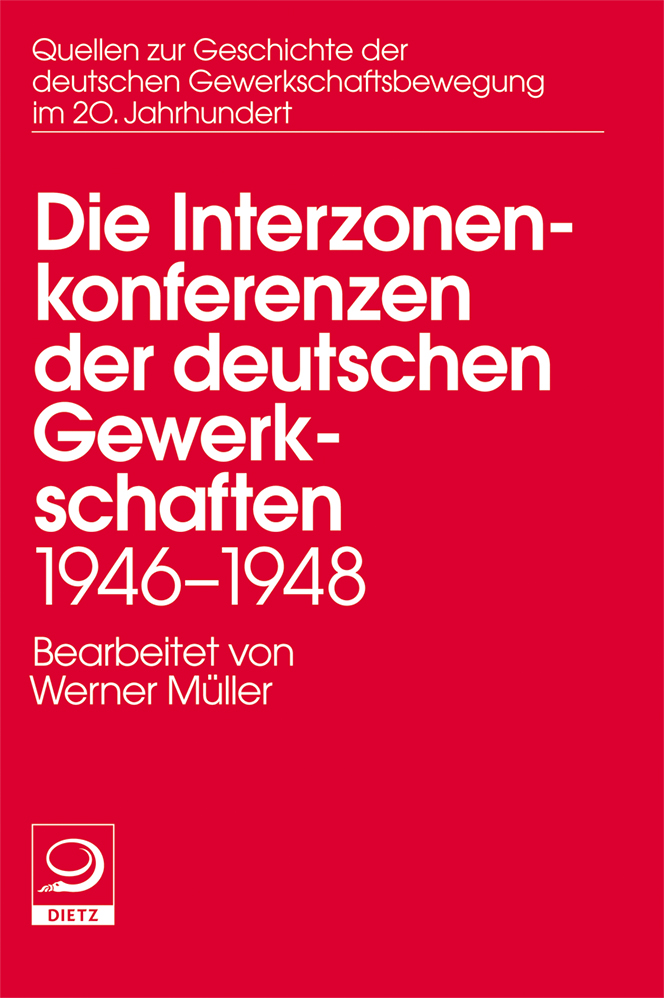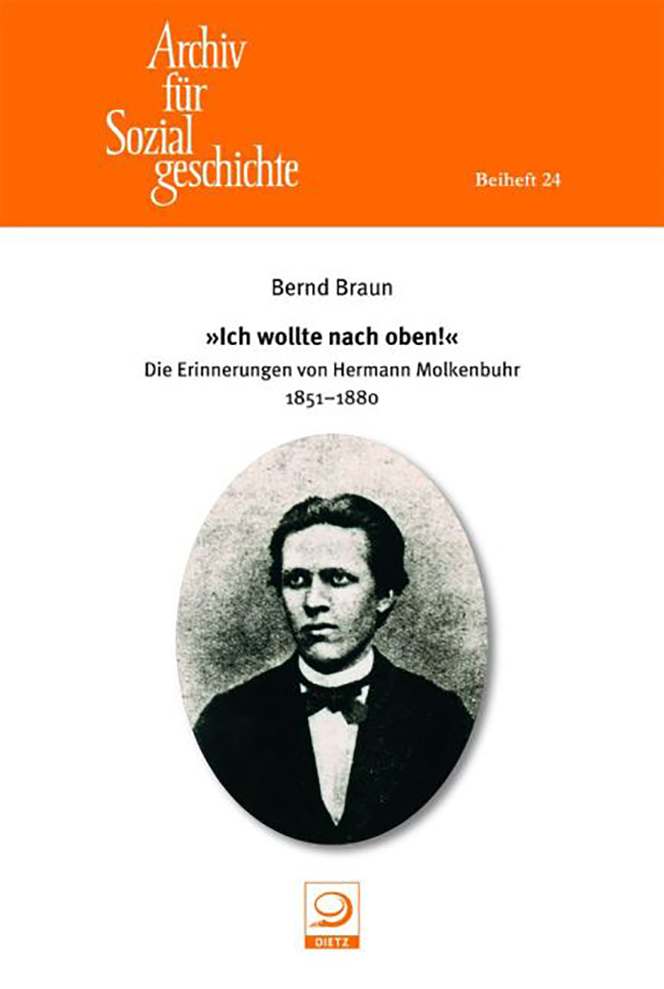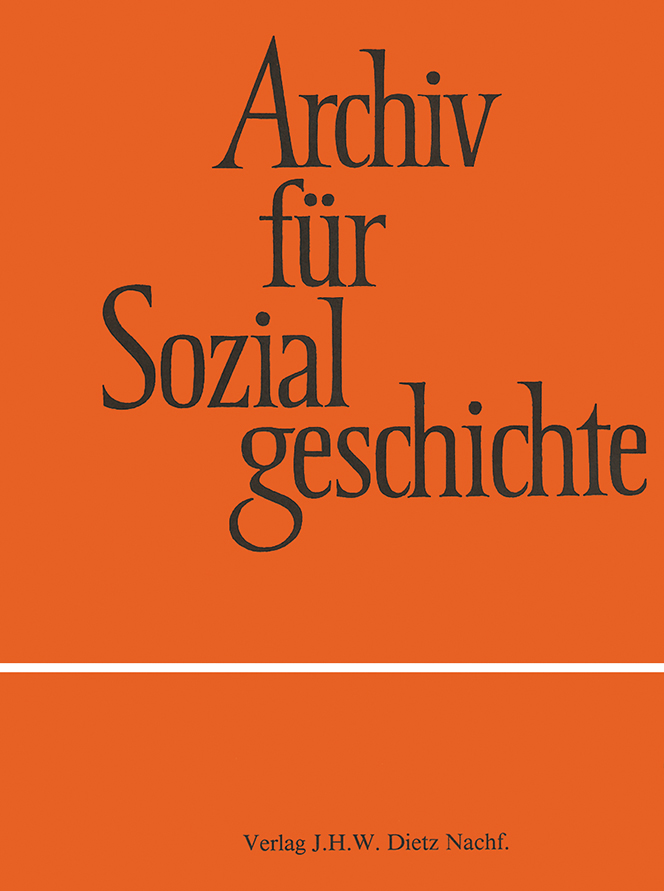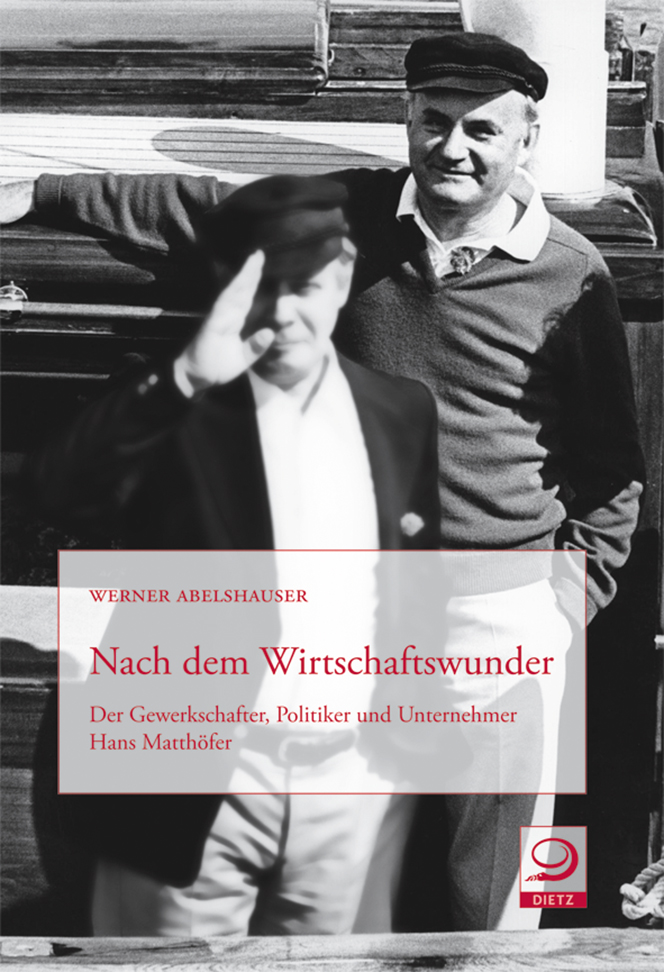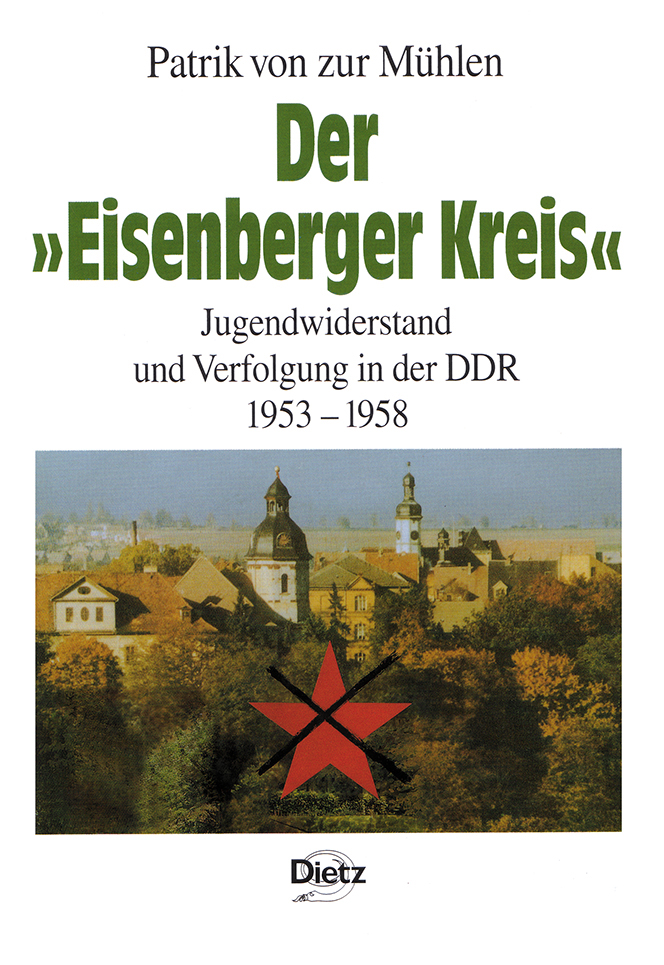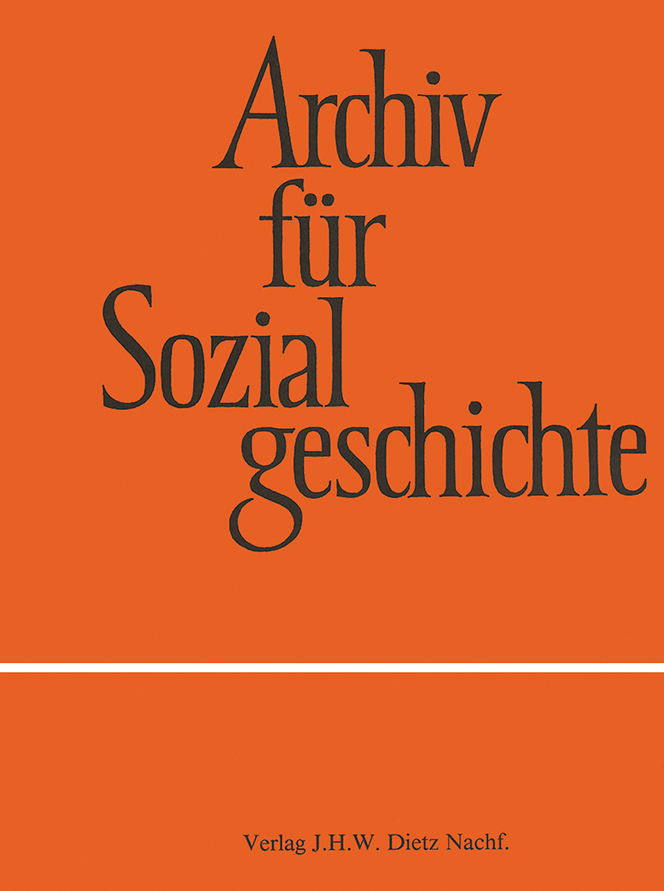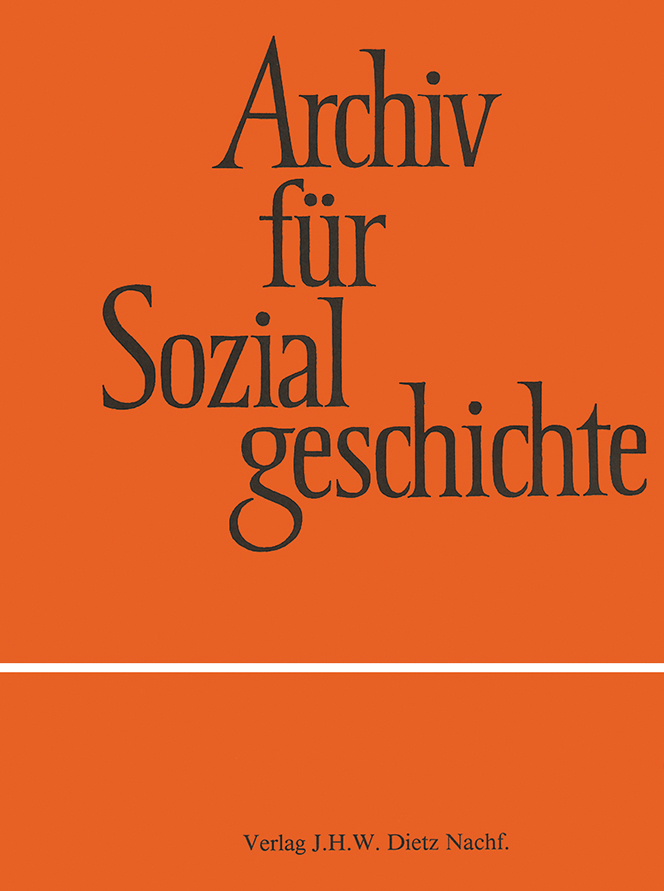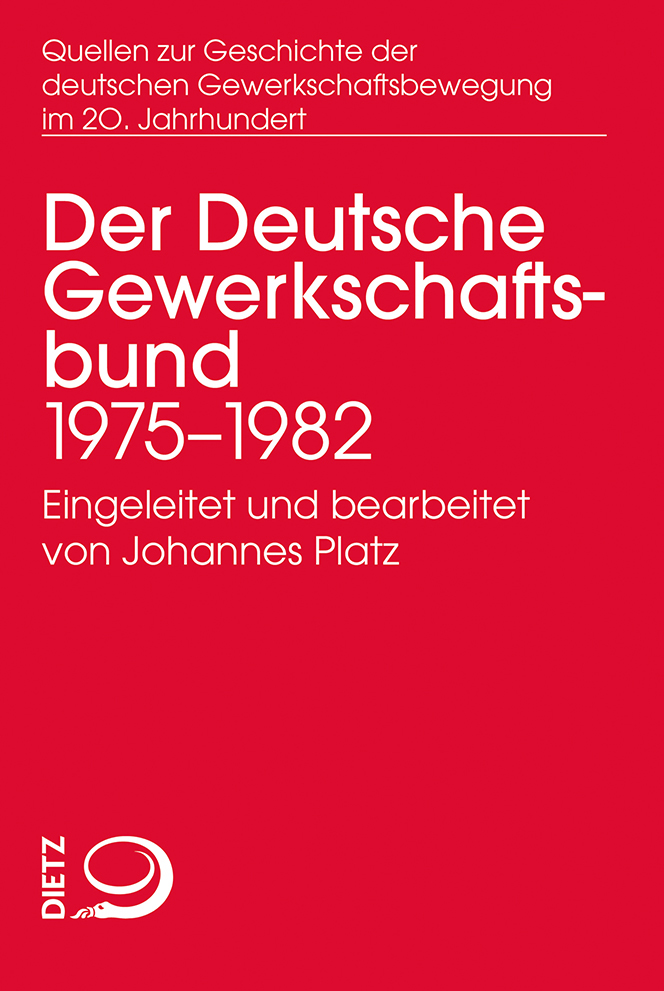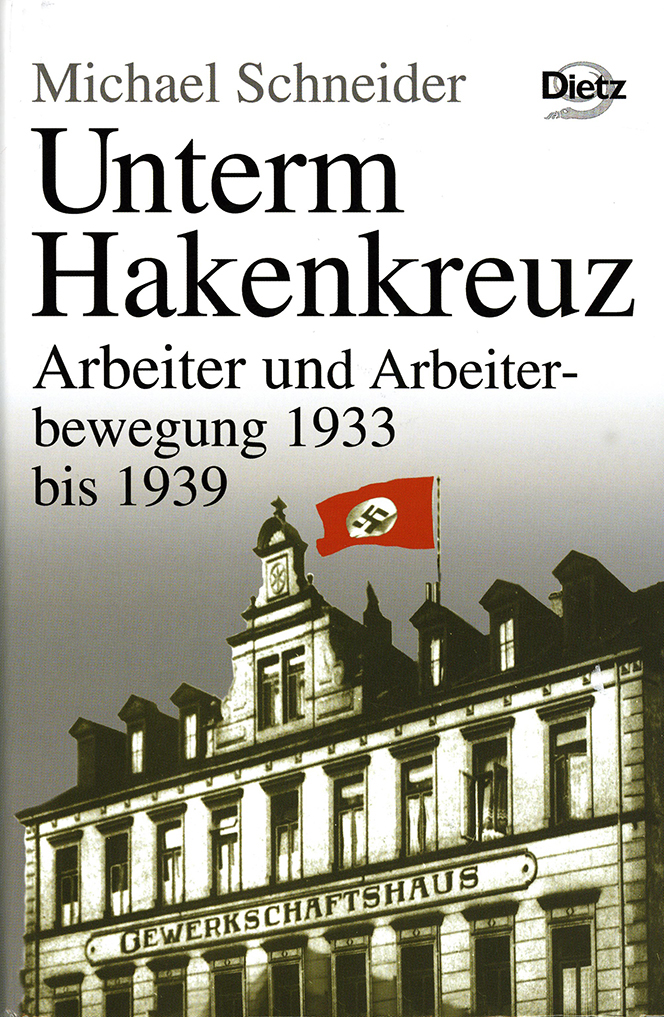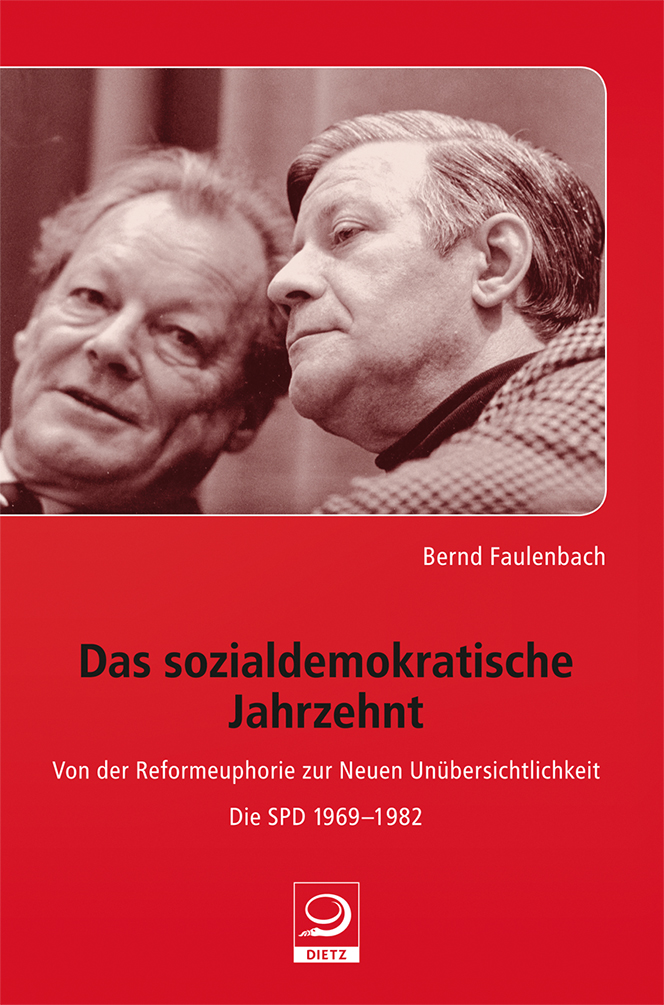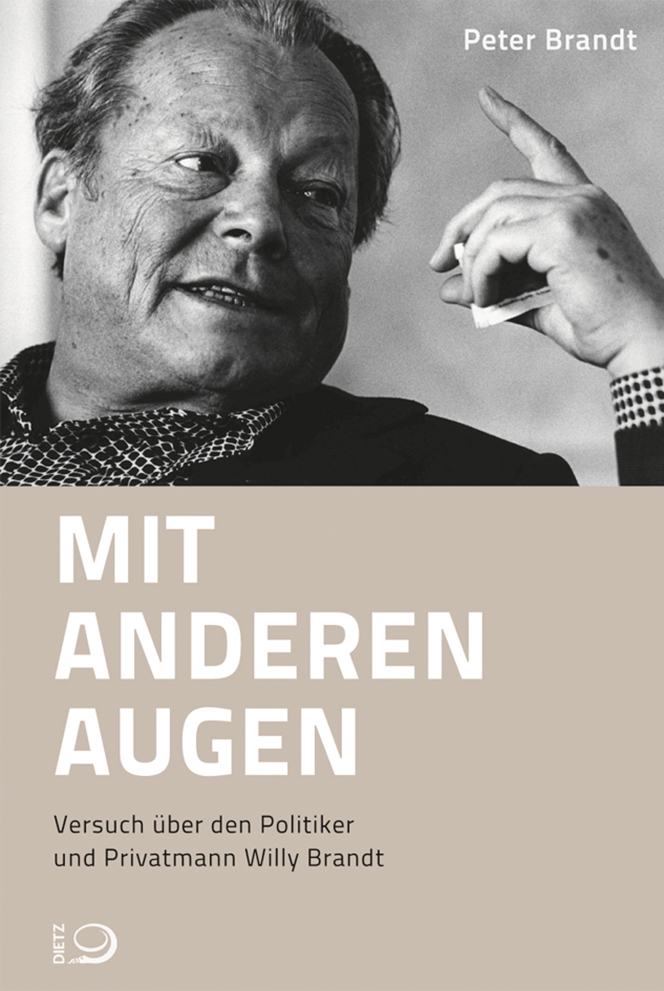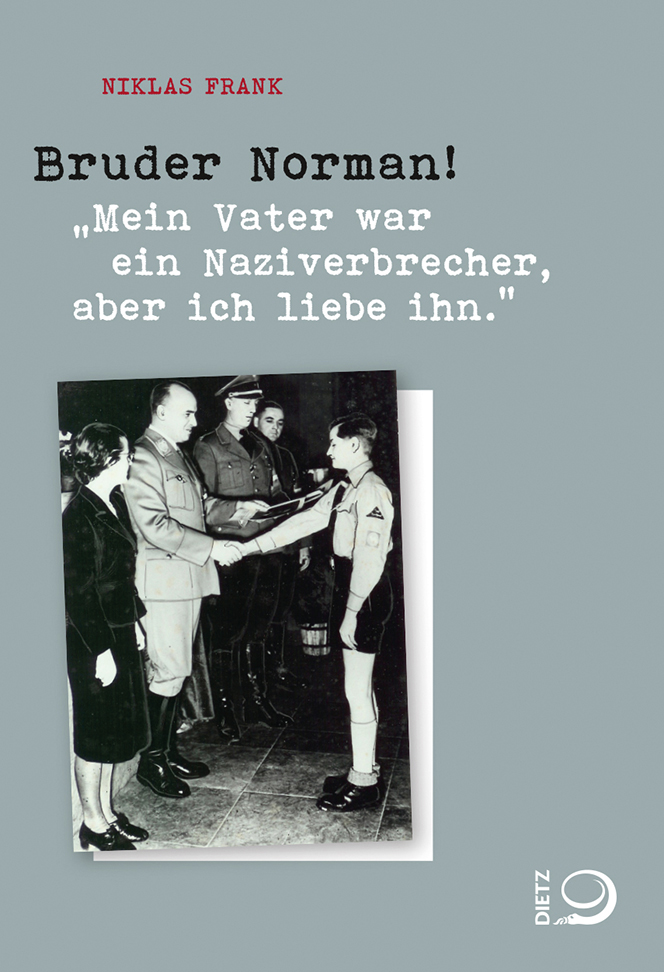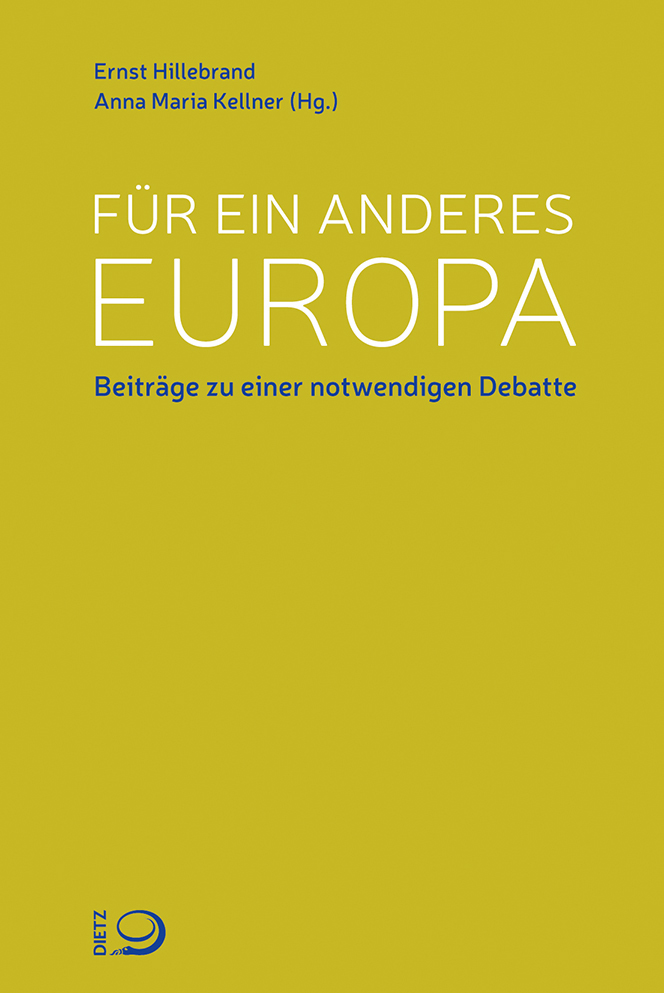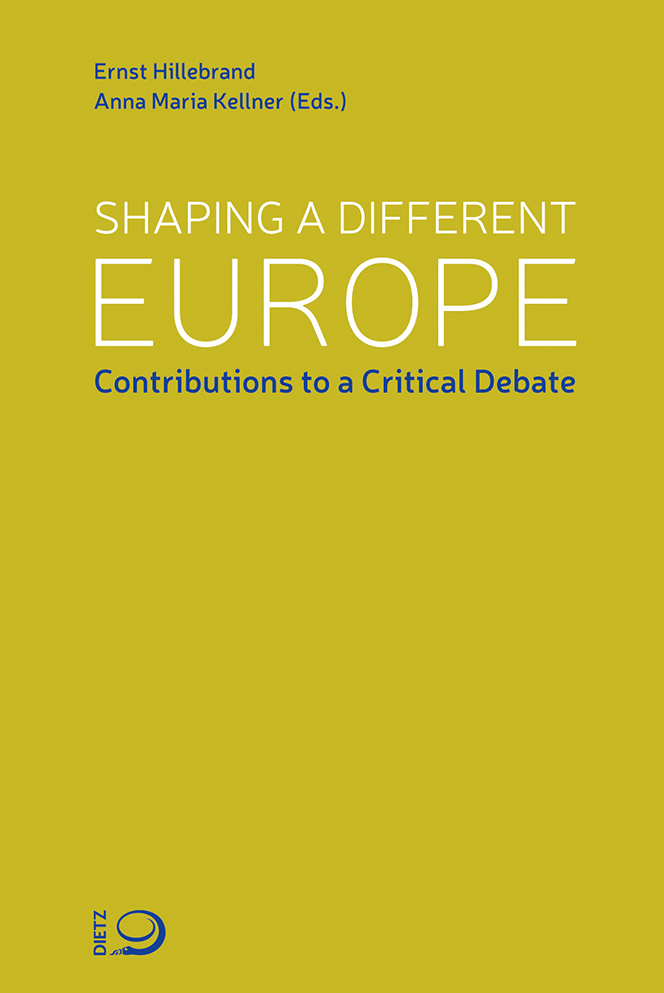Suchergebnis
Frank Decker / Ursula Bitzegeio / Philipp Adorf (Hg.)
Weltinnenpolitik zwischen Krise und Krieg
Zur Zukunft des Multilateralismus
Im vorliegenden Band werden die von Willy Brandt ausgehenden Impulse einer internationalen »Weltinnenpolitik« mit Blick auf heutige Herausforderungen kritisch beleuchtet. Müssen wir uns bei den aktuellen globalen Krisen vom Konzept eines »Wandel durch Annäherung« oder »Wandel durch Handel« abwenden? Die Autor_innen zeigen auf, dass es trotz neuer politischer Kräfteverhältnisse in der Welt und einer Zunahme von aggressivem Nationalismus geopolitische Szenarien gibt, bei denen die Abkehr vom bewährten Multilateralismus fatale Folgen hätte.
Peter Brandt / Martin Kirsch / Arthur Schlegelmilch (Hg.)
Handbuch der europäischen Verfassungsgeschichte im 19.Jahrhundert
Band 4: Um 1900
Alexander Trennheuser / Andreas Kost (Hg.)
Das direktdemokratische NRW
Wie Bürgerinnen und Bürger zwischen Rhein und Weser Politik mitgestalten
Aus Anlass des 80. Jahrestages der Gründung von Nordrhein-Westfalen und des 75-jährigen Jubiläums seiner Landesverfassung zieht dieser Band Bilanz: Wie hat sich die direkte Demokratie im größten deutschen Bundesland entwickelt? Und wie wird sie heute gelebt? Wie gestalten Bürgerinnen und Bürger Politik aktiv mit – trotz rechtlicher Hürden und politischer Vorbehalte? Andreas Kost und Alexander Trennheuser legen die erste Gesamtübersicht über direktdemokratische Verfahren auf Landes- und Kommunalebene in NRW vor.
Joanna Beata Michlic
Mit den Augen der Kinder
Familie, Krieg, Identität und Nationalität: Wie der Holocaust überlebende polnisch-jüdische Kinder und Jugendliche geprägt hat
Was hat der Holocaust in Kindern und Jugendlichen ausgelöst, die ihn überlebten? Die polnische Historikerin Joanna Beata Michlic versucht, Antworten zu finden. Sie widmet sich jener von der Forschung oft übersehenen Gruppe und legt eine »intime Sozialgeschichte« der jüngsten Überlebenden während und nach dem Holocaust vor. Im Zentrum steht der subjektive Blick der überlebenden Kinder aus Polen und Westeuropa, die Folgen ihrer traumatischen Erfahrungen für sich selbst, ihre Familien und ihr weiteres Leben.
Thomas Greven
Das internationale Netz der radikalen Rechten
Angriff auf die Demokratie in den USA und Europa
Zwischen den USA und Europa existieren potente, transnationale Netzwerke von Rechtspopulisten, Rechtsextremisten und radikalisierten Konservativen. Ihr Ziel: die westlichen Demokratien zu unterhöhlen, um eine autoritär-antiliberale, menschenfeindliche Agenda durchzusetzen. Thomas Greven zeigt, wie diese internationalen Netzwerke systematisch den Keil ihrer Ideen über das »richtige Volk« und erzwungene »Remigration« in die Mitte der Gesellschaft treiben oder den Kampf gegen »die Eliten« global organisieren.
Martina Klein / Klaus Schubert
Das Politiklexikon
Begriffe. Fakten. Zusammenhänge
Immer wieder neu, stets aktuell: Das bewährte Lexikon im Taschenbuchformat geht in seine 9., vollständig überarbeitete Auflage mit über 1.450 Stichwörtern und mehr als 50 übersichtlichen, nützlichen Tabellen und Grafiken sowie Karten zu Deutschland und Europa. Ein unentbehrliches Hilfsmittel für alle politisch interessierten und aktiven Leserinnen und Leser.
Siegfried Heimann
Die SPD in Ostberlin
Von 1945/46 bis zum August 1961 und danach
Die SPD in Ostberlin von 1945 bis zum Mauerbau und darüber hinaus ist ein bislang wenig beleuchtetes Kapitel deutscher Nachkriegsgeschichte. Siegfried Heimann zeichnet ihre Ost-Arbeit kenntnisreich nach. Trotz Repression durch die SED war die SPD bis 1961 in allen acht Ostberliner Stadtbezirken aktiv. Kurz nach dem Mauerbau beschloss der Landesverband die Auflösung seiner Ostberliner Kreisverbände. Doch ihren Anspruch, auch dort wieder politisch aktiv zu werden, gab die Partei nie auf.
Dieter Schenk / Witold Kułesza
Arthur Greiser
Ein Naziverbrecher und sein »Mustergau« in Polen
Arthur Greiser war einer der schlimmsten Kriegsverbrecher der Nazi-Zeit. Im September 1939 zum Gauleiter und Reichsstatthalter ernannt, wollte er aus der ehemaligen Provinz Preußen im Wartheland einen »Mustergau« machen. Heraus kam ein gigantomanisches Terrorsystem, das selbst nach NS-Maßstäben seinesgleichen suchte. Dieter Schenk und Witold Kułesza legen die erste Gesamtbiografie über Greiser vor und dokumentieren auch den Prozess gegen ihn, der 1946 mit seiner Hinrichtung endete.
Silke Ruth Laskowski
Wächter der Ungleichheit?
Verfassungsrechtliche Diskussion über wahlrechtliche Paritätsgesetze
Ein Rechtsgutachten
Herausgegeben für die Friedrich-Ebert-Stiftung von Ursula Bitzegeio und Stefanie Elies
Warum gibt es keine verpflichtenden Regelungen, die für ein ausgeglichenes Verhältnis von Frauen und Männern in deutschen Parlamenten sorgen? Thüringen und Brandenburg hatten sie eingeführt. Die Landesverfassungsgerichte kippten die Beschlüsse 2020 wieder. Dabei öffnet das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland einer verpflichtenden Parität in allen Parlamenten eigentlich Tür und Tor. Es regelt in Art. 3 Abs. 2, dass der Staat zur Verwirklichung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern in allen Rechts- und Lebensbereichen verpflichtet ist und bestehende Nachteile beseitigen muss. Für viele Juristinnen und Juristen sowie Politikerinnen und Politiker ergibt sich hieraus die Verpflichtung des Gesetzgebers, für eine Erhöhung des Frauenanteils in den Parlamenten zu sorgen. Seit einigen Jahren erreichen erste Klagen die Verfassungsgerichte – bislang noch ohne Erfolg.
Nicole Bögelein / Gina Rosa Wollinger
True Criminology
Mythen, Fakten, Hintergründe
Kriminalität ist beunruhigend und faszinierend zugleich. Die Soziologinnen Nicole Bögelein und Gina Rosa Wollinger öffnen uns eine Tür zu den wissenschaftlichen Erkenntnissen über Kriminalität. Wie unsicher ist unsere Gesellschaft? Wie ist die polizeiliche Statistik richtig zu lesen? Wird die Jugend wirklich immer brutaler? Was wissen wir über sexualisierte Gewalt? Gibt es Gruppen, die öfter kriminell sind als andere? Die Autorinnen klären auf – fundiert, verständlich und spannend zu lesen.
Peter Brandt
Sich ändern, um sich treu zu bleiben
Erinnerungen und Begegnungen
Wenn sich die politische Geschichte der Bundesrepublik seit den 1960er-Jahren in einer Biografie wiederfindet, dann in der des Intellektuellen, Historikers und bekennenden Sozialisten Peter Brandt – des 1948 geborenen ältesten Sohns von Willy Brandt. Früh ging er eigene Wege, war Teil der Protestbewegung der späten 1960er-Jahre, stand vor Gericht wegen Demonstrationsdelikten und schloss Freundschaft mit Rudi Dutschke. Der Abstand zu den Ansichten und der Politik des Vaters war deutlich. Doch die Verbindung zwischen beiden riss nie ab. Seit Mitte der 1970er-Jahre kamen sich Vater und Sohn politisch wieder näher.
Eva Gengler
Feministische KI
Warum Künstliche Intelligenz Ungerechtigkeit verstärkt und was wir dagegen tun müssen
Künstliche Intelligenz – kurz KI – beeinflusst, was wir konsumieren, wo wir arbeiten, wen wir lieben. In einer Welt, in der KI zunehmend unser Leben prägt, offenbart sich jedoch eine unbequeme Wahrheit: Diese Systeme sind nicht neutral. KI spiegelt gesellschaftliche Machtverhältnisse wider und automatisiert Vorurteile. Frauen, People of Color und andere marginalisierte Gruppen werden durch KI häufig benachteiligt, weil sie in einem System entsteht, das von kapitalistischen Interessen, patriarchalen Strukturen und kolonialen Praktiken geprägt ist. Wie eine alternative und feministische KI gestaltet und eingesetzt werden kann, um Ungerechtigkeiten aufzuheben, das zeigt Eva Gengler in diesem Buch.
Mahmoud Muna / Matthew Teller (Hg.)
Daybreak in Gaza
Geschichten über Leben und Kultur Palästinas
Aus dem Englischen übersetzt von Enrico Heinemann
Gaza war einst ein Ort voller Leben – geprägt von Menschlichkeit, Kreativität, kultureller Vielfalt und einer blühenden Industrie. Heute ist dieser Ort nahezu vollständig zerstört, seine Bevölkerung auf der Flucht vor endlosen Angriffen. Doch auch jetzt noch bewahren die Überlebenden von Gaza ihre Kultur durch Literatur, Musik, Kunst, Geschichten und Erinnerungen. Das Buch zeichnet dieses Erbe auf. Es ist ein bewegendes Zeitzeugnis über einen außergewöhnlichen Ort und seine Menschen. Künstler:innen, Ärzt:innen, Studierende, Bauern, Lehrkräfte, Akrobatinnen, Ladenbesitzer und viele mehr kommen zu Wort. Ihre Geschichten handeln von Liebe, Verlust, Angst und Hoffnung – und vom Überleben inmitten der Zerstörung.
Silke Ruth Laskowski
Wächter der Ungleichheit?
Verfassungsrechtliche Diskussion über wahlrechtliche Paritätsgesetze
Ein Rechtsgutachten
Herausgegeben für die Friedrich-Ebert-Stiftung von Ursula Bitzegeio und Stefanie Elies
Warum gibt es keine verpflichtenden Regelungen, die für ein ausgeglichenes Verhältnis von Frauen und Männern in deutschen Parlamenten sorgen? Thüringen und Brandenburg hatten sie eingeführt. Die Landesverfassungsgerichte kippten die Beschlüsse 2020 wieder. Dabei öffnet das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland einer verpflichtenden Parität in allen Parlamenten eigentlich Tür und Tor. Es regelt in Art. 3 Abs. 2, dass der Staat zur Verwirklichung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern in allen Rechts- und Lebensbereichen verpflichtet ist und bestehende Nachteile beseitigen muss. Für viele Juristinnen und Juristen sowie Politikerinnen und Politiker ergibt sich hieraus die Verpflichtung des Gesetzgebers, für eine Erhöhung des Frauenanteils in den Parlamenten zu sorgen. Seit einigen Jahren erreichen erste Klagen die Verfassungsgerichte – bislang noch ohne Erfolg.
eBook
Peter Brandt
Sich ändern, um sich treu zu bleiben
Erinnerungen und Begegnungen
Wenn sich die politische Geschichte der Bundesrepublik seit den 1960er-Jahren in einer Biografie wiederfindet, dann in der des Intellektuellen, Historikers und bekennenden Sozialisten Peter Brandt – des 1948 geborenen ältesten Sohns von Willy Brandt. Früh ging er eigene Wege, war Teil der Protestbewegung der späten 1960er-Jahre, stand vor Gericht wegen Demonstrationsdelikten und schloss Freundschaft mit Rudi Dutschke. Der Abstand zu den Ansichten und der Politik des Vaters war deutlich. Doch die Verbindung zwischen beiden riss nie ab. Seit Mitte der 1970er-Jahre kamen sich Vater und Sohn politisch wieder näher.
eBook
Nicole Bögelein / Gina Rosa Wollinger
True Criminology
Mythen, Fakten, Hintergründe
Kriminalität ist beunruhigend und faszinierend zugleich. Die Soziologinnen Nicole Bögelein und Gina Rosa Wollinger öffnen uns eine Tür zu den wissenschaftlichen Erkenntnissen über Kriminalität. Wie unsicher ist unsere Gesellschaft? Wie ist die polizeiliche Statistik richtig zu lesen? Wird die Jugend wirklich immer brutaler? Was wissen wir über sexualisierte Gewalt? Gibt es Gruppen, die öfter kriminell sind als andere? Die Autorinnen klären auf – fundiert, verständlich und spannend zu lesen.
eBook
Eva Gengler
Feministische KI
Warum Künstliche Intelligenz Ungerechtigkeit verstärkt und was wir dagegen tun müssen
Künstliche Intelligenz – kurz KI – beeinflusst, was wir konsumieren, wo wir arbeiten, wen wir lieben. In einer Welt, in der KI zunehmend unser Leben prägt, offenbart sich jedoch eine unbequeme Wahrheit: Diese Systeme sind nicht neutral. KI spiegelt gesellschaftliche Machtverhältnisse wider und automatisiert Vorurteile. Frauen, People of Color und andere marginalisierte Gruppen werden durch KI häufig benachteiligt, weil sie in einem System entsteht, das von kapitalistischen Interessen, patriarchalen Strukturen und kolonialen Praktiken geprägt ist. Wie eine alternative und feministische KI gestaltet und eingesetzt werden kann, um Ungerechtigkeiten aufzuheben, das zeigt Eva Gengler in diesem Buch.
eBook
Katharina Maria Meiser
Schule macht Demokratie
Impulse für eine neue Bildungskultur zwischen Autonomie, Leistung und Verantwortung
Bildung ist der Schlüssel zur Demokratie – doch das deutsche Bildungssystem steckt in alten Strukturen fest. Katharina Meiser sieht einen direkten Zusammenhang zwischen unserem dysfunktionalen Bildungssystem und der aktuellen Demokratiekrise. Daher fordert sie eine gänzlich neue Bildungskultur. Sie zeigt, warum Demokratiekompetenz nur dann entstehen kann, wenn Schulen Raum für Freiheit, Verantwortung, Autonomie und Solidarität bieten.
Harald Roth (Hg.)
Keine Zeit für Apathie, keine Zeit zu schweigen
Texte für eine weltoffene Demokratie
Die Demokratie steht unter Druck – von innen wie außen. Entschlossene Gegenwehr ist jetzt nötig, bevor es zu spät ist. Aber wie? Dieses Buch macht Mut, sich einzumischen, eigene Ideen einzubringen und Verantwortung zu übernehmen. Ob in Schule, Nachbarschaft oder digitalem Raum: Demokratie muss täglich gelebt, verteidigt und erneuert werden – von uns allen.
Toby Binder
#053KIDS
Im Duisburger Stadtteil Hochfeld leben mehr als die Hälfte aller Minderjährigen in Armut. Sie und ihre Familien stammen aus vielen verschiedenen Ländern – aber sie nutzen die Ziffern 053 der örtlichen Postleitzahl als Zeichen ihrer Zugehörigkeit. Das sind die 053-Kids. Der Fotograf Toby Binder hat Hochfelder Jugendliche über Jahre begleitet, ihren Alltag dokumentiert, ihr Leben sichtbar gemacht. Binder hat die Erfahrung sozialer Ungerechtigkeit, ihren Kampf um Identität, aber auch Freundschaft und Wünsche meisterhaft ins Bild gesetzt.
Bernd Weber
SPD und Kirchen im Wandel
Ausgrenzung und Annäherung seit dem Kaiserreich
Wie hielt es die SPD früher mit den christlichen Kirchen in Deutschland und wie hält sie es heute? Übersichtlich fasst Bernd Weber eine 160-jährige Geschichte zusammen, die feindselig begann, tiefe Fremdheit überwand und sich zu respektvoller Annäherung entwickelte.
Daniel Edmonds
The Story of our International Labour Movement
The world of work is transforming rapidly and threatens to erode hard-earned rights of working people. The international labour movement has seen it before. In fact, countless times has it been in the midst of the struggle for democracy, peace, inclusion and equality. »The story of Our International Labour Movement« traces back the origins, organisations and campaigns of workers’ organisations worldwide and how they have cooperated across borders. By taking a look inside and emphasizing the democratic nature of labour, Daniel Edmonds allows for a deep and global insight into a movement that has been the first and often last resistance of workers and continues to shape under which conditions we work today and tomorrow.
Nikolaos Gavalakis (Hg.)
Ideen Meinungen Kontroversen
IPG – Internationale Politik und Gesellschaft
Die wichtigsten Debatten 2025
Wie verändert die neue Nationale Sicherheitsstrategie der USA unter Donald Trump die geopolitische Architektur Europas? Gelingt es Europa, trotz Rechtsruck und wachsender Polarisierung handlungsfähig zu bleiben? Welche Perspektiven entstehen aus der neuen Dynamik zwischen BRICS+, den Golfstaaten und dem Globalen Süden? Kann die europäische Linke ihre verlorenen Wählergruppen zurückgewinnen – und wie? Wie zukunftsfähig ist Europas Wirtschaftsmodell im globalen Machtwettbewerb? Kann Europa seine Demokratien wirksam gegen digitale Einflussnahme schützen? Hält die Friedensvereinbarung zwischen Israel und der Hamas – und welche Rolle kann Europa künftig im Nahen Osten spielen? Gelingt es der EU, irreguläre Migration mit ihren neuen Maßnahmen tatsächlich zu reduzieren?
Hilde Nagell
Digital Revolution
How to Take Your Power and Freedom Back
Translated from Norwegian to English by Adam King
Every day, data is collected about how you live. This data is owned by large technology companies in the US and China. Google, Facebook, Amazon, and TikTok have become such a big part of society that important decisions are being moved from democratic assemblies to closed boardrooms. On the one hand, technology makes our lives more exciting and richer. At the same time, it can create economic disparities the world has never seen before. Technology companies are developing increasingly advanced forms of artifi cial intelligence that can solve key tasks, but also threaten our freedom more fundamentally than ever before in history.
Joanna Beata Michlic
Mit den Augen der Kinder
Familie, Krieg, Identität und Nationalität: Wie der Holocaust überlebende polnisch-jüdische Kinder und Jugendliche geprägt hat
Was hat der Holocaust in Kindern und Jugendlichen ausgelöst, die ihn überlebten? Die polnische Historikerin Joanna Beata Michlic versucht, Antworten zu finden. Sie widmet sich jener von der Forschung oft übersehenen Gruppe und legt eine »intime Sozialgeschichte« der jüngsten Überlebenden während und nach dem Holocaust vor. Im Zentrum steht der subjektive Blick der Kinder-Überlebenden aus Polen und Westeuropa, die Folgen ihrer traumatischen Erfahrungen für sich selbst, ihre Familien und ihr weiteres Leben.
eBook
Thomas Greven
Das internationale Netz der radikalen Rechten
Angriff auf die Demokratie in den USA und Europa
Zwischen den USA und Europa existieren potente, transnationale Netzwerke von Rechtspopulisten, Rechtsextremisten und radikalisierten Konservativen. Ihr Ziel: die westlichen Demokratien zu unterhöhlen, um eine autoritär-antiliberale, menschenfeindliche Agenda durchzusetzen. Thomas Greven zeigt, wie diese internationalen Netzwerke systematisch den Keil ihrer Ideen über das »richtige Volk« und erzwungene »Remigration« in die Mitte der Gesellschaft treiben oder den Kampf gegen »die Eliten« global organisieren.
eBook
Andreas Zick / Beate Küpper / Nico Mokros / Marco Eden (Hg.)
Die angespannte Mitte
Rechtsextreme und demokratiegefährdende Einstellungen in Deutschland 2024/25
Herausgegeben für die Friedrich-Ebert-Stiftung von Franziska Schröter
Krisen, Kriege und Konflikte, Verunsicherung und Vertrauensverlust, Populismus und Polarisierung: Liberale Demokratien wie Deutschland stehen weltweit unter Druck, neue und globale Herausforderungen an eine moderne Gesellschaft zu bewältigen und gleichzeitig ihren freiheitlich-pluralistischen Kern zu bewahren und zu verteidigen. Die Einfallstore für antidemokratische Kräfte und rechtsextreme Ideologien sind weit geöffnet. Sie finden auch und gerade Widerhall in der Mitte der Gesellschaft. Befindet sich die Demokratie an einem Kipppunkt?
Armin Pfahl-Traughber
Politische »Klassiker« der Neuen Rechten
Antidemokratische Denker aus der Weimarer Republik
Einflussreiche antidemokratische Denker gab es bereits in der Weimarer Republik. Dazu gehörten Edgar Julius Jung und Ernst Jünger, Arthur Moeller van den Bruck und Ernst Niekisch, Carl Schmitt und Oswald Spengler. Trotz mancher ideologischer Differenzen – agitiert gegen die liberale Demokratie haben sie alle. Aufklärung und Individualität, Menschenrechte und Pluralismus lehnte man mit großer Wortgewalt ab. Auch heute noch gibt es Anhänger dieser »Klassiker«, insbesondere bei den intellektuellen Rechtsextremisten der Neuen Rechten. Blickt man auf die Autoren, offenbaren sich antidemokratische Gesinnungen, frei nach dem Motto: »Sage mir, auf wen Du dich berufst und ich sage Dir, wo Du stehst.«
Der Mittelstand. BVMW e. V. (Hg.)
Aufbruch Mittelstand
Eine Zukunftsvision für die deutsche Wirtschaft
Die deutsche Wirtschaft steht an einem Wendepunkt. Globale Krisen, geopolitische Umbrüche und strukturelle Herausforderungen setzen den Mittelstand unter Druck. Dieses Buch analysiert die drängendsten Probleme und zeigt konkrete Wege auf, um Deutschlands wirtschaftliche Zukunft nachhaltig zu sichern. Ein fundierter Weckruf für Unternehmer:innen, politische Entscheidungsträger:innen und die gesamte Gesellschaft.
Souad Lamroubal
Die Demokratie der anderen
Was der Kampf um Zugehörigkeit mit uns macht
Der Wunsch nach Zugehörigkeit in einer Demokratie prägt viele Menschen. Aber für wen ist wirklich Platz in unserer Gesellschaft? Steht sie allen offen oder nur Menschen, die sich anpassen und bereit sind, ihre kulturellen Werte über Bord zu werfen und einer diffusen Vorstellung vom »Deutsch-Sein« zu entsprechen? Viele werden in ihrem mühevollen Kampf um Akzeptanz und Gleichberechtigung regelmäßig abgewiesen. Über die Eintrittskarte zur Demokratie entscheiden »die anderen«.
Institut für die Geschichte und Zukunft der Arbeit (IGZA) (Hg.)
Von der Kriegs- zur Friedenstüchtigkeit
Analysen und Materialien zur Geschichte und Zukunft von Krieg und Frieden
Angesichts anhaltender Kriege und neuer Blockkonfrontationen scheint es, als könne die Menschheit der Geißel Krieg nicht entkommen. Der Ruf nach Abschreckung und 'Kriegstüchtigkeit' dominiert, die weltweiten Militärausgaben erreichen neue Rekordwerte.
Friedrich-Ebert-Stiftung (Hg.)
Archiv für Sozialgeschichte, Bd. 65 (2025)
Partizipation und Repräsentation
Eine demokratische Liebesgeschichte?
Moderne Demokratien streben die Herrschaft »des Volkes« durch politische und soziale Teilhabe an. Gleichzeitig wird die alltägliche Machtausübung an Parteien und einzelne Personen delegiert, die den Volkswillen repräsentativ vertreten sollen. Ihren Einfluss machen die Vielen vor allem bei der Wahl ihrer Vertretungen und bei Abstimmungen oder Referenden über einzelne Sachfragen geltend. Dazu artikulieren Interessengruppen, Protestbewegungen, Expert:innen und Einzelne ihre Anliegen durch nichtrepräsentative Praktiken der Partizipation.
Armin Pfahl-Traughber
Politische "Klassiker" der Neuen Rechten
Antidemokratische Denker aus der Weimarer Republik
Einflussreiche antidemokratische Denker gab es bereits in der Weimarer Republik. Dazu gehörten Edgar Julius Jung und Ernst Jünger, Arthur Moeller van den Bruck und Ernst Niekisch, Carl Schmitt und Oswald Spengler. Trotz mancher ideologischer Differenzen – agitiert gegen die liberale Demokratie haben sie alle. Aufklärung und Individualität, Menschenrechte und Pluralismus lehnte man mit großer Wortgewalt ab. Auch heute noch gibt es Anhänger dieser »Klassiker«, insbesondere bei den intellektuellen Rechtsextremis-ten der Neuen Rechten. Blickt man auf die Autoren, offenbaren sich antidemokratische Gesinnungen, frei nach dem Motto: »Sage mir, auf wen Du dich berufst und ich sage Dir, wo Du stehst.«
eBook
Souad Lamroubal
Die Demokratie der anderen
Was der Kampf um Zugehörigkeit mit uns macht
Der Wunsch nach Zugehörigkeit in einer Demokratie prägt viele Menschen. Aber für wen ist wirklich Platz in unserer Gesellschaft? Steht sie allen offen oder nur Menschen, die sich anpassen und bereit sind, ihre kulturellen Werte über Bord zu werfen und einer diffusen Vorstellung vom »Deutsch-Sein« zu entsprechen? Viele werden in ihrem mühevollen Kampf um Akzeptanz und Gleichberechtigung regelmäßig abgewiesen. Über die Eintrittskarte zur Demokratie entscheiden »die anderen«.
eBook
Alexander Hagelüken
Die Ökonomie des Hasses
Wie Rechte von Trump bis AfD unseren Wohlstand zerstören und wie man ihre Wähler zurückholt
Rechtspopulist:innen von Donald Trump bis Alice Weidel locken die Wähler:innen mit Anti-Politik. Sie agitieren gegen Freihandel, EU, Migrant:innen, demokratische Institutionen und Klimaschutz. Doch ihre »Ökonomie des Hasses« zerstört den Wohlstand und verschlechtert das Leben aller, wie die Welt seit der Wahl von Donald Trump täglich erleben muss: Handel und Wirtschaft schrumpfen drastisch, Pflegekräfte fehlen, wo Migration verhindert wird, ohne Institutionen kollabiert die Demokratie und ohne Klimaschutz der Planet.
Ernst Hillebrand (Hg.)
Rechtspopulismus in Europa
Der Einfluss rechter Parteien von Lissabon bis Bukarest
3. aktualisierte und erweiterte Auflage
In Europa feiern rechtspopulistische Parteien große Erfolge bei Wahlen. In immer mehr Ländern sind sie an der Regierung beteiligt. Wer sind sie? Wer führt sie? Was für Ziele haben sie? Das Buch gibt einen Überblick – von Finnland bis Italien, von Portugal bis Rumänien. Kurze und präzise Länderporträts werden durch Texte ergänzt, die nach den Ursachen und der Dynamik des Rechtspopulismus fragen, nach den Motiven seiner Wählerschaft und nach den Möglichkeiten, mit diesem politischen Phänomen umzugehen.
Matthias Meisner / Paul Starzmann
Mut zum Unmut
Eine Anleitung zur politischen Widerspenstigkeit
Es gibt eine gute Kraft der Renitenz! Und wir brauchen sie gerade jetzt, wo negative Nachrichten und Resignation alles zu dominieren scheinen. Dieses Buch hat einen erfrischenden Ansatz: Es plädiert dafür, aktiv zu werden, die Gleichgültigkeit abzulegen, »Nein!« zu sagen, anzuecken – im Job, auf der Straße und in der Politik. Die Autoren finden dafür viele prominente Beispiele von Menschen, die unbequem sind, aufbegehren und ihre Finger absichtlich in Wunden legen wie Petra Kelly, Kevin Kühnert, Werner Schulz, Marco Wanderwitz, Kristina Hänel, Anne Wizorek, Marie von Kuck, Heidi Reichinnek u. v. a.
Matthias Meisner / Paul Starzmann
Mut zum Unmut
Eine Anleitung zur politischen Widerspenstigkeit
Es gibt eine gute Kraft der Renitenz! Und wir brauchen sie gerade jetzt, wo negative Nachrichten und Resignation alles zu dominieren scheinen. Dieses Buch hat einen erfrischenden Ansatz: Es plädiert dafür, aktiv zu werden, die Gleichgültigkeit abzulegen, »Nein!« zu sagen, anzuecken – im Job, auf der Straße und in der Politik. Die Autoren finden dafür viele prominente Beispiele von Menschen, die unbequem sind, aufbegehren und ihre Finger absichtlich in Wunden legen wie Petra Kelly, Kevin Kühnert, Werner Schulz, Marco Wanderwitz, Kristina Hänel, Anne Wizorek, Marie von Kuck, Heidi Reichinnek u. v. a.
eBook
Alexander Hagelüken
Die Ökonomie des Hasses
Wie Rechte von Trump bis AfD unseren Wohlstand zerstören
und wie man ihre Wähler zurückholt
Rechtspopulist:innen von Donald Trump bis Alice Weidel locken die Wähler:innen mit Anti-Politik. Sie agitieren gegen Freihandel, EU, Migrant:innen, demokratische Institutionen und Klimaschutz. Doch ihre »Ökonomie des Hasses« zerstört den Wohlstand und verschlechtert das Leben aller, wie die Welt seit der Wahl von Donald Trump täglich erleben muss: Handel und Wirtschaft schrumpfen drastisch, Pflegekräfte fehlen, wo Migration verhindert wird, ohne Institutionen kollabiert die Demokratie und ohne Klimaschutz der Planet.
eBook
Ernst Hillebrand (Hg.)
Rechtspopulismus in Europa
Der Einfluss rechter Parteien von Lissabon bis Bukarest
3. aktualisierte und erweiterte Auflage
In Europa feiern rechtspopulistische Parteien große Erfolge bei Wahlen. In immer mehr Ländern regieren sie. Wer sind sie? Wer führt sie? Was für Ziele haben sie? Das Buch gibt einen Überblick – von Finnland bis Italien, von Portugal bis Rumänien. Kurze und präzise Länderporträts werden durch Texte ergänzt, die allgemein nach den Ursachen des Rechtspopulismus fragen, nach den Motiven seiner Wählerschaft, nach seinem Europabild und seiner Verbreitung über Europa hinaus.
eBook
Klara Niemann / Laura Valentini / Katja Wollenberg
Jupp Darchinger
Das Auge der Republik
Herausgegeben für die Friedrich-Ebert-Stiftung von Anja Kruke und für das LVR-Landesmuseum von Thorsten Valk
Mit zahlreichen Schwarz-Weiß-Abbildungen
Der Fotojournalist Josef Heinrich (Jupp) Darchinger (1925–2013) begleitete wie kein zweiter die Akteur:innen und gesellschaftlichen Entwicklungen der Bonner Republik. Als kritischer Chronist prägte er das visuelle Gedächtnis dieser Epoche – vom Wirtschaftswunder der Adenauer-Ära bis zum wiedervereinigten Deutschland. Seine Aufnahmen von Persönlichkeiten wie Willy Brandt und Helmut Schmidt sind Ikonen der Zeitgeschichte.
Thomas Hartmann-Cwiertnia / Jochen Dahm / Frank Decker (Hg.)
Freiheit. Gleichheit. Vertrauen.
Was unsere Demokratie jetzt braucht
In einer Welt, die sich massiv wandelt und von radikalen politischen Umbrüchen gezeichnet ist, wird die Frage »Wie sieht die Zukunft der Demokratie aus?« dringlicher denn je. Dieser Band versammelt prominente Stimmen aus Politik, Gesellschaft und Wissenschaft, die ihre Ideen und Gedanken zum Zustand und zu den Perspektiven des liberalen demokratischen Systems einbringen.
Gabriele Bergfeld / Christina Schulz zur Wiesch / Corinna Maßmann
Mevlüde bleibt!
Die wahre Geschichte einer Frau, die Rassismus mit Liebe und Versöhnung begegnet
Mit Illustrationen von Emma Schneider
Zugang zu den **Materialien zum Buch für Lehrkräfte** erhalten Sie [**hier**](https://dietz-verlag.de/downloads/Mevluede_Lehrmaterial.pdf). Wie spricht man mit seinen Kindern über Rassismus? Dieses einzigartige Buch hilft Ihnen dabei. Im Jahr 1993 erschütterte ein rechtsextremer Brandanschlag in Solingen das Land. Eine grausame Tat, bei der Mevlüde Genç zwei Töchter, zwei Enkelinnen und eine Nichte verlor. Doch trotz des unermesslichen Leids, das ihr widerfuhr, rief sie immer wieder zu Frieden und Versöhnung auf. Mevlüde Genç starb am 30.10.2022, kurz vor ihrem 80. Geburtstag. Wer war diese außergewöhnliche Frau und was hat sie uns bis heute zu sagen?
Mareen Heying / Alexandra Jaeger / Nina Kleinöder / Sebastian Knoll-Jung / Sebastian Voigt (Hg.)
Verschwiegener Alltag
Gewalt am Arbeitsplatz seit dem 19. Jahrhundert
Gewalt am Arbeitsplatz war und ist allgegenwärtig. Sie wurde hinter Fabriktoren, Bürotüren oder in Haushalten oft nicht sichtbar, verharmlost oder tabuisiert. Die Gewaltformen, ihre Wahrnehmung und ihre Rahmenbedingungen haben sich seit dem 19. Jahrhundert verändert. Der Band gibt einen Einblick in Wandel und Kontinuitäten, Akteursgruppen und die gesellschaftlichen Verhältnisse, die die Gewalt ermöglichten.
Wirtschaftsforum der SPD e. V. (Hg.)
Visionomics
Fünf Säulen für Wohlstand in einer unsicheren Welt
Das Bruttoinlandsprodukt gerät als Wohlstandsindikator in Zeiten multipler Krisen an seine Grenzen. Wie lässt sich unser Wohlstand angesichts solcher Krisen langfristig sichern? Klar ist, dieses Problem kann nicht allein gedacht werden. Die wirtschaftlichen, sozialen, ökologischen, geopolitischen und demokratischen Aspekte müssen zusammengedacht werden, um ein stabiles Fundament für Deutschlands Wirtschaft und Gesellschaft zu schaffen.
Peter Seibert
Die Niederschlagung des Bauernkriegs 1525
Beginn einer deutschen Gewaltgeschichte
Die brutale Niederschlagung des Bauernkriegs war der Anfang einer langen Geschichte rücksichtsloser Gewalt der deutschen Obrigkeiten: von den autoritären Feudalstaaten der frühen Neuzeit über Preußen bis in die NS-Diktatur. 1525 begann Deutschlands Weg in die Untertanengesellschaft, woran auch Martin Luther seinen Anteil hatte. Die entfesselte Gewalt deutscher Herren gegen ihre Untertanen und gegen frühe Forderungen demokratischer Teilhabe legte den Keim für eine Tradition der Unfreiheit und Unterdrückung.
Claudia Kneifel
Verliebt, vertraut, verrechnet
Erfolgreiche Altersvorsorge für Frauen ab 50
»Von meiner Rente alleine könnte ich nicht leben. Im Falle einer Scheidung rutsche ich in die Altersarmut.« In der Tat: Viele Frauen haben für ihr Alter nicht ausreichend finanziell vorgesorgt. Doch auch mit 50+ ist es nicht zu spät, die Altersvorsorge in den Griff zu bekommen. In zehn Strategien erklärt Claudia Kneifel, wie das geht und an welchen Stellschrauben Frauen rechtzeitig drehen sollten.
Peter Kirsten
Gefährten der Atombombe
Klaus Fuchs und Carl Friedrich von Weizsäcker. Zwei Physiker im Sog des nuklearen Wettrüstens
Zwei Wissenschaftler, zwei politische Systeme, ein Auftrag: die Entwicklung der Bombe. Die Biografien von Klaus Fuchs und Carl Friedrich von Weizsäcker lassen das düstere Panorama einer gespaltenen Epoche aufscheinen, in der zwei Physiker zu tragenden Akteuren in einem Wettlauf um die mächtigste Waffe der Geschichte werden – und zu Schlüsselfiguren in rivalisierenden Lagern.
Peter Seibert
Die Niederschlagung des Bauernkriegs 1525
Beginn einer deutschen Gewaltgeschichte
Die brutale Niederschlagung des Bauernkriegs war der Anfang einer langen Geschichte rücksichtsloser Gewalt der deutschen Obrigkeiten: von den autoritären Feudalstaaten der frühen Neuzeit über Preußen bis in die NS-Diktatur. 1525 begann Deutschlands Weg in die Untertanengesellschaft, woran auch Martin Luther seinen Anteil hatte. Die entfesselte Gewalt deutscher Herren gegen ihre Untertanen und gegen frühe Forderungen demokratischer Teilhabe legte den Keim für eine Tradition der Unfreiheit und Unterdrückung.
eBook
Claudia Kneifel
Verliebt, vertraut, verrechnet
Erfolgreiche Altersvorsorge für Frauen ab 50
»Von meiner Rente alleine könnte ich nicht leben. Im Falle einer Scheidung rutsche ich in die Altersarmut.« In der Tat: Viele Frauen haben für ihr Alter nicht ausreichend finanziell vorgesorgt. Doch auch mit 50+ ist es nicht zu spät, die Altersvorsorge in den Griff zu bekommen. In zehn Strategien erklärt Claudia Kneifel, wie das geht und an welchen Stellschrauben Frauen rechtzeitig drehen sollten.
eBook
Michèle Auga
The Big Change?
Großbritanniens Exit aus dem Populismus
Der Laborversuch »Brexit« ist gescheitert. Und jetzt? Mit Hochachtung vor einer 800 Jahre alten Demokratie resümiert Michèle Auga die jüngste Zeitgeschichte des Vereinigten Königreichs. Ihr Fazit: Populismus lohnt sich nicht. Mit Hilfe neuer Akteure wie Keir Starmer oder David Lammy entsteht das Bild eines Landes, das begonnen hat, sich am eigenen Schopf aus dem populistischen Sumpf zu ziehen und den Krisenmodus zu verlassen. Willkommen zurück in Europa, lieber Nachbar Großbritannien!
Beate Eckstein / Franziska Richter / Peter Pfister (Hg.)
Do you have something to fight for?
100 Jahre Fördern und Gestalten
Die wechselvolle 100-jährige Geschichte der Friedrich-Ebert-Stiftung und deren Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität spiegeln sich auf eine besondere Weise in ihrer Kunstsammlung wider. Anhand verschiedener Themenfelder – wie Arbeiter:innenbewegung, Krieg, Repression und Vertreibung, Kollektives Wissen oder Proteste und Umbrüche – präsentieren wir anlässlich des Jubiläums eine kuratierte Auswahl der Sammlung im Dialog mit zeitgenössischen Positionen (ehemaliger) Kunststipendiat:innen. Historisch bedingte Leerstellen wie eine geringere Anzahl an Künstlerinnen oder porträtierter Politikerinnen werden von aktuellen künstlerischen Arbeiten reflektiert und besetzt.
Michèle Auga
The Big Change?
Großbritanniens Exit aus dem Populismus
Der Laborversuch »Brexit« ist gescheitert. Und jetzt? Mit Hochachtung vor einer 800 Jahre alten Demokratie resümiert Michèle Auga die jüngste Zeitgeschichte des Vereinigten Königreichs. Ihr Fazit: Populismus lohnt sich nicht. Mit Hilfe neuer Akteure wie Keir Starmer oder David Lammy entsteht das Bild eines Landes, das begonnen hat, sich am eigenen Schopf aus dem populistischen Sumpf zu ziehen und den Krisenmodus zu verlassen. Willkommen zurück in Europa, lieber Nachbar Großbritannien!
eBook
Friedrich-Ebert-Stiftung (Hg.)
100 Jahre, 100 Orte, 100 Rezepte
Ein internationales Kochbuch der Friedrich-Ebert-Stiftung
Die Friedrich-Ebert-Stiftung wird 100 Jahre. In diesem Kochbuch finden Sie 100 regionale Rezepte aus 100 Standorten weltweit. Jedes der Rezepte wird von einem »Tischgespräch« begleitet. Hier erfahren Sie, wie diese vielen unterschiedlichen Gerichte kulinarischen Genuss mit einer starken Demokratie und einer solidarischen Gesellschaft verbinden.
Daniela Rüther
Die Sex-Besessenheit der AfD
Rechte im 'Genderwahn'
Ist die AfD sexbesessen? Es sieht so aus! Unablässig trägt die rechtsautoritäre Partei die Themen Sexualität und Geschlechtlichkeit in die Parlamente und in die Öffentlichkeit. Es geht um »Volks«-Vermehrung und Geburtenzahlen, Homosexualität, Transsexualität, Sexualaufklärung, Geschlechterforschung und geschlechtergerechte Sprache. Gestützt auf gründliche Recherchen, die neues und bislang unbekanntes Material zutage gefördert haben, wird deutlich, dass die AfD eine völkisch-nationalistische Familien- und Bevölkerungspolitik verfolgt, die auf NS-Konzepte zurückgeht.
Nikolaos Gavalakis (Hg.)
Ideen, Meinungen, Kontroversen
IPG – Internationale Politik und Gesellschaft
Die wichtigsten Debatten 2024
Welche wirtschaftlichen Folgen hat die wachsende Rivalität zwischen den USA und China für Europa? Wie entwickelt sich der Krieg in der Ukraine weiter und welche Rolle spielen diplomatische Bemühungen bei einer möglichen Konfliktlösung? Gelingt es der EU mit dem Migrations- und Asylpakt den Herausforderungen im Asyl- und Migrationsbereich effektiv entgegenzutreten? Wie kann der Siegeszug rechtspopulistischer Parteien gestoppt werden? Können die BRICS-Staaten durch die Erweiterung ihrer Allianz ihren globalen Einfluss ausbauen? Gibt es realistische Perspektiven für eine diplomatische Lösung im Nahostkonflikt und welche Akteure spielen dabei eine Schlüsselrolle? Wie sieht die Zukunft Syriens nach dem Sturz von Assad aus? Welche Konsequenzen wird die Wahl von Donald Trump auf die internationale Politik haben?
Walter Mühlhausen
Friedrich Ebert 1871–1925
Reichspräsident der Weimarer Republik
3., durchgesehene und überarbeitete Auflage
Friedrich Ebert (1871–1925) zählt als SPD-Vorsitzender von 1913 bis 1919, als Wegbereiter in die Demokratie 1918/19 und als erster Reichspräsident von 1919 bis zu seinem frühen Tod 1925 zu den herausragenden Persönlichkeiten der deutschen Demokratiegeschichte im 20. Jahrhundert. Er prägte die Politik seiner Zeit, sah sich als Beauftragter des ganzen deutschen Volkes und nutzte seine Gestaltungsmöglichkeiten zur Stabilisierung der jungen Republik.
Daniela Rüther
Die Sex-Besessenheit der AfD
Rechte im 'Genderwahn'
Ist die AfD sexbesessen? Es sieht so aus! Unablässig trägt die rechtsautoritäre Partei die Themen Sexualität und Geschlechtlichkeit in die Parlamente und in die Öffentlichkeit. Es geht um »Volks«-Vermehrung und Geburtenzahlen, Homosexualität, Transsexualität, Sexualaufklärung, Geschlechterforschung und geschlechtergerechte Sprache. Gestützt auf gründliche Recherchen, die neues und bislang unbekanntes Material zutage gefördert haben, wird deutlich, dass die AfD eine völkisch-nationalistische Familien- und Bevölkerungspolitik verfolgt, die auf NS-Konzepte zurückgeht.
eBook
Manfred Schneider (Hg.)
Geschichten, die die Wende schrieb
Biografien, Erzählungen, Interviews
Noch heute, fast 35 Jahre nach der »Wende«, wird darüber gestritten, welche Konzepte die richtigen gewesen wären, um zu vermeiden, dass es »Verlierer« und »Sieger« gibt. Welche Überlegungen, Strategien, Programme und Projekte gab es damals, und was ist aus ihnen geworden? Welche biografischen Erfahrungen wurden in je unterschiedlicher Weise in Ost und West gemacht?
Patrick Diamond / Ania Skrzypek (Hg.)
The Politics of Polycrisis
Transforming Social Democracy in Europe
To respond to the rising challenges of insecurity and inequality that plagued advanced capitalist countries in recent years, social democratic parties urgently need a new intellectual paradigm. Forging new ideas means being prepared to enter into dialogue with other political traditions. Overcoming political paralysis necessitates moving radically beyond stale and out of date »tax-and-spend« solutions to the economic and social problems of our age. That means forging a new approach to market capitalism that tackles concentrations of corporate and market power, governing in the public interest. It is essential to cultivate institutions between the traditional state and the free market that provide community attachment, respect for traditional roles, and a sense of mutual obligation. To find a path back to power, social democrats must combine a forward-looking agenda for inclusive prosperity with protecting the pillars of securitythat give meaning to our lives in an era of unprecedented instability and upheaval.
Gerhard Stahl
China: Dangerous rival or cooperation partner?
How can EU–China relations develop in a changing world with geopolitical conflicts?
In today’s world, China has become an important player vis-à-vis the European Union. This publication provides knowledge and considerate recommendations that constitute a valuable contribution to the development of a European strategy for China. It is an invitation to study China’s economic and political development based on facts, and different opinions of people in business, politics, and academia. It looks into history, economic competition, and the reasons and consequences of geopolitical confrontation. With his methodical approach and his experience as a visiting professor in China for the past ten years, Gerhard Stahl presents the current assets and challenges of this empire. What about the EU, the main trade and economic partner of China? Are we partners or rivals, or both? This book is not only a theoretical analysis, it is a convincing plea for international cooperation to solve global problems like climate change and underdevelopment.
Bibliothek im Archiv der sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung (Hg.)
Bibliographie zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung
Jahrgang 48 (2023)
Die Bibliographie zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung erfasst alle Publikationen zur Geschichte der Arbeiter- und Frauenbewegung, (linken) Parteien, Bewegungen und Gewerkschaften aus dem Jahr 2023.
Mike Schmeitzner / Thilo Scholle (Hg.)
Hermann Heller, die Weimarer Demokratie und der soziale Rechtsstaat
Hermann Heller (1891–1933) war ein bedeutender Vordenker der sozialen Demokratie und Verteidiger der Weimarer Republik. Die Beiträge im vorliegenden Band thematisieren sowohl den Verfassungsdenker und Analytiker des aufkommenden Faschismus und Nationalsozialismus als auch den wehrhaften Demokraten und politischen Bildner. Heller wird hier in der ganzen Breite seines Engagements und auch mit Blick auf aktuelle Herausforderungen reflektiert.
Julia Jirmann
Blackbox Steuerpolitik
Wie unser Steuersystem Ungleichheit fördert. Ein Reformvorschlag
In kaum einer anderen westlichen Demokratie sind Vermögen so ungleich verteilt wie in Deutschland. Wir sind ein Hochsteuerland für mittlere Arbeitseinkommen, aber ein Niedrigsteuerland für Vermögende. Wie kann das sein? Ist das gerecht? Warum haben Superreiche geringere Steuer- und Abgabensätze als der Durchschnitt hierzulande? Und wie bekommen wir es hin, dass unser Steuersystem allen dient?
Martin Hecht
Das geschmeidige Ich
Die Gesellschaft der Selbstdarsteller
Wir alle sind Meister der Verstellung. Das ist gar nicht verwerflich. Schein statt Sein ist etwas zutiefst Menschliches. Was aber, wenn das Klima in der offenen Gesellschaft rauer wird? Alle treten gegen alle an. Unsere Formen der sozialen Verwandlung folgen oft nur noch Strategien um mehr Macht und Influence. »Soziale Geschmeidigkeit« ist das neue Kapital und die Schlüsseltugend unserer Zeit. Wer darüber verfügt, feiert Erfolge, wer nicht, wird zum Verlierer.
Michael Braun
Von Berlusconi zu Meloni
Italiens Weg in den Postfaschismus
Im Jahr 2022 wählte Italien Giorgia Meloni an die Macht. Der große Erfolg der neuen extrem rechten Regierungschefin, die nie ein böses Wort über Mussolini verlor und einen neuen »italienischen Stolz« propagiert, kam keineswegs aus dem Nichts. Der windige Medientycoon und Politiker Silvio Berlusconi bereitete Italien über 30 Jahre einen konsequenten Weg in den Postfaschismus. Die Popularität harter rechter Politiker:innen wuchs und ist bis heute ungebrochen. Wie lässt sich das erklären? Was heißt das für Italiens Demokratie? Wie wirkt sich das auf die Zukunft Europas aus?
Hella Rottenberg / Sandra Rottenberg
Isay Rottenbergs Zigarrenfabrik
Wie ein niederländisch-jüdischer Unternehmer in Sachsen den Nazis die Stirn bot
Übersetzt aus dem Niederländischen von Christina Siever
Isay Rottenberg, ein Unternehmer aus Amsterdam, kauft 1932 im sächsischen Döbeln bei Dresden die Deutschen Zigarrenwerke. Mit maschinellen Produktionsmethoden saniert er den wirtschaftlich angeschlagenen Großbetrieb mitten im Dritten Reich. Die arische Konkurrenz schäumt. Doch solange der Jude Rottenberg vielen Hundert Menschen in schwierigen Zeiten Arbeit gibt, schaffen es selbst eingefleischte Nazis nicht, ihn zu vertreiben. Mit Mut und Beharrlichkeit kann er bis 1935 durchhalten.
Stephan Rammler
Klimabauhaus Berlin
Die adaptive Stadt: Berlin als Reallabor der Klimaanpassung
Herausgegeben für die Friedrich-Ebert-Stiftung von Nora Langenbacher
Was der Klimawandel für Städte bedeutet und wie Anpassung gelingen könnte. Der Zukunftsforscher Stephan Rammler liefert eine Analyse über die dramatischen Auswirkungen des Klimawandels auf unser tägliches Leben und entwirft dennoch ein zukunftsfrohes und ermutigendes Szenario. Auf seine wissenschaftliche Analyse des Status quo und die Empfehlung konkreter politischer Maßnahmen folgt ein fiktionales Szenario aus einem Berlin im Jahr 2050 – das zeigt, wie Metropolen den enormen Herausforderungen begegnen können. Ein Weckruf an die gesamte Stadtgesellschaft und Aufruf an die Politik. Ein Buch, das aufrütteln, aber auch Mut machen will.
Friedrich-Ebert-Stiftung (Hg.)
Archiv für Sozialgeschichte, Bd. 64 (2024)
Migration in der Moderne
Wege - Orte - Erfahrungen
Menschen waren zu allen historischen Zeiten mobil, ob aus eigenem Antrieb oder aufgrund politischer oder wirtschaftlicher Notlagen. Migrationsbewegungen verknüpfen entlegene Regionen durch Reiserouten und Kommunikationsnetze, sie prägen Bahnhöfe, (Flug-)Häfen und ganze Stadtviertel als Räume des Ankommens und Zusammenlebens. Nationalstaaten sind zwar bemüht, Migration zu steuern, sie können die eigensinnige Suche nach neuen Lebensmittelpunkten und Erwerbsquellen aber nicht in Gänze kontrollieren.
Michael Braun
Von Berlusconi zu Meloni
Italiens Weg in den Postfaschismus
Im Jahr 2022 wählte Italien Giorgia Meloni an die Macht. Der große Erfolg der neuen extrem rechten Regierungschefin, die nie ein böses Wort über Mussolini verlor und einen neuen »italienischen Stolz« propagiert, kam keineswegs aus dem Nichts. Der windige Medientycoon und Politiker Silvio Berlusconi bereitete Italien über 30 Jahre einen konsequenten Weg in den Postfaschismus. Die Popularität harter rechter Politiker:innen wuchs und ist bis heute ungebrochen. Wie lässt sich das erklären? Was heißt das für Italiens Demokratie? Wie wirkt sich das auf die Zukunft Europas aus?
eBook
Hella Rottenberg / Sandra Rottenberg
Isay Rottenbergs Zigarrenfabrik
Wie ein niederländisch-jüdischer Unternehmer in Sachsen den Nazis die Stirn bot
Übersetzt aus dem Niederländischen von Christina Siever
Isay Rottenberg, ein Unternehmer aus Amsterdam, kauft 1932 im sächsischen Döbeln bei Dresden die Deutschen Zigarrenwerke. Mit maschinellen Produktionsmethoden saniert er den wirtschaftlich angeschlagenen Großbetrieb mitten im Dritten Reich. Die arische Konkurrenz schäumt. Doch solange der Jude Rottenberg vielen Hundert Menschen in schwierigen Zeiten Arbeit gibt, schaffen es selbst eingefleischte Nazis nicht, ihn zu vertreiben. Mit Mut und Beharrlichkeit kann er bis 1935 durchhalten.
eBook
Martin Hecht
Das geschmeidige Ich
Die Gesellschaft der Selbstdarsteller
Wir alle sind Meister der Verstellung. Das ist gar nicht verwerflich. Schein statt Sein ist etwas zutiefst Menschliches. Was aber, wenn das Klima in der offenen Gesellschaft rauer wird? Alle treten gegen alle an. Unsere Formen der sozialen Verwandlung folgen oft nur noch Strategien um mehr Macht und Influence. »Soziale Geschmeidigkeit« ist das neue Kapital und die Schlüsseltugend unserer Zeit. Wer darüber verfügt, feiert Erfolge, wer nicht, wird zum Verlierer.
eBook
Julia Jirmann
Blackbox Steuerpolitik
Wie unser Steuersystem Ungleichheit fördert. Ein Reformvorschlag
In kaum einer anderen westlichen Demokratie sind Vermögen so ungleich verteilt wie in Deutschland. Wir sind ein Hochsteuerland für mittlere Arbeitseinkommen, aber ein Niedrigsteuerland für Vermögende. Wie kann das sein? Ist das gerecht? Warum haben Superreiche geringere Steuer- und Abgabensätze als der Durchschnitt hierzulande? Und wie bekommen wir es hin, dass unser Steuersystem allen dient?
eBook
Frank Überall
Deadline für den Journalismus?
Wie wir es schaffen, nicht zur Desinformationsgesellschaft zu werden
Die Medien stehen enorm unter Druck – politisch und technisch. Der Wert professioneller Nachrichten und Faktenanalysen scheint zugunsten populistischer Botschaften extrem abzunehmen. Für die Demokratie ist guter und unabhängiger Journalismus jedoch lebenswichtig. Wie sieht die Presselandschaft in 20 Jahren aus? Wie wollen wir künftig informiert werden? Wie können Fachleute in diesem Beruf weiterhin existieren? Wie begegnen wir zunehmenden Desinformationsversuchen?
Frank Überall
Deadline für den Journalismus?
Wie wir es schaffen, nicht zur Desinformationsgesellschaft zu werden
Die Medien stehen enorm unter Druck – politisch und technisch. Der Wert professioneller Nachrichten und Faktenanalysen scheint zugunsten populistischer Botschaften extrem abzunehmen. Für die Demokratie ist guter und unabhängiger Journalismus jedoch lebenswichtig. Wie sieht die Presselandschaft in 20 Jahren aus? Wie wollen wir künftig informiert werden? Wie können Fachleute in diesem Beruf weiterhin existieren? Wie begegnen wir zunehmenden Desinformationsversuchen?
eBook
Jochen Dahm / Rebecca Demars / Peter Beule / Severin Schmidt (Hg.)
Verfassung im Fluss
75 Jahre Grundgesetz
Das Grundgesetz wird 75 Jahre alt und es ist eine große Erfolgsgeschichte. Gleichzeitig ist es ein Dokument des Wandels. Mehr als sechzigmal ist das Grundgesetz seit seiner Verkündung geändert worden. Manche Novelle fand breite Zustimmung, andere wurden sehr kontrovers diskutiert oder sind bis heute heftig umstritten.
Institut für die Geschichte und Zukunft der Arbeit (IGZA) (Hg.)
Mitten im dunklen Tal – am Ende Wohlstand und Freiheit?!
Kurzfassung der Materialien zur Geschichte und Zukunft der Arbeit
Lebt die Menschheit am Ende des 21. Jahrhunderts im Garten Eden oder in einer verseuchten Ruinenlandschaft? Beides ist denkbar und möglich. Unsere Hoffnung besteht darin, dass wir die Richtung noch beeinflussen können. Hilfreich dabei ist der Abschied vom Maulwurfshügel, ein globaler und historisch weiter Blick - zumindest auf die letzten 5 000 Jahre, die letzten 250 und die nächsten 100 Jahre.
Stephen Minas
Climate progress in the EU and the world
Anthropogenic climate change is already impacting every region of the globe and affecting vulnerable people more severely than others.
Climate change is a whole-of-economy problem. To tackle it, we need transformational change across economic sectors. Economic responses to climate change must address ‘negative externalities’ but also avoid regressive and inequitable outcomes.
International climate governance has multiple action channels but is centred on the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) regime and most notably the 2015 Paris Agreement, which sets ambitious goals and has nearly universal adoption. However, there is still a substantial gap between what the Paris goals require and aggregate implementation. Progressives must work through multilateral, bilateral and other channels to strengthen the climate transition.
Ivana Bartoletti
A digital union based on European values
The digital transition will significantly affect the work, education and social life of all Europeans. Digitalisation impacts public service delivery and, through social media, even affects our democratic processes. This primer is meant to provide the reader with a grounded understanding of the technology and policy relevance of the developments that have been taking place and are expected to shape the debate in the coming years. It also aims to raise some thought-provoking ideas on what needs to be done to help European tech policy establish itself on firm foundations and foster a progressive vision of society.
Wirtschaftsforum der SPD e. V. (Hg.)
Geoeconomics
Ökonomie und Politik in der Zeitenwende
Die postkommunistische Weltordnung ist zerbrochen. Der Krieg in Europa und im Nahen Osten, der Einflussverlust des Westens und das Erstarken der BRICS-Staaten sind nur einige Stichworte für diese Entwicklung. Geopolitik dominiert die internationalen Beziehungen. Dies hat nicht nur außen- und sicherheitspolitische Konsequenzen, sondern betrifft die ökonomische Entwicklung der Weltwirtschaft, Handelspolitik, Wertschöpfungsketten und notwendige Energie- und Rohstoffpartnerschaften.
Jörg Gertel / David Kreuer / Friederike Stolleis
Die enteignete Generation
Jugend im Nahen Osten und in Nordafrika
Die umfangreiche Jugendstudie, die die Friedrich-Ebert-Stiftung 2021/22 im Nahen Osten und in Nordafrika durchgeführt hat, ist weltweit richtungsweisend. Sie knüpft inhaltlich an die fünf Jahre zuvor durchgeführte Studie an und erlaubt aktuelle Einblicke in Selbstverständnis, Lebenschancen und Zukunftsperspektiven von 12.000 jungen Menschen zwischen 16 und 30 Jahren aus Ägypten, Algerien, Irak, Jemen, Jordanien, Libanon, Libyen, Marokko, Palästina, Sudan, Syrien und Tunesien.
Thomas Hartmann-Cwiertnia / Jochen Dahm / Frank Decker (Hg.)
Europa 2050
Souverän, sozial, handlungsfähig
»Am Ende des Tages haben die klugen Europäer einen ziemlich erstaunlichen und wunderschönen Ort geschaffen, etwas, von dem wir bisher nicht herausgefunden haben, wie wir es in den USA erreichen können.« So formulierte der Autor Steven Hill vor knapp anderthalb Jahrzehnten seinen Blick auf Europa.
Eine Perspektive die uns im Alltag oft fehlt. Ändert man den Blick, erkennt man wie unwahrscheinlich ein solches Bündnis zwischen ehemals verfeindeten Nationen war. Und welche innere Kraft ihm bei aller Verletzlichkeit innewohnen muss.
Im Jahr 2024 könnten die Herausforderungen aber kaum größer sein. Krieg, Klimakatastrophe, Ungleichheit in und zwischen den Ländern, eine rasante technische Entwicklung. Kein Staat kann dem alleine entgegentreten. Europa! – muss weiterhin und umso mehr die Antwort für alle lauten, die an ein besseres Morgen glauben.
Der Mittelstand. BVMW e. V. (Hg.)
Zukunft Mittelstand
Zurück zu klaren Perspektiven. Ein Weckruf aus der Wirtschaft
Die deutsche Wirtschaft ist in einer multiplen Krise und damit in einer kritischen Phase, die darüber entscheidet, ob Deutschland mit seiner Volkswirtschaft noch absehbar zu den führenden Industrienationen gehören wird.
Peter Brandt / Dieter Segert / Gert Weisskirchen (Hg.)
Doppelter Geschichtsbruch
Der Wandel in Osteuropa nach der Helsinki-Konferenz 1975 und die Zukunft der europäischen Sicherheit
Die Helsinki-Konferenz 1975 war Ausgangspunkt für den Wandel im sowjetischen Herrschaftsbereich, der 1989 mit dem Fall der Berliner Mauer seinen symbolischen Höhepunkt fand. Ende 1991 löste sich die Sowjetunion auf. Diese Entwicklungen sind Ergebnis eines letztlich friedlichen Systemwettbewerbs zwischen Westen und Osten, welcher aus der einvernehmlichen Lösung der Kubakrise und durch die Ostverträge der Regierung Brandt / Scheel starke Impulse erhielt. Sie wurden aber auch durch eine mutige Minderheit der Bürgerrechtler in den staatssozialistischen Gesellschaften erkämpft. Daneben spielten Reformer in den kommunistischen Parteien, v. a. Gorbatschow, eine wesentliche Rolle. Es wurde ein System der Rüstungsbegrenzung, der partiellen Abrüstung und der gemeinsamen Sicherheit geschaffen, welches in der Charta von Paris 1990 seinen Ausdruck fand.
Aleksei Bobrovnikov
Blutige Allianzen
Der Anfang
Aus dem Russischen übersetzt von Franziska Zwerg
Der Journalist Aleksei Bobrovnikov berichtet für den Kiewer TV-Sender 1+1 über Geldwäsche und Heroinschmuggel im Donbass. Er reist ins ukrainisch-russische Kriegsgebiet, wo er Andrej, einen Informanten, treffen will. Doch wenige Stunden, bevor sie reden können, wird Andrej von einer Mine in Stücke gerissen. Es ist der Auftakt zu einer Serie von Morden, der mehrere von der Regierung beauftragte Korruptionsermittler zum Opfer fallen. Wer sind die Hintermänner? Wer die Verräter? Wer steht wo in diesem Krieg? Die Recherche wird zur Jagd. Bobrovnikov ist das Wild. Aber als Reporter mit Leib und Seele, frisch getrennt von seiner großen Liebe, hat er nichts zu verlieren. Er will die Wahrheit ans Licht bringen. Dabei gerät er immer tiefer in die tödliche Grauzone von Spionage, Machtgier und Betrug.
Harald Roth (Hg.)
Verteidigt die Demokratie!
Unsere Demokratie braucht uns – jetzt. Denn sie ist nicht selbstverständlich. Angesichts multipler Krisen weltweit wenden sich immer mehr Menschen populistischen Strömungen und rechtsextremen Parteien zu, die gezielt Ängste schüren und einfache Lösungen für schwierige Themen versprechen.
Alfred Grosser
Le Mensch
Die Ethik der Identitäten
unveränderte Nachauflage
Wer bestimmt, was der Mensch ist: als Individuum oder Amtsinhaber, als Angehöriger einer Gruppe, Religion oder Ethnie? Facettenreich und mit vielen persönlichen Rückblicken schreibt der große Europäer Grosser über die Entstehung und Moral sozialer Identität. Dabei wehrt er sich gegen ein altes Grundübel, das aktueller ist denn je – den Finger, der auf andere zeigt, das "schlimme DIE": DIE Muslime, DIE Frauen, DIE Juden, DIE Deutschen, DIE Flüchtlinge. Ein großes Buch, das uns auffordert, auch in schwierigen Zeiten niemals unsere Menschlichkeit zu verlieren.
Aleksei Bobrovnikov
Blutige Allianzen
Der Anfang
Aus dem Russischen übersetzt von Franziska Zwerg
Der Journalist Aleksei Bobrovnikov berichtet für den Kiewer TV-Sender 1+1 über Geldwäsche und Heroinschmuggel im Donbass. Er reist ins ukrainisch-russische Kriegsgebiet, wo er Andrej, einen Informanten, treffen will. Doch wenige Stunden, bevor sie reden können, wird Andrej von einer Mine in Stücke gerissen. Es ist der Auftakt zu einer Serie von Morden, der mehrere von der Regierung beauftragte Korruptionsermittler zum Opfer fallen. Wer sind die Hintermänner? Wer die Verräter? Wer steht wo in diesem Krieg? Die Recherche wird zur Jagd. Bobrovnikov ist das Wild. Aber als Reporter mit Leib und Seele, frisch getrennt von seiner großen Liebe, hat er nichts zu verlieren. Er will die Wahrheit ans Licht bringen. Dabei gerät er immer tiefer in die tödliche Grauzone von Spionage, Machtgier und Betrug.
eBook
Lennart Alexy / Andreas Fisahn / Susanne Hähnchen / Tobias Mushoff / Uwe Trepte
Das Rechtslexikon, 2. Auflage
Begriffe, Grundlagen, Zusammenhänge
Kompetenz im handlichen Format in über 1.500 Stichwörtern und mehr als 40 Tabellen und Schaubildern zu allen wichtigen Rechtsgebieten: Zivilrecht (z. B. Familien- und Erbrecht, Versicherungsrecht), Arbeitsrecht, Öffentliches Recht (z. B. Baurecht, Staats- und Verfassungsrecht, Umweltrecht, Verwaltungsrecht), Sozialrecht (z. B. Arbeitslosen- und Rentenversicherung), Strafrecht (einschließlich Jugendstrafrecht und Ordnungswidrigkeiten) sowie ihren europa- und völkerrechtlichen Bezügen.
Franz Müntefering
Nimm das Leben, wie es ist. Aber lass es nicht so.
Gedanken, Reime, Geschichten
Locker und bemerkenswert, mit Witz und Verstand, schreibt Franz Müntefering übers Leben. Über Sinn und Unsinn. Zögern und Handeln. Glauben und Nicht-mehr-glauben. Älterwerden und Neugierigbleiben. Übers Sterben und den Tod. Über die Liebe zum Leben und was das für die Politik bedeutet. Mit Verbeugungen vor den kleinen Dingen des Alltags. Mit diesem typischen Sound, an dem man »den Franz« sofort erkennt.
Stephan Klecha
Der treue Funktionär
Otto Buchwitz – Vom traditionellen Sozialdemokraten zum überzeugten Unterstützer der SED
Der Zusammenschluss von SPD und KPD zur SED im Jahr 1946 geschah unter Zwang, doch nicht alle Sozialdemokraten mussten gezwungen werden. Mit Otto Buchwitz wurde ausgerechnet ein besonders linientreuer Sozialdemokrat der Weimarer Republik zum Apologeten der neuen Einheitspartei. Später in der DDR erhielt er wegen seiner tiefen sozialdemokratischen Wurzeln als »Veteran der deutschen Arbeiterbewegung« zahlreiche Ehrungen. Immerhin trugen 250 Einrichtungen, Straßen oder Gebäude im Osten Deutschlands seinen Namen.
Thomas Hartmann-Cwiertnia / Jochen Dahm / Frank Decker (Hg.)
Der moderne Staat
Was er ist, was er braucht, was er kann
Klimakrise, Sicherheitskrise, Ungleichheit – moderne Gesellschaften stehen vor gewaltigen Herausforderungen. Die Regulationsmechanismen des Marktes führen nicht automatisch zu guten Ergebnissen, sondern mitunter zu tiefen Verwerfungen und gesellschaftlichen Spannungen. Der einst abgeschriebene Staat ist wichtiger denn je. Die Erwartungen, dass er zur Lösung der Krisen beitragen soll, sind groß.
Lennart-Elias Seimetz
Total überfordert, total kaputt, total wichtig
Wie Schule sein sollte und was Ihr dafür tun müsst
Ein Schülersprecher redet Klartext
Schüler\*innen sind die »Überhörten«, wenn es um ihre eigene Bildung geht, und sind gleichzeitig am meisten von den Fehlentscheidungen betroffen. Aus Sicht vieler Schüler\*innen verfehlt Schule schon lange ihr Ziel und ist schon gar nicht zukunftsfähig, sagt der 19-jährige Landesschülersprecher Lennart Seimetz. Und darüber will der engagierte Abiturient endlich reden. Was also braucht es aus Sicht von Schüler\*innen, um sie auf das 21. Jahrhundert vorzubereiten?
Lennart-Elias Seimetz
Total überfordert, total kaputt, total wichtig
Wie Schule sein sollte und was Ihr dafür tun müsst.
Ein Schülersprecher redet Klartext
Schüler\*innen sind die »Überhörten«, wenn es um ihre eigene Bildung geht, und sind gleichzeitig am meisten von den Fehlentscheidungen betroffen. Aus Sicht vieler Schüler\*innen verfehlt Schule schon lange ihr Ziel und ist schon gar nicht zukunftsfähig, sagt der 19-jährige Landesschülersprecher Lennart Seimetz. Und darüber will der engagierte Abiturient endlich reden. Was also braucht es aus Sicht von Schüler\*innen, um sie auf das 21. Jahrhundert vorzubereiten?
eBook
Björn Hacker
Social Europe: From vision to vigour
The need to balance economic and social integration
Wiebke Wiede / Johanna Wolf / Rainer Fattmann (Hg.)
Gender Pay Gap
Vom Wert und Unwert von Arbeit in Geschichte und Gegenwart
Der Gender Pay Gap ist ein vielschichtiges historisches Phänomen. Es ist verknüpft mit ungleichen Bewertungen von Arbeit auf den Arbeitsmärkten, mit Geschlechterbildern, die sich im Zeitverlauf nur langsam wandeln, und einer ungleichen Verteilung von Haus-, Sorge- und Erwerbsarbeit. Die Autorinnen zeichnen die Bedingungen der ungleichen Bezahlung aus unterschiedlichen Perspektiven exemplarisch nach.
Sebastian Sons
Die neuen Herrscher am Golf
und ihr Streben nach globalem Einfluss
Zeitenwende am Golf: Mithilfe ihres Öl- und Gasreichtums ist es den Golfstaaten Saudi-Arabien, Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), Kuwait, Bahrain und Oman gelungen, weltweit immer mehr Einfluss zu nehmen – in der Politik, der Wirtschaft oder dem Sport. Ihre ambitionierten Herrscher konkurrieren dabei um Macht und verfolgen kompromisslos eigene politische und wirtschaftliche Interessen. Diese immer dominantere Rolle von autoritären Monarchien stellt die internationale Gemeinschaft und Deutschland zunehmend vor fundamentale Herausforderungen.
Niklas Frank
Zum Ausrotten wieder bereit?
Wir deutschen Antisemiten – und was uns blüht
Ob Terrorismus wie in Halle und Hagen, ob Angriffe auf Synagogen oder Gewalt gegen jüdische Menschen: Wir müssen endlich anerkennen, was da in uns existiert. Der Antisemitismus kriecht derzeit wieder aus allen Löchern der deutschen Gesellschaft, weil wir nichtjüdischen Deutschen ihn nie als Teil von uns gesehen und bekämpft haben. Allein 2022 gab es über 1.500 Straftaten gegen Juden und jüdische Einrichtungen – mehr als 5 pro Tag!
Gottfried Niedhart
Pionier und Außenseiter Gustav Mayer
Deutsch-jüdischer Historiker des Sozialismus
Eine Biografie über Gustav Mayer (1871–1948) ist längst überfällig. Als Pionier einer wissenschaftlichen Geschichtsschreibung zur deutschen und europäischen Sozialdemokratie hat er ein umfangreiches Werk hinterlassen, das in einer zweibändigen Biografie über Friedrich Engels gipfelte. Dennoch blieb er ein Außenseiter, da er mit dieser Thematik in der deutschen Geschichtswissenschaft nur schwer Fuß fassen konnte. Erst zu Beginn der Weimarer Republik erhielt er eine Professur. Als Jude wurde er 1933 ein Opfer der nationalsozialistischen Rassenpolitik und aus dem Staatsdienst entlassen.
Niklas Frank
Zum Ausrotten wieder bereit?
Wir deutschen Antisemiten – und was uns blüht
Ob Terrorismus wie in Halle und Hagen, ob Angriffe auf Synagogen, Gewalt gegen jüdische Menschen: Wir müssen endlich anerkennen, was da in uns existiert. Der Antisemitismus kriecht derzeit wieder aus allen Löchern der deutschen Gesellschaft, weil wir nichtjüdischen Deutschen ihn nie als Teil von uns gesehen und bekämpft haben. Allein 2022 gab es über 1.500 Straftaten gegen Juden und jüdische Einrichtungen – mehr als 5 pro Tag!
eBook
Sebastian Sons
Die neuen Herrscher am Golf
und ihr Streben nach globalem Einfluss
Zeitenwende am Golf: mithilfe ihres Öl- und Gasreichtums ist es den Golfstaaten Saudi-Arabien, Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), Kuwait, Bahrain und Oman gelungen, weltweit immer mehr Einfluss zu nehmen – in der Politik, der Wirtschaft oder dem Sport. Ihre ambitionierten Herrscher konkurrieren dabei um Macht und verfolgen kompromisslos eigene politische und wirtschaftliche Interessen. Diese immer dominantere Rolle von autoritären Monarchien stellt die internationale Gemeinschaft und Deutschland zunehmend vor fundamentale Herausforderungen.
eBook
Andreas Zick / Beate Küpper / Nico Mokros (Hg.)
Die distanzierte Mitte
Rechtsextreme und demokratiegefährdende Einstellungen in Deutschland 2022/23
Die Pandemiefolgen sind noch nicht bewältigt, die Inflation hoch, die Klimakrise immer virulenter, da entstehen mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und dessen Folgen für Sicherheit und Energieversorgung weitere Herausforderungen für die »Mitte«. Unsicherheiten und Verteilungskonflikte bieten das Einfallstor für antidemokratische Positionen und rechtsextreme Ideologien, wie auch zur Abwertung der »Anderen«. Die Demokratie, ihre Grundprinzipien, Abläufe und Institutionen werden von einigen zunehmend mit Distanz betrachtet. Zugleich geht eine demokratiefeste »Mitte« auf klare Distanz zu den Feind\*innen der Demokratie und fragt sich, ob sie diese Distanz überbrücken kann und will. Die neue FES-»Mitte«-Studie 2022/23 beleuchtet demokratiegefährdende Einstellungen und Hintergründe und regt zur Debatte an.
Arancha Gonzalez / Yanis Bourgeois
The Trade Handbook
Making trade work for prosperity, people and planet
We are living in turbulent times. Trade and globalisation are facing major economic, geopolitical and societal shifts. Trade continues to drive job creation, growth, innovation, development and poverty reduction. Simultaneously, trade is also raising legitimate concerns about resilience, distribution, inclusion and the environment. More recently concerns about national security, dependencies and technology are redrawing trade maps. In today's complex trade ecosystem, the Trade Handbook provides the reader with a comprehensive view of why open trade and economic integration matter, where trade is headed, how to regulate it, and how it can work for everyone – not just some or most. If in the past the focus has been on making trade possible, i.e. negotiating trade agreements, the Trade Handbook suggests to pay the same attention to making trade happen, and most importantly, to ensure trade works for all. Basically, how to make trade effectively work for prosperity, people and planet. The Trade Handbook is part of the Foundation for European Progressive Studies (FEPS).
Peter Brandt / Detlef Lehnert
Eine kurze Geschichte der deutschen Sozialdemokratie
Dieser Band bietet einen knappen und aktuellen Blick auf mehr als 160 Jahre wechselhafter Geschichte der Sozialdemokratie in Deutschland – von den Anfängen der Arbeiterbewegung um die Mitte des 19. Jahrhunderts bis in unsere Gegenwart. Er stellt die Entwicklungsgeschichte und das Selbstverständnis der Sozialdemokratie auf wissenschaftlicher Grundlage kurzweilig, informativ und kenntnisreich dar.
Institut für die Geschichte und Zukunft der Arbeit (IGZA) (Hg.)
Matrix der Arbeit
Materialien zur Geschichte und Zukunft der Arbeit
Die größte Datensammlung zur Geschichte der menschlichen Arbeit: Dieses interdisziplinäre »Big Picture« liefert überraschende Einsichten zur globalen Geschichte der menschlichen Arbeit von ihren Anfängen bis zum Ende des 21. Jahrhunderts – vom Faustkeil bis zum humanoiden Roboter. Es beginnt mit den Wildbeutern und den beiden produktiven Meilensteinen, der Agrikulturepoche und der kapitalistischen Epoche, und mündet in eine Betrachtung der Arbeit der Zukunft.
Peter Brandt / Detlef Lehnert
Eine kurze Geschichte der deutschen Sozialdemokratie
Dieser Band bietet einen knappen und aktuellen Blick auf mehr als 160 Jahre wechselhafter Geschichte der Sozialdemokratie in Deutschland – von den Anfängen der Arbeiterbewegung um die Mitte des 19. Jahrhunderts bis in unsere Gegenwart. Er stellt die Entwicklungsgeschichte und das Selbstverständnis der Sozialdemokratie auf wissenschaftlicher Grundlage kurzweilig, informativ und kenntnisreich dar.
eBook
Wirtschaftsforum der SPD e. V. (Hg.)
Futurenomics
Zukunft des Geschäftsmodells und des Standorts Deutschland und Europa
Wie können vor dem Hintergrund der geopolitischen und ökonomischen Zeitenwende das Geschäftsmodell und der Standort Deutschland und Europa zukunftsfähig und zukunftsfest gemacht werden? Die Beiträge des Bandes wollen eine Debatte jenseits der aktuellen Krisenpolitik anstoßen, in der es darum geht, wirtschafts-, energie- und industriepolitische Antworten für die nächsten Jahre zu geben, damit der Wirtschaftsstandort und das Geschäftsmodell Deutschland und Europa auch in Zukunft erfolgreich sein können.
Klaus-Dieter Müller
Innovativ, selbständig, sozialdemokratisch
70 Jahre Arbeitsgemeinschaft Selbständige in der SPD (AGS)
Die Rahmenbedingungen für Solo-Selbständige, Freiberufler\*innen sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) haben sich in den letzten Jahren völlig verändert. Die Auslöser dieser Veränderung reichen vom Krieg Putins gegen die Ukraine über die Corona-Pandemie, den Klimawandel und Umweltkatastrophen bis hin zur Digitalisierung und Globalisierung.
Brigitte Seebacher
Hundert Jahre Hoffnung und ein langer Abschied
Zur Geschichte der Sozialdemokratie
Die Hoffnung auf eine bessere Welt hat die Arbeiterklasse und ihre politische Partei oft über das Elend der Gegenwart hinweggetragen. Diese Geschichte, traurig und schön zugleich, erzählt die Historikerin Brigitte Seebacher von ihren Anfängen an, bevor der Weg zur Reform- und Regierungspartei nachgezeichnet wird.
Valentina Kerst / Fedor Ruhose
Schleichender Blackout
Wie wir das digitale Desaster verhindern
Herausforderung Digitalisierung: Kritische Bestandsaufnahme und Strategien für Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft
Elektronische Krankenakte, digitaler Unterricht oder einfach nur der Versuch, sich online beim Finanzamt anzumelden: Das Thema digitale Infrastruktur brennt uns unter den Nägeln - privat wie beruflich. Oft haben wir den Eindruck, dass die Digitalisierung in Deutschland lediglich eine »Elektrifizierung der Verwaltung« ist. Weshalb stockt die digitale Transformation von Behörden, Schulen und Firmen? Wie ist es um die Datensicherheit bestellt und wie gefährlich sind Cyberattacken für das öffentliche Leben? Und noch wichtiger: Wie könnten die Lösungen aussehen, die aus den vielen Herausforderungen eine Chance machen würden?
Valentina Kerst/Fedor Ruhose
Schleichender Blackout
Wie wir das digitale Desaster verhindern
Herausforderung Digitalisierung: Kritische Bestandsaufnahme und Strategien für Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft
Elektronische Krankenakte, digitaler Unterricht oder einfach nur der Versuch, sich online beim Finanzamt anzumelden: Das Thema digitale Infrastruktur brennt uns unter den Nägeln - privat wie beruflich. Oft haben wir den Eindruck, dass die Digitalisierung in Deutschland lediglich eine »Elektrifizierung der Verwaltung« ist. Weshalb stockt die digitale Transformation von Behörden, Schulen und Firmen? Wie ist es um die Datensicherheit bestellt und wie gefährlich sind Cyberattacken für das öffentliche Leben? Und noch wichtiger: Wie könnten die Lösungen aussehen, die aus den vielen Herausforderungen eine Chance machen würden?
eBook
Reiner Hoffmann / Peter Seideneck (Hg.)
Der lange Weg zur Demokratie
Von Berlin über Budapest nach Prag und Danzig
Die Historiker György Dalos, Ilko-Sascha Kowalczuk und Jean-Yves Potel haben untersucht, welche Auswirkungen die vier großen revolutionären Momente der Arbeiterbewegung in Mittel- und Osteuropa auf die Entwicklung der Demokratie in ganz Europa hatten: 1953 DDR, 1956 Ungarn, 1968 ČSSR und 1980 Polen. Sie sind bis heute Wegweiser für den schwierigen Prozess der Demokratisierung, der von erheblichen Rückschlägen geprägt ist – auch in Ländern, die mittlerweile der EU angehören.
Oliver Mayer-Rüth
Der Allmächtige?
Die Türkei von Erdogans Gnaden
2023 sind Wahlen in der Türkei und ihr 100. Geburtstag. Wird Recep Tayyip Erdogan straucheln oder festigt er seine Präsidentschaft in diesem Schicksalsjahr? »Der Allmächtige?« durchleuchtet sein skrupelloses Vorgehen seit dem Putschversuch 2016. Gut recherchiert, im Lichte zahlreicher persönlicher Erlebnisse und politischer Ereignisse schildert ARD-Korrespondent Oliver Mayer-Rüth den Weg der heutigen Erdogan-Türkei und macht klar, welche riesigen Kollateralschäden der autoritäre Staatschef in Kauf nimmt, um seinen Palast in Ankara nie wieder verlassen zu müssen.
Hans von Storch
Der Mensch-Klima-Komplex
Was wissen wir? Was können wir tun?
Zwischen Dekarbonisierung, Innovation und Anpassung
Entscheidend für die Zukunft ist, wie viel wir über den menschengemachten Klimawandel wissen und was wir ernsthaft tun: Die Reduzierung von Treibhausgasen und die Anpassung der menschlichen Existenzgrundlagen an die Folgen der tatsächlichen Klimaveränderungen sind wichtig. Aber beides verlangt große Entwicklungsbereitschaft, so der Klimaforscher Hans von Storch.
Nils Heisterhagen
Sein und Zeitenwende
Warum Deutschland nicht mehr so weitermachen kann
Die dramatisch steigenden Energiepreise haben offengelegt, dass es schlecht um die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes und das Geschäftsmodell Deutschland bestellt ist. Alle Indikatoren zeigen inzwischen in diese Richtung.
Hans von Storch
Der Mensch-Klima-Komplex
Was wissen wir? Was können wir tun? Zwischen Dekarbonisierung, Innovation und Anpassung
eBook
Birgit Lahann
»Kennen Sie einen Juden?«
Lauter Künstler von A wie Alejchem bis Z wie Zadek
Als der jüdische Opernregisseur Barrie Kosky 2018 am Brandenburger Tor Leute fragte, ob sie einen Juden kennen, hörte er nur: Nein, ich nicht, no. Er war entsetzt und fragte sich: Wo bin ich denn hier gelandet? Birgit Lahann hat als Journalistin viele getroffen, hat ihnen zugehört, auch Kosky, und ihre Begegnungen aufgezeichnet, um Leserinnen und Leser an den turbulenten Lebensgeschichten teilhaben zu lassen und an all dem Witz, der Freude und Freundschaft, die sie dabei gefunden hat.
Marco Pagano
Kleine Helden
Eine Liebeserklärung an Ehrenamt und Kommunalpolitik
Dem politischen Ehrenamt wird heute nur noch wenig Respekt entgegengebracht. Immer mehr Akteure streichen frustriert die Segel: Pöbeleien, Drohungen, Angriffe und mangelnde Wertschätzung sind oft der Lohn für anspruchsvolle, aber unbezahlte Aufgaben in Kommune und Kreis. Wer setzt sich dem noch freiwillig aus? Marco Pagano, früherer Bezirksbürgermeister in Köln-Kalk, schreibt offen und schonungslos über diese Herausforderungen und erzählt, warum er es trotzdem noch einmal wagen würde.
David Ranan
Kirche, Schuld und Synodaler Weg
Was Galileo, die Judenverfolgung und den Missbrauchsskandal verbindet
Die allgemeine Wut über die Vertuschung des sexuellen Missbrauchs hat den lang existierenden Reformforderungen innerhalb der Kirche Auftrieb gegeben. Jetzt scheint alles auf dem Tisch des Synodalen Wegs zu liegen: Anerkennung der Homo-Ehe, priesterlicher Zölibat, Frauen in der Hierarchie – doch ist das Ganze mehr als ein aussichtsloses Unterfangen?
eBook
David Ranan
Kirche, Schuld und Synodaler Weg
Was Galileo, die Judenverfolgung und den Missbrauchsskandal verbindet
Die allgemeine Wut über die Vertuschung des sexuellen Missbrauchs hat den lang existierenden Reformforderungen innerhalb der Kirche Auftrieb gegeben. Jetzt scheint alles auf dem Tisch des Synodalen Wegs zu liegen: Anerkennung der Homo-Ehe, priesterlicher Zölibat, Frauen in der Hierarchie – doch ist das Ganze mehr als ein aussichtsloses Unterfangen?
Joanna Andrychowicz-Skrzeba / Max Brändle (Hg.)
The Disruption of Eastern Policy
Looking East from Warsaw and Berlin
Russia’s attack on Ukraine has disrupted European Eastern policy. At the same time, different perspectives on that policy have clashed. This is particularly visible in the German and Polish cases. In order to build a new European Eastern policy, we have to understand differing perspectives and clear up misconceptions and misunderstandings.
Friedrich-Ebert-Stiftung (Hg.)
Archiv für Sozialgeschichte, Bd. 62 (2022)
Sozialgeschichte der Bildung
»Bildung« ist ein zentraler und schillernder Begriff der Gegenwart. Mit ihr werden hohe Ziele von gesellschaftlicher Emanzipation verknüpft und sie soll entscheidend dazu beitragen, soziale Ungleichheiten zu beseitigen. Zugleich stellt sie eine wichtige ökonomische Ressource dar und schafft selbst soziale Unterschiede zwischen »Gebildeten« und »Bildungsfernen«. Bildung kann als Motor individueller Befreiung und Erfüllung erfahren, aber als stetige Aufforderung zum »lebenslangen Lernen« auch mit Auslese, Leistungsdruck und Situationen des Scheiterns in Verbindung gebracht werden.
Matthias Machnig / Ernst Hillebrand / Nils Heisterhagen (Hg.)
Cleaner, better, more resilient
A debate on the necessary economic transformations in Germany and Europe
Europe is facing the biggest transformation since the beginning of the industrial revolution. The goal is to achieve climate neutrality of the economy in about two decades. Europe’s progressive forces must define and shape this transformation. The war in Ukraine has abruptly changed the path of transformation, even if the basic roadmap remains the same. The texts published in this book are part of the debate that progressive social and political forces in Germany are currently conducting on this historic challenge.
Chrysa Vachtsevanou / Vangelis Karamanolakis / Stefan Zeppenfeld (Hg.)
Human Rights, Trade and Diplomacy
in the Greek-German Relations, 1967–1974
In 1967, a coup in Greece brought the military to power. Numerous relations between the Federal Republic of Germany and Greece existed during the government of the junta (1967–1974). The scientific contributions in this volume illuminate the historical relations between Germany and Greece with a view to diplomacy, civil society and the media.
Christopher Kopper (Hg.)
Gerhard Beier
Hessen vorn
Die Biografie des Hessischen Ministerpräsidenten Georg August Zinn
Georg August Zinn (1901–1976) war der bedeutendste sozialdemokratische Ministerpräsident der 1950er- und 1960er-Jahre. In dieser Zeit gab er der Entwicklung Hessens entscheidende Impulse. Sein Ziel war es, eine neue demokratische Wirtschaftsordnung jenseits von Kapitalismus und Planwirtschaft zu schaffen. Hessen entwickelte sich in seiner Amtszeit zu einem wirtschaftlich starken und innovativen Land und zum Vorreiter sozialdemokratischer Politik.
Carmen Teixeira (Hg.)
Geschichte der Zuwanderung in Nordrhein-Westfalen – Flucht, Vertreibung, Aussiedlung, Arbeitsmigration
Herausforderungen an Integration, Teilhabe und Zusammenhalt im Wandel
Zuwanderung gab es in Nordrhein-Westfalen schon immer. Sie ist ein wesentlicher Teil seiner Geschichte und prägte das bevölkerungsreichste deutsche Bundesland. Allerdings wird sie meist im Zusammenhang mit Problemen thematisiert. Warum? Dass sie viel mehr gute als schwierige Seiten hat, beschreibt dieser Band, der einen weiten Bogen auch zu aktuellen migrationspolitischen Fragen spannt.
Peter Brandt / Hans-Joachim Giessmann / Götz Neuneck (Hg.)
»… aber eine Chance haben wir«
Zum 100. Geburtstag von Egon Bahr
In diesem Band erinnern prominente Wegbegleiter\*innen aus Politik, Wissenschaft und Kultur an die Staatskunst, Methodik und historischen Verdienste von Egon Bahr. Sein Feld war die Friedens- und Sicherheitspolitik. Als brillanter strategischer Denker hat er sich stets an der Machbarkeit politischer Schritte orientiert und verstand es wie kein Zweiter, Verbündete für deren Umsetzung zu gewinnen.
Mathias Brüggmann
1001 Macht
Fußball, Flüssiggas, Finanzimperium
Der märchenhafte Aufstieg des Emirats Katar vom Wüstenstaat zum Global Player
Die Fußballweltmeisterschaft und Flüssiggas rücken Katar derzeit weltweit in den Fokus. Doch was wissen wir über dieses Emirat am Persischen Golf und seine wichtigsten Akteure? Mathias Brüggmann berichtet seit Jahrzehnten aus dem Mittleren Osten. Er zeigt den Aufstieg des Landes von einer vergessenen Halbinsel zum weltgrößten Flüssiggasexporteur und einem der reichsten Länder der Welt. Von einem Piratennest im Schatten Saudi-Arabiens, einem Spielball zwischen Osmanischem Reich und British Empire zu einer internationalen Drehscheibe in Sportbusiness und Diplomatie.
Mathias Brüggmann
1001 Macht
Fußball, Flüssiggas, Finanzimperium
Der märchenhafte Aufstieg des Emirats Katar vom Wüstenstaat zum Global Player
Die Fußballweltmeisterschaft und Flüssiggas rücken Katar derzeit weltweit in den Fokus. Doch was wissen wir über dieses Emirat am Persischen Golf und seine wichtigsten Akteure? Mathias Brüggmann berichtet seit Jahrzehnten aus dem Mittleren Osten. Er zeigt den Aufstieg des Landes von einer vergessenen Halbinsel zum weltgrößten Flüssiggasexporteur und einem der reichsten Länder der Welt. Von einem Piratennest im Schatten Saudi-Arabiens, einem Spielball zwischen Osmanischem Reich und British Empire zu einer internationalen Drehscheibe in Sportbusiness und Diplomatie.
eBook
Gert Weisskirchen / Peter Brandt (Hg.)
Sozialismus mit menschlichem Antlitz
Der Aufbruch in der Tschechoslowakei 1968 in seinem historischen Umfeld
Das Jahr 1968 steht für die weltweite Auflehnung der Jüngeren gegen als autoritär empfundene Gesellschafts- und Staatsformen. Im Mittelpunkt dieses historischen Bandes über »Achtundsechzig« im östlichen Europa, in dem Beiträge von Zeitzeugen durch wissenschaftliche Aufsätze ergänzt werden, stehen die Reformversuche des »Prager Frühlings«, einen demokratischen, menschlichen Sozialismus zu schaffen. Heute erkennt man: Was in der Tschechoslowakei unmittelbar, weniger folgenreich in Polen und Jugoslawien, geschah, strahlte auch auf die »freie Welt« aus und war mit der militärischen Niederschlagung durch die Warschauer-Pakt-Staaten keineswegs vorbei – 1968 ist ein zentrales Ereignis auf dem Weg zur späteren Auflösung der Blöcke im Kalten Krieg.
Arne Börnsen
Mut zur Veränderung
Die Postreform – Bruch eines Tabus
In den 1970er-Jahren hatte die »Gelbe Post« ein Problem: Sie häufte von Jahr zu Jahr höhere Verluste an, die von der »Grauen Post«, der späteren Telekom, ausgeglichen werden mussten. Gleichzeitig verlor das Fernmeldewesen international an Wettbewerbsfähigkeit. Was tun? Arne Börnsen, ehemaliger SPD-Bundestagsabgeordneter und Fraktionssprecher für Post- und Telekommunikation, erzählt hier die Geschichte, wie die Bundespost erfolgreich privatisiert wurde.
Souad Lamroubal
Yallah Deutschland, wir müssen reden!
Aus dem Leben einer deutsch-marokkanischen Beamtin
»Ich verrate Dir, wo ich herkomme, und vor allem, wo ich hinwill!« – So beginnt ein packendes, tiefgründiges, witzig-ernstes Zwiegespräch mit »ihrem« Deutschland, das Souad Lamroubal als »problematisches« Gastarbeiterkind kennengelernt hat und dem sie heute als Integrationsbeamtin dient. Ein unwiderstehlicher Dialog über Freiheit und Herkunft, Verbotenes und Erlaubtes, über Heimat, Zukunft und die Frage, wer wir Deutschen sind und wann wir Deutsche sind.
Anonymus von Paris
Verbietet die Kutschen!
Pariser Verkehrsrevolutionen 1790/2040
Eine Streitschrift aus dem 18. Jahrhundert
Übersetzt und kommentiert von Hans Haselbach und Veronika R. Meyer
Ende des 18. Jahrhunderts litt Paris unter einem unvorstellbaren Verkehrschaos: rücksichtslos rasende Kutscher in großer Zahl, von Pferden erschlagene oder von Kutschen überrollte Fußgänger, zahllos Unfälle und rund 300 Verkehrstote pro Jahr. Was, wenn man die Kutschen verbieten würde? Ein unbekannter Bürger, nennen wir ihn Anonymus von Paris, schlug 1790 mit einer Petition genau das vor. Lässt sich seine Idee ins 21. Jahrhundert übertragen?
Lorenzo Annese
Vita da Gastarbeiter
Von Apulien zu VW in Wolfsburg
Die Geschichte des ersten ausländischen Betriebsrats in Deutschland
Aus dem Italienischen übersetzt von Carola Köhler
Geboren 1937 in dem Dorf Alberobello, verlebte Lorenzo Annese eine entbehrungsreiche Jugend in einer bitterarmen Gegend Apuliens. 1958, mit 21 Jahren, wanderte er nach Deutschland aus – ein italienischer »Gastarbeiter« der ersten Stunde. Er fand eine »neue Welt« voller Möglichkeiten, aber manchmal auch Feindseligkeiten. Er war der erste italienische Mitarbeiter der Volkswagen AG und blieb ihr über drei Jahrzehnte eng verbunden. 1965, als »IG-Metaller«, wurde er zum ersten nicht deutschen Betriebsrat der Bundesrepublik gewählt und setzte sich unermüdlich für die Integration der großen italienischen Gemeinde in Wolfsburg ein. Heute lebt er, der »Emigrant«, vielfach geehrt mit seiner Frau Frieda in Deutschland, aber er werde immer »ein Nomade bleiben, nicht nur geografisch, sondern auch in Geist, Gewissen und Herz«.
Souad Lamroubal
Yallah Deutschland, wir müssen reden!
Aus dem Leben einer deutsch-marokkanischen Beamtin
»Ich verrate Dir, wo ich herkomme, und vor allem, wo ich hinwill!« – So beginnt ein packendes, tiefgründiges, witzig-ernstes Zwiegespräch mit »ihrem« Deutschland, das Souad Lamroubal als »problematisches« Gastarbeiterkind kennengelernt hat und dem sie heute als Integrationsbeamtin dient. Ein unwiderstehlicher Dialog über Freiheit und Herkunft, Verbotenes und Erlaubtes, über Heimat, Zukunft und die Frage, wer wir Deutschen sind und wann wir Deutsche sind.
eBook
Wirtschaftsforum der SPD e. V. (Hg.)
Transfornomics
Zur ökonomischen Zeitenwende
Mit einem Geleitwort des SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil
Uns steht die größte Transformation seit Beginn der Industriellen Revolution bevor. Ziel ist die vollständige Klimaneutralität der Wirtschaft in gut 20 Jahren. Um das zu erreichen, werden 150 Jahre ökonomisch-sozialer Entwicklung vom Kopf auf die Füße gestellt werden müssen. Auf dem Weg dahin stellen sich jedoch viele ungeklärte Fragen nach den richtigen Instrumenten und Machbarkeitspfaden.
Armin Pfahl-Traughber
Intellektuelle Rechtsextremisten
Das Gefahrenpotenzial der Neuen Rechten
Der Begriff »Neue Rechte« bezeichnet einen intellektuellen Rechtsextremismus. Seine Akteure verstehen sich als ideologische Wegbereiter eines gesellschaftlichen Rechtsrucks, der autoritär-nationalistische Vorstellungen in reale Politik umsetzen will. Der Extremismus-Experte Armin Pfahl-Traughber zeigt, wie die Neue Rechte systematisch demokratische Auffassungen delegitimiert, um die geistigen Voraussetzungen für einen politischen Wechsel herbeizuführen. Er analysiert ihr Gefahrenpotenzial, geistige Vorbilder, ideologische Grundpositionen, einschlägige Publikationsorgane, Netzwerke und Strategien.
Gerhard Stahl
China
Zukunftsmodell oder Albtraum?
Europa zwischen Partnerschaft und Konfrontation
China wird unsere Zukunft bestimmen. Nicht nur unser Wohlstand hängt vom Handel mit der aufstrebenden Wirtschaftsmacht ab. Globale Probleme, allen voran der Klimawandel, können nur mit Chinas Mitarbeit bewältigt werden. Viele sehen in der kommunistischen Volksrepublik eine Gefahr für die internationale Ordnung, für Frieden und Demokratie. Europa muss einen Weg finden, mit China umzugehen. Dafür müssen wir dieses riesige Land mit seiner Geschichte und Politik besser verstehen.
Willi Carl / Martin Gorholt / Sabine Hering (Hg.)
Sozialdemokratie in Brandenburg
1933–1989/90
Lebenswege zwischen Widerstand, Vereinnahmung und Neubeginn
Die Frauen und Männer, deren Lebenswege zwischen 1933 und 1989/90 hier nachgezeichnet werden, waren Mitglieder der Brandenburger Sozialdemokratie. Ab 1933 waren sie massiven Verfolgungen ausgesetzt und leisteten verzweifelten Widerstand. Es ging ihnen darum, das Überleben zu sichern, für sich und die Genossinnen und Genossen – auch im KZ und den Zuchthäusern.
Christine G. Krüger
»Die Scylla und Charybdis der socialen Frage«
Urbane Sicherheitsentwürfe in Hamburg und London (1880–1900)
Die sozialen Reformen des ausgehenden 19. Jahrhunderts wurden von der Angst vor revolutionärem Aufruhr befeuert – so lautet eine beliebte, aber kaum belegte These. Wachsende soziale Spannungen, vor allem die beiden großen Hafenstreiks in London 1889 und Hamburg 1896/97 bedrohten die urbane Sicherheitskultur dramatisch. Christine Krüger zeigt: Durch Revolutionsängste wurden meist Forderungen nach repressiven Maßnahmen laut, die auf sozialen Ausschluss zielten und weniger auf inkludierende Sozialreformen.
Peter Rudolf
Welt im Alarmzustand
Die Wiederkehr nuklearer Abschreckung
Verschwunden war die nukleare Abschreckung nie, aber lange in den Hintergrund getreten. In einer Ära neuer Großmachtkonflikte – wie aktuell im Krieg Russlands gegen die Ukraine – gewinnt sie wieder an Bedeutung. Peter Rudolf analysiert die politischen und strategischen Ideen der Beteiligten, entschlüsselt den Nukespeak der Doktrinen und bietet so Orientierungswissen für eine dringend notwendige neue Nukleardebatte.
Richard Corbett
The Progressive Potential of the EU
What the EU is, why it matters, how it works, and how the centre-left can use it and reform it
What the EU is, why it matters and how it works, and how the centre-left can use and reform it - the first volume of the new [FEPS](https://www.feps-europe.eu/) Primers series offers readers exactly what the title promises: a comprehensive look at the history of the EU, its main policies, institutions, functioning and decision-making structures. It takes a look at areas worthy of reform, lists important centre-left figures in the EU's founding and development, and the most important terms of EU jargon.
Agnès Hubert
The European Union and Gender Equality
Free, Thrive, Lead
Agnès Hubert knows the EU and its women's and gender equality policies from her own many years as an expert. Her book gives a detailed overview of the history of gender equality in the EU, feminist policies, key actors, institutions, the cooperation of women's networks and organisations, the efforts, obstacles and occasional setbacks on the way to a more equal EU. It highlights the main milestones along the way, from equal pay to protection against domestic violence, from the first legislative measures to the impact of the covid-19 pandemic.
Peter Rudolf
Welt im Alarmzustand
Die Wiederkehr nuklearer Abschreckung
Weg war die nukleare Abschreckung nie, aber lange in den Hintergrund getreten. In einer Ära neuer Großmachtkonflikte – wie aktuell im Krieg Russlands gegen die Ukraine – gewinnt sie neue Bedeutung. Das NATO-Mitglied Deutschland neigt jedoch dazu, den militärischen und politischen Problemen sowie moralischen Dilemmata nuklearer Abschreckung auszuweichen. Dabei muss klar sein: Eine neue Debatte über die Legitimität nuklearer Abschreckung ist notwendig!
eBook
Chiara Valentini
Der eigenartige Genosse Enrico Berlinguer
Kommunist und Demokrat im Nachkriegseuropa
Aus dem Italienischen übersetzt von Klaus Pumberger, Cristiana Dondi und Andrea Bertazzoni
Enrico Berlinguer ist eine Schlüsselfigur der politischen Geschichte Italiens. Von 1972 bis 1984 war er Generalsekretär der Kommunistischen Partei Italiens, der größten in einem westlichen Land. Er gilt als Vater des »Eurokommunismus«. Wie kam es, dass Berlinguer diese neue Konzeption eines demokratischen Kommunismus entwickelte und damit neue Wege ging? Worin liegt Berlinguers Bedeutung heute?
Andreas Audretsch
Zusammen wachsen
Eine neue progressive Bewegung entsteht
»Wir erleben eine Zeitenwende« – die Bedrohungslage, auf die Bundeskanzler Olaf Scholz im Februar 2022 reagiert, hat nicht mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine begonnen. Reaktionäre und rechtsextreme Kräfte arbeiten seit Jahren weltweit daran, imperiales Denken gesellschaftsfähig zu machen – genau wie Menschenverachtung und die Leugnung der Klimakrise. Die Antwort darauf müssen wir gemeinsam geben. Es gibt Grund zur Hoffnung: Millionen Menschen schließen sich zusammen, schmieden breite Allianzen, um eine Gesellschaft der Gleichen und Freien zu schaffen und den Planeten zu retten. Industriearbeiter, »Fridays for Future«, Unternehmerinnen, Queer-FeministInnen, (post)migrantische Organisationen, Nonnen und Imame – Seite an Seite. Welche Beispiele für solche Allianzen gibt es? Wie nutzen sie verbindende Erfahrungen und Werte? Und was braucht es, um eine starke gemeinsame Bewegung zu bilden? Andreas Audretsch warnt davor, Bewegungen gegeneinander auszuspielen und plädiert dafür, altes Lagerdenken unter progressiven Kräften zu überwinden.
Armin Pfahl-Traughber
Intellektuelle Rechtsextremisten
Das Gefahrenpotenzial der Neuen Rechten
eBook
Marc Saxer
Transformative Realism
How to overcome the system crisis
Übersetzt von Ray Cunningham
What is Transformative Realism? It is the recognition that in order to overcome the financial, euro, climate, democracy, corona crises, we need to transform our political, economic, social, and cultural order from head to toe. However, a reality check shows that transformative politics does not seem feasible. The challenge is not so much that there are no solutions to our problems or that there are no actors willing to make a change. A realistic view of the balance of societal forces shows that those who benefit from, or believe that they benefit from the status quo form a formidable bloc of resistance which no social movement, social entrepreneur or even nation state can break through by themselves.
Gerhard Stahl
China
Zukunftsmodell oder Albtraum? Europa zwischen Partnerschaft und Konfrontation
China wird unsere Zukunft bestimmen. Nicht nur unser Wohlstand hängt vom Handel mit der aufstrebenden Wirtschaftsmacht ab. Globale Probleme, allen voran der Klimawandel, können nur mit Chinas Mitarbeit bewältigt werden. Viele sehen in der kommunistischen Volksrepublik eine Gefahr für die internationale Ordnung, für Frieden und Demokratie. Europa muss einen Weg finden, mit China umzugehen. Dafür müssen wir dieses riesige Land mit seiner Geschichte und Politik besser verstehen.
eBook
Rita Süssmuth
Parität jetzt!
Wider die Ungleichheit von Frauen und Männern
Eine Streitschrift
»Männer und Frauen sind gleichberechtigt.« Dieser Satz wurde vor über 70 Jahren im Grundgesetz verankert, aber politisch fehlt bis heute der Wille zur konsequenten Umsetzung. Rita Süssmuth kämpft gegen die Folgen der Ungleichheit, erklärt ihre historischen Wurzeln und sagt, was geschehen muss für eine bessere Zukunft. »Wir Frauen«, so die ehemalige Bundestagspräsidentin, »wurden immer schon gebraucht, aber mit unseren Fähigkeiten und Kompetenzen nicht anerkannt.«
Jannis Sakellariou
Migrationshintergrund
Erlebnisse eines Europäers
Humorvoll und spannend erzählt Jannis Sakellariou, gebürtiger Grieche, von den Hürden seiner deutschen Einbürgerung, seinen Schwierigkeiten, in den 1960er-Jahren in Deutschland beruflich Fuß zu fassen, und nicht zuletzt von seinem lebenslangen Engagement für Frieden und Demokratie.
Rita Süssmuth
Parität jetzt!
Wider die Ungleichheit der Geschlechter – Anspruch und Realität Eine Streitschrift
eBook
Ilse Fischer (Hg.)
Die SPD unter Kurt Schumacher und Erich Ollenhauer 1946 bis 1963
Sitzungsprotokolle der Spitzengremien Bd. 4: 1952 bis 1954
Mit diesem Band wird die Edition der Sitzungsprotokolle der SPD-Führungsgremien fortgesetzt. Nach dem Tod Kurt Schumachers wurde Erich Ollenhauer im September 1952 zum Parteivorsitzenden gewählt. Ollenhauers Führungsstil war stärker durch Kooperation und Bemühungen um die Einbindung der verschiedenen Richtungen innerhalb der Partei charakterisiert. Die SPD stand in diesen Jahren in grundsätzlicher Opposition zu außenpolitischen Richtungsentscheidungen der Regierung Adenauer, u.a. beim EVG- und General-Vertrag. Auch die Fluchtbewegung aus der DDR, der Aufstand des 17. Juni 1953 und der Bundestagswahlkampf 1953 spielten in den Diskussionen eine Rolle.
Markus Trömmer / Wolfgang Schroeder (Hg.)
Rechtspopulismus. Zivilgesellschaft. Demokratie
Die Zivilgesellschaft steht unter Druck. Meist ist sie mit der Vorstellung von humanistischen, demokratischen Werten und gemeinwohlorientiertem Engagement verbunden. In Wirklichkeit aber wird sie von rechten Akteuren bedroht, die versuchen, bestehende Konflikte und kontroverse Themen zu instrumentalisieren, um in der Zivilgesellschaft Fuß zu fassen. In diesem Band zeigen die Autorinnen und Autoren, wie und mit welchen Mitteln rechtspopulistische Akteure dabei vorgehen und beleuchten Möglichkeiten, wie eine wehrhafte Demokratie darauf reagieren kann.
René Cuperus
7 Mythen über Europa
Plädoyer für ein vorsichtiges Europa
Wie kann Europa seine Wählerinnen und Wähler von sich überzeugen? Mit Ehrlichkeit! Der niederländische Historiker René Cuperus hat viele Regierungen beraten. Er räumt auf mit sieben zentralen Mythen utopischer Pro-EU-Föderalisten wie auch fremdenfeindlicher Anti-EU-Populisten.
Klaus Schubert / Martina Klein
Das Politiklexikon
Begriffe. Fakten. Zusammenhänge.
Immer wieder neu, stets aktuell: Das bewährte Lexikon im Taschenbuchformat geht in seine 8. Auflage. Überarbeitet und erweitert im Corona- und Bundestagswahljahr, mit über 1.600 Stichwörtern und mehr als 50 übersichtlichen, nützlichen Tabellen und Grafiken sowie Karten zu Deutschland, Europa und der Welt. Ein unentbehrliches Hilfsmittel für alle politisch interessierten und aktiven Leserinnen und Leser.
Frank Decker
Baustellen der Demokratie
Von Stuttgart 21 bis zur Corona-Krise
Ansehensverlust der politischen Institutionen, dramatischer Wandel der Parteien- und Koalitionslandschaft, Aufstieg des Rechtspopulismus – die Demokratie gerät heute von vielen Seiten unter Druck. Warum gelingt eine Wahlrechtsreform nicht? Brauchen wir andere Formen der politischen Beteiligung jenseits der Parteiendemokratie? Woher rühren die Misere der Volksparteien und der Erfolg der AfD? Wie kommen wir zu »mehr Demokratie« in der EU? Die Herausforderungen unserer Demokratie auf allen politischen Ebenen sind mannigfach.
Friedrich-Ebert-Stiftung (Hg.)
Archiv für Sozialgeschichte, Bd. 61 (2021)
Eliten und Elitenkritik vom 19. bis zum 21. Jahrhundert
Als Profiteure der Globalisierung sind Eliten in Verruf geraten. Die Machthabenden in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft und die »Superreichen« werden als abgehobene Akteure wahrgenommen, die den Kontakt zur Bevölkerung verloren hätten. In der Geschichte hatten sie aber lange auch ein positives Image. Ihnen wurden unverzichtbare Qualifikationen, Fähigkeiten zur Führung und ein hohes Leistungsvermögen zugeschrieben.
Ami Ajalon
mit Anthony David
Im eigenen Feuer
Wie Israel sich selbst zum Feind wurde und die jüdische Demokratie trotzdem gelingen kann
Erinnerungen eines Geheimdienstchefs
Mit einem Geleitwort von Daniel Barenboim
Der frühere israelische Geheimdienstchef und sozialistische Knesset-Abgeordnete Ami Ajalon war das, was man einen »Falken« nennt. Aber er machte eine Wandlung durch. Ihm wurde klar, dass sein patriotisches Leben ihn blind gemacht hatte für die selbstzerstörerische Natur einer Politik, die Israels Zivilgesellschaft untergräbt und gleichzeitig seine palästinensischen Nachbarn erniedrigt. Mit großer Ehrlichkeit und Offenheit schreibt er über sein Leben im Anti-Terror-Krieg und über Israels Weg der vergangenen Jahrzehnte.
Franziska Richter (Hg.)
Traumland
Wer wir sind und sein könnten
Identität & Zusammenhalt in Ost und West
Mit zahlreichen Abbildungen, vierfarbig
Über 50 Autor\*innen verschiedener Generationen aus Ost- und Westdeutschland begeben sich auf die Reise in ein »Traumland«. Ausgehend von einem Kunstwerk entwickeln sie Visionen für einen stärkeren gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Matthias Pfeffer
Menschliches Denken und Künstliche Intelligenz
Eine Aufforderung
»Intelligente« Maschinen umgeben uns überall. Doch was macht digitale Technik mit uns, was macht Künstliche Intelligenz mit unserer Vernunft? Verstehen wir, wie sie uns dient, aber auch beherrscht? Nein! Und diese Unklarheit ist gewollt, sagt Matthias Pfeffer. Was wir von Künstlicher Intelligenz erwarten dürfen und was wir heute tun müssen, damit wir morgen noch selbstbestimmt leben können – davon handelt dieses Buch. Es ist eine Einladung, über die Verführungskraft intelligenter Technologien nachzudenken. Und eine Aufforderung, Künstliche Intelligenz nicht ohne menschliches Denken einzusetzen.
Rita Brockmann-Wiese
Schluss. Aus. Vorbei!
Wenn nur die Scheidung hilft
Erlebnisse einer Familienanwältin
Welche seltsamen Wege können Beziehungen gehen? Die Statistik ist eindeutig: In den letzten 20 Jahren wurde von zwei geschlossenen Ehen eine wieder geschieden. Aber was machen die Menschen mit ihrer einstigen Liebe? Welche bizarren Blüten treibt oft jahrelang aufgestauter Hass bis in juristische Auseinandersetzungen hinein? Davon weiß die bekannte Hamburger Scheidungsanwältin Rita Brockmann-Wiese zu berichten. Die erzählten Fälle sind – so bizarr sie anmuten mögen – häufige Realität in deutschen Familien.
Michael Bröning
Vom Ende der Freiheit
Wie ein gesellschaftliches Ideal aufs Spiel gesetzt wird
Was bedeutet Freiheit in Zeiten der Pandemie? Ist der Kampf gegen den Klimawandel zwangsläufig ein Kampf gegen freie Selbstbestimmung? Wie kann eine offene Debatte unter Bedingungen der totalen Vernetzung und der allgegenwärtig beschworenen politischen Alternativlosigkeit verteidigt werden? Und: Wer schützt unsere Gesellschaften vor dem schleichenden Gift identitätspolitischer Spaltung?
Dietmar Süß / Cornelius Torp
Solidarität
Vom 19. Jahrhundert bis zur Corona-Krise
Alle beschwören in der Corona-Pandemie die Solidarität – doch niemand weiß so recht, was das heißt: solidarisch sein! Höchste Zeit, diesen alten Begriff zu entstauben und neu unter die Lupe zu nehmen. Dietmar Süß und Cornelius Torp erzählen seine spannende Geschichte voller Widersprüche, großer Gefühle und enttäuschter Erwartungen. Sie zeigen, wie umkämpft die Idee wechselseitiger Verbundenheit zu unterschiedlichen Zeiten war – und wie notwendig Solidarität für die Bewältigung gegenwärtiger Konflikte ist.
Christoph Ehmann
Das Glück bauen – die Welt verändern
Die Stadtplaner und Architekten Bruno Taut und Martin Wagner
Mit zahlreichen Abbildungen
Bruno Taut und Martin Wagner schufen in den 1920er- und 1930er-Jahren Großsiedlungen der Moderne, die zum Vorbild für den sozialen Wohnungsbau wurden und heute zum Weltkulturerbe gehören. Über Bruno Taut gibt es viel, über Martin Wagner wenig Gedrucktes. Christoph Ehmann schildert erstmals die enge Verbindung der beiden Architekten, ihre nahezu anderthalb Jahrzehnte dauernde fruchtbare Zusammenarbeit und die Realisierung ihrer politischen Visionen. Martin Wagner gab den Anstoß dafür, dass die Gewerkschaften gemeinnützige Einrichtungen schufen und so für ihre Mitglieder menschenwürdigen, schönen und bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung stellten. Dies wurde als sozialistisch gebrandmarkt. Taut und Wagner mussten nach dem 30. Januar 1933 Deutschland verlassen und gerieten lange Zeit in beabsichtigte Vergessenheit. Christoph Ehmann würdigt die beiden Pioniere, die sich getroffen und während ihrer gemeinsamen Arbeit Weltkultur geschaffen haben.
Gleb J. Albert / Daniel Siemens / Frank Wolff (Hg.)
Entbehrung und Erfüllung
Praktiken von Arbeit, Körper und Konsum in der Geschichte moderner Gesellschaften
Wie lassen sich die zentralen Fragen der klassischen Gesellschaftsgeschichte für eine Geschichtswissenschaft der Gegenwart weiterentwickeln? Thomas Welskopps Arbeiten fokussieren auf die komplexen Interaktionen zwischen Menschen und Strukturen in modernen Gesellschaften. Das Resultat ist eine hochgradig anschlussfähige praxeologische Geschichte von Vergesellschaftung, die viel Raum für empirische Nuancen lässt und dennoch im besten Sinne theoriebildend ist.
Niklas Frank
Meine Familie und ihr Henker
Der Schlächter von Polen, sein Nürnberger Prozess und das Trauma der Verdrängung
Hans Frank, genannt »Der Schlächter von Polen«, war Angeklagter im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess, wo Tag für Tag die entsetzlichsten NS-Verbrechen gegen die Menschlichkeit verhandelt wurden. Am 1. Oktober 1946 verurteilte das Gericht ihn zum Tod durch den Strang. Plötzlich waren die Franks herausgerissen aus Reichtum und Selbstherrlichkeit, in Armut und Verachtung gestürzt. Wie ging die Familie damit um? Und wie ging der daran Hauptschuldige Hans Frank damit um? Erstmals wird durch seinen Sohn Niklas die private Seite dieses Prozesses aufgezeigt, der die Weltgerichtsbarkeit auf eine neue Stufe stellte.
Maak Flatten
Scharnierzeit der Entspannungspolitik
Willy Brandt als Außenminister der Großen Koalition (1966–1969)
Willy Brandt, der wirkmächtigste deutsche Außenminister nach Gustav Stresemann, war vor allem Realist und Pragmatiker. In seiner Zeit als Außenminister der Großen Koalition (1966–1969) vollzog sich die entscheidende Metamorphose seiner ost- und deutschlandpolitischen Konzeption. Dabei hielt er stets am Ziel der Wiederherstellung der deutschen Einheit fest.
Reiner Hoffmann (Hg.)
Arbeit aufwerten – Demokratie stärken
Gewerkschaftliche Gestaltungsperspektiven
Ein Leben in Würde, materielle und soziale Sicherheit, Anerkennung und gesellschaftliche Teilhabe – dies macht den Wert der Arbeit aus. Digitalisierung und Klimapolitik fordern den Wert der Arbeit heraus, prekäre Beschäftigungsverhältnisse beschädigen ihn und damit den Zusammenhalt des demokratischen Gemeinwesens. Auf diese Herausforderungen antworten Gewerkschaften mit einer aktiven Gestaltungspolitik für gute Arbeit.
Michael Krennerich
Free and Fair Elections?
Standards, Curiosities, Manipulations
Elections take place around the world. However, not every election is a democratic one. Examining electoral law, electoral organization and electoral systems, the study illustrates how national elections are conducted in democracies and autocracies in a clear and easy-to-understand way. In addition to introductory considerations of electoral theory, the book contains a range of legal and practical overviews and country examples, as well as a number of curiosities and cases of election manipulation. Election regulations in Germany are not left unmentioned either. A book full of interesting election details that provides a nuanced view of the entire election cycle.
Gerd Mielke / Fedor Ruhose
Zwischen Selbstaufgabe und Selbstfindung
Wo steht die SPD?
Nicht die Globalisierung, nicht kulturelle Umbrüche und schon gar nicht das immer wieder von Konservativen und Liberalen verkündete Ende des sozialdemokratischen Zeitalters sind schuld an der Misere der SPD. Die wahren Ursachen der Krise liegen in der Partei selbst. Indem sie auf Distanz zur eigenen Tradition gegangen sind, haben die Sozialdemokraten ihren Kompass verloren, und ihre klassische Rolle als linke Volkspartei ist in Gefahr.
Dolly Hüther
Ich bleibe!
Ein politisches Leben – gestern und heute
Mit einem Vorwort von Reinhard Klimmt
Lust auf Politik als wichtiger Faktor gehört in jedes Leben, davon ist Dolly Hüther überzeugt. Mut haben zur Ehrlichkeit, gradlinig sein bis zur Schmerzgrenze – das brauchte es, um fünf Jahrzehnte lang als Frau Politik für Frauen zu machen. Ihre erzählerischen und humorvollen Texte, Briefe und Erinnerungen sind kompromisslose Zeugnisse einer Frau, die sich auch heute noch nichts vorschreiben lassen will.
Andreas Zick / Beate Küpper (Hg.)
Die geforderte Mitte
Rechtsextreme und demokratiegefährdende Einstellungen in Deutschland 2020/21
Selten war die gesellschaftliche Mitte so »gefordert« wie jetzt. Rechtsextremismus, Populismus, Rassismus setzen ihr zu. Alle zwei Jahre untersucht die FES-»Mitte-Studie« rechtsextreme und demokratiegefährdende Einstellungen in der deutschen Gesellschaft. Die aktuelle repräsentative Umfrage von Dezember 2020 bis Frühjahr 2021 zeigt: Die »Mitte« ist gefordert, Haltung zu zeigen, Position zu beziehen und ihre Demokratie zu stärken! Dazu hat sie das Potenzial.
David Ranan (Hg.)
Sprachgewalt
Missbrauchte Wörter und andere politische Kampfbegriffe
Mit Sprache wird manipuliert, Macht und Gewalt ausgeübt. Fake News, über Medien verbreitet, schaffen Verunsicherung. Der Vorwurf Terrorist oder Antisemit kann über Karrieren, selbst über Leben und Tod entscheiden. Die Essays in diesem Band untersuchen zentrale politische Begriffe auf ihren Missbrauch. Wer benutzt sie wie, wann und wozu? Kritische Wachsamkeit ist geboten, wenn jemand die Welt mit ein paar Wörtern in Gut und Böse einteilt, Verbrechen entschuldigt, Gegner vernichtet und uns zu seinen Komplizen machen will.
Martin Hecht
Die Einsamkeit des modernen Menschen
Wie das radikale Ich unsere Demokratie bedroht
Der moderne Individualismus ist zum Problem der westlichen Staaten geworden. Die Befreiung des Ichs führt in übersteigerte Ansprüche nach dem perfekten Leben. Bleibt es aus, folgen Enttäuschung, Aggression, Protest. Am Ende entlädt sich der Frust in der Ablehnung eines ganzen gesellschaftlichen Systems, im Extremfall in Hass. So gefährdet der Individualismus die Demokratie. Ist er als Idee noch zukunftsfähig?
Thomas Meyer (Hg.)
Soziale Demokratie
Wege und Ziele
1946 gegründet, begleitet die Zeitschrift Frankfurter Hefte bis heute die politischen Debatten der Bundesrepublik – seit 1985 als Teil der Neuen Gesellschaft/Frankfurter Hefte. Die Chefredakteure und Herausgeber, darunter Eugen Kogon und Walter Dirks, Willy Brandt und Peter Glotz, haben es stets verstanden, renommierte internationale und deutsche Autor*innen aus Politik, Wissenschaft, Gewerkschaften und Journalismus zu gewinnen. Diese drei Bände versammeln nun, nach thematischen Schwerpunkten gegliedert, herausragende Beiträge der letzten Jahrzehnte.
Hans-Peter Bartels
Unsere Demokratie
Freiheit, Vielfalt, Wehrhaftigkeit
Demokratie vererbt sich nicht von selbst, sie braucht aktive Demokraten, auch und vor allem unter den Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern in Uniform und der Exekutive in Deutschland. Wie aber funktioniert die gefestigte Demokratie unseres Grundgesetzes im Alltag? Was bedeutet Parlamentsarmee? Wo gibt es Defizite und Reformbedarf? In diesem knappen Band führt der ehemalige Wehrbeauftragte des Bundestages Hans-Peter Bartels ein in unsere Demokratiegeschichte, Grundrechte und Wehrverfassung sowie die politische Praxis der Bundesrepublik Deutschland.
Michael Frenzel / Matthias Machnig / Ines Zenke (Hg.)
Postcoronomics
Neue Ideen für Markt, Staat und Unternehmen
Schon vor der Pandemie hat die deutsche Wirtschaft eine fundamentale Transformation durchlebt. Doch durch Corona wurden die langfristigen Trends, aber auch die Folgen alter Versäumnisse noch einmal auf dramatische Weise deutlich. Die wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit Deutschlands muss durch eine wissensbasierte Ökonomie, ökologische Transformation, mehr Verteilungsgerechtigkeit, Klimaschutz und Digitalisierung sowie eine kluge Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik gesichert werden. Was aber ist ökonomisch derzeit möglich und welche Antworten gibt es?
Stephan Schmauke
Der Weg zur Promotion
Strukturiert und gelassen zum Doktortitel
Dieser neue Ratgeber ist die perfekte Hilfestellung für alle, die das Mammutprojekt Promotion vor sich haben. Promovierende müssen heute den Anforderungen eines verschulten Wissenschaftsbetriebes genügen, ohne die hohen Ansprüche an wissenschaftliches Arbeiten aufzugeben. Sie wollen zügig vorankommen und zugleich den Überblick behalten. Das Schreiben der Dissertation erfordert eine strukturierte Planung und Durchhaltevermögen. Und vor allem ein Selbstbewusstssein, das sich durch die allfälligen Probleme auf dem Weg zur Promotion nicht aus der Ruhe bringen lässt.
eBook
Willi Jasper
Faust oder Mephisto?
Europas Intellektuelle – eine aktuelle Krisengeschichte
Wo sind die kritischen Streiter, die geistigen Kraftzentren, die die Debatten über die EU, Pandemiegesetze oder die Zukunft der Demokratie anführen? Sind sie im Medienwandel untergegangen? Auf welche Weise haben die Intellektuellen den europäischen Einigungsprozess beeinflusst? Und was tun sie heute in der Corona-Krise? Haben sie Europa verlassen? Gar verraten, wie schon Julien Benda vor gut 100 Jahre meinte? Es gibt sie nicht mehr, jedenfalls als Typus. Dies ist ein enormer kultureller und politischer Verlust.
Stephan Schmauke
Der Weg zur Promotion
Strukturiert und gelassen zum Doktortitel
Dieser neue Ratgeber ist die perfekte Hilfestellung für alle, die das Mammutprojekt Promotion vor sich haben. Promovierende müssen heute den Anforderungen eines verschulten Wissenschaftsbetriebes genügen, ohne die hohen Ansprüche an wissenschaftliches Arbeiten aufzugeben. Sie wollen zügig vorankommen und zugleich den Überblick behalten. Das Schreiben der Dissertation erfordert eine strukturierte Planung und Durchhaltevermögen. Und vor allem ein Selbstbewusstsein, das sich durch die allfälligen Probleme auf dem Weg zur Promotion nicht aus der Ruhe bringen lässt.
Dirk Koch
Der Schützling
Stasi-Agent Adolf Kanter, Helmut Kohl, die Korruption und die größte Spionage-Affäre der Bundesrepublik
»Fichtel« nannte sich der erfolgreichste DDR-Spion in Westdeutschland – Adolf Josef Kanter saß im konservativen Herzen der deutschen Wirtschaft: Er war die rechte Hand von Flick-Manager Eberhard von Brauchitsch, schmierte fast die gesamte Bonner Politikelite mit illegalen Spendengeldern und förderte die politische Karriere Helmut Kohls. Keiner lieferte HVA-Chef Markus Wolf in Ostberlin so viele sensible Informationen. 40 Jahre lang konnte Kanter ungehindert berichten, kaltblütig, unauffällig, effizient. Dirk Koch, ehemaliger Hauptstadtkorrespondent des SPIEGEL, der den Flick-Skandal aufdeckte, legt eine atemberaubende Enthüllungsgeschichte vor.
Marc Saxer
Transformativer Realismus
Zur Überwindung der Systemkrise
Wer politisch die Richtung wechseln will, stößt meist auf Widerstand und Status-quo-Denken. Doch um die Klima-, Europa- Finanz-, Ungleichheits- und Demokratiekrise zu überwinden, sind Strategiewechsel unumgänglich. Leider verliert die progressive Linke bei ihren Lösungsansätzen oft die Realität gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse aus dem Blick. Marc Saxer entwickelt Wege, wie man den erforderlichen Wandel politisch durchsetzen kann.
Willi Carl / Martin Gorholt / Sabine Hering (Hg.)
Sozialdemokratie in Brandenburg (1868–1933)
Lebenswege zwischen Aufbruch, Aufstieg und Abgrund
Die Frauen und Männer, deren Lebenswege in diesem Band nachgezeichnet werden, haben das Land Brandenburg seit Ende des 19. Jahrhunderts revolutionär oder reformerisch geprägt – in der Frauenbewegung, den Gewerkschaften und in der Sozialdemokratischen Partei. Dank ihres Einsatzes war das »rote Brandenburg« bis zum Ende von Weimar ein »Bollwerk gegen den Faschismus«.
Friedrich-Ebert-Stiftung (Hg.)
Archiv für Sozialgeschichte, Band 60 (2020)
»Hoch die internationale…«? Praktiken und Ideen der Solidarität
Nicht erst seit der Corona-Krise ist Solidarität in aller Munde. Mit dem Begriff werden geteilte Werte und Interessen, die Unterstützung von Anderen und soziale Forderungen zum Ausdruck gebracht. Solidarität wird mit Gegenseitigkeit und Zusammenhalt, Loyalität und Selbstlosigkeit verbunden. Ihre Gültigkeit ist jedoch von Aushandlungen und Konflikten darüber verbunden, wer in das solidarische Handeln einbezogen wird und welche Personen ausgeschlossen bleiben. In der Geschichte von Arbeitskämpfen und Protestbewegungen, bei den Sozialversicherungen, in interna-tionalen Kampagnen oder gemeinschaftlichen Projekten wird Solidarität erlebt und eingefordert, aber auch unsolidarisches Verhalten angeprangert.
René Cuperus
7 Mythen über Europa
Plädoyer für ein vorsichtiges Europa
Wie kann Europa seine Wählerinnen und Wähler von sich überzeugen? Mit Ehrlichkeit! Der niederländische Historiker René Cuperus hat viele Regierungen beraten. Er räumt auf mit sieben zentralen Mythen utopischer Pro-EU-Föderalisten wie auch fremdenfeindlicher Anti-EU-Populisten.
eBook
Alfred Rosenbach
Ich, ein Sinto aus Remscheid
Aus dem Leben eines Prasapaskurom
Herausgegeben von Jörg Becker
Über 100 Fotografien von Uli Preuss
Alfred Rosenbach stammt aus Schlesien. Er war Hausierer, Teppich-, Schrott- und Kurzwarenhändler und lebte mit seiner Familie im Wohnwagen, bevor er in Remscheid sesshaft wurde. Als angesehener Ältester wurde er in das Ehrenamt eines »Prasapaskurom«, eines »Rechtsprechers« gewählt, wie schon sein Vater, der sich um die Angelegenheiten der großen Familie, die aus mehr als 200 Sinti besteht, gekümmert hat. In diesem Text-Bildband erzählt Rosenbach seine Geschichte und bringt Licht in das verborgene Leben einer Sinti-Familie mitten in Deutschland.
Andreas Reckwitz
Pandemie und Staat
Ein Gespräch über die Neuerfindung der Gesellschaft
Herausgegeben von Thomas Hartmann-Cwiertnia, Jochen Dahm, Christian Krell
Der Kultursoziologe denkt darüber nach, wie Staat und Gesellschaft sich durch die Corona-Pandemie neu erfinden könnten. Die Krise führt zu einer Renaissance des Staates, denn wir werden uns bewusst: Bestimmte Formen öffentlicher Regulierung sind gut und nötig. Bewegen wir uns auf einen gezähmten, eingebetteten Liberalismus zu?
Joseph Stiglitz
Pandemie und Markt
Ein Gespräch über eine gerechte Weltwirtschaft
Herausgegeben von Thomas Hartmann-Cwiertnia, Jochen Dahm, Christian Krell
Der amerikanische Wirtschaftsnobelpreisträger spricht über neue Leitplanken für eine gerechtere Weltwirtschaft. Passgenaue öffentliche Ausgaben, vor allem Investitionen in die grüne Wirtschaft, sind das Gebot der Stunde. Können wir die nationalen Wirtschaften nach Corona wiederaufrichten? Ja, aber nur mit mehr Kooperation, nicht weniger!
Heinz Bude
Pandemie und Gesellschaft
Ein Gespräch über eine Zeitenwende
Herausgegeben von Thomas Hartmann-Cwiertnia, Jochen Dahm, Christian Krell
Der Kassler Soziologe spricht über die wachsende Bedeutung von Solidarität in Corona-Zeiten. Er sieht neues Potenzial für eine Gesellschaft, in der sich die Menschen wieder umeinander kümmern. Und die Pandemie hat gezeigt, dass der schützende Staat immer wichtiger wird.
Dirk Koch
Der Schützling
Stasi-Agent Adolf Kanter, Helmut Kohl, die Korruption und die größte Spionage-Affäre der Bundesrepublik
eBook
Martin Hecht
Die Einsamkeit des modernen Menschen
Wie das radikale Ich unsere Demokratie bedroht
eBook
Christoph Wunnicke
Kleine Geschichte der Demokratie in Sachsen
Vom Gottesgnadentum zum Grundgesetz
Kaum zu glauben? Und doch! Was Griechenland für Europa, ist Sachsen für Deutschland: die Wiege seiner Demokratie. Hier wurden wichtige theoretische und praktische Marksteine der deutschen Demokratieentwicklung gesetzt. Bis heute ist der Widerspruchsgeist im Freistaat verwurzelt. Diesem politischen Schatz widmet sich Christoph Wunnickes lesenswerte Geschichte der sächsischen Demokratie.
Gesine Schwan
Pandemie und Solidarität
Ein Gespräch über gesellschaftlichen Zusammenhalt
Herausgegeben von Thomas Hartmann-Cwiertnia, Jochen Dahm, Christian Krell
Die Politikwissenschaftlerin spricht über Zusammenhalt in der Corona-Pandemie. Sie sieht die Zeit gekommen für progressive Akteure, die Brücken bauen zwischen den Generationen, zwischen den Geschlechtern, zwischen den unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen. Bringt Corona eine neue Zeit des Gemeinsinns?
Teresa Bücker
Pandemie und Geschlechter
Ein Gespräch über eine feministische Zukunft
Herausgegeben von Thomas Hartmann-Cwiertnia, Jochen Dahm, Christian Krell
Die Journalistin und Feministin erklärt, wie hart Corona vor allem Frauen trifft – alte, längst überwunden geglaubte Geschlechterrollen kehren mit der Krise zurück. Gleichberechtigung scheint zweitrangig zu sein. Was heißt das für die Politik? Wie sieht die Vision einer feministischen Zukunft aus?
Lisa Herzog
Pandemie und Arbeit
Ein Gespräch über eine demokratische Wirtschaft
Herausgegeben von Thomas Hartmann-Cwiertnia, Jochen Dahm, Christian Krell
Die politische Philosophin meint: Corona hat uns daran erinnert, dass wir soziale Wesen sind, auch in der Arbeitswelt. Die Digitalisierung hat sich enorm beschleunigt – aber reicht das? Arbeit ist Zusammenhalt, Sinn und Grundlage unseres Staatswesens. Wie wollen wir die Jobs der Zukunft gestalten?
Stefanie Coché / Hedwig Richter (Hg.)
Legitimierung staatlicher Herrschaft
in Demokratien und Diktaturen
Festschrift für Ralph Jessen
Staatliche Herrschaft stand im 20. Jahrhundert immer wieder vor Legitimierungsproblemen. Dies gilt sowohl für westlich demokratische Staaten als auch für autoritäre Regime. Die Beiträge des vorliegenden Bandes diskutieren die unterschiedlichen Formen staatlicher Legitimation im historischen Kontext.
Thomas Meyer (Hg.)
Ach, Europa!
1946 gegründet, begleitet die Zeitschrift Frankfurter Hefte bis heute die politischen Debatten der Bundesrepublik – seit 1985 als Teil der Neuen Gesellschaft/Frankfurter Hefte. Die Chefredakteure und Herausgeber, darunter Eugen Kogon und Walter Dirks, Willy Brandt und Peter Glotz, haben es stets verstanden, renommierte internationale und deutsche Autor*innen aus Politik, Wissenschaft, Gewerkschaften und Journalismus zu gewinnen. Diese drei Bände versammeln nun, nach thematischen Schwerpunkten gegliedert, herausragende Beiträge der letzten Jahrzehnte.
Thomas Meyer (Hg.)
Migration und Integration
Berichte und Debatten
1946 gegründet, begleitet die Zeitschrift Frankfurter Hefte bis heute die politischen Debatten der Bundesrepublik – seit 1985 als Teil der Neuen Gesellschaft/Frankfurter Hefte. Die Chefredakteure und Herausgeber, darunter Eugen Kogon und Walter Dirks, Willy Brandt und Peter Glotz, haben es stets verstanden, renommierte internationale und deutsche Autor*innen aus Politik, Wissenschaft, Gewerkschaften und Journalismus zu gewinnen. Diese drei Bände versammeln nun, nach thematischen Schwerpunkten gegliedert, herausragende Beiträge der letzten Jahrzehnte.
Cas Mudde
Rechtsaußen
Extreme und radikale Rechte in der heutigen Politik weltweit
Aus dem Englischen übersetzt von Anne Emmert
Die politische Rechte rückt überall in den Mittelpunkt der Politik. Drei der größten Demokratien – Brasilien, Indien und die Vereinigten Staaten – haben rechtsradikale oder rechtspopulistische Regierungsführer. Gleichzeitig bauen Rechtsaußenparteien in Europa ihr Profil und ihre Basis aus. Mudde, international führender Experte für politischen Extremismus, stellt unser bisheriges Denken über konventionelle und rechte Politik infrage. Seine packende Analyse zeigt: Radikal rechts ist zum Mainstream geworden und in fast allen Gesellschaften der Welt akzeptiert.
Wolfgang Schroeder / Ursula Bitzegeio / Sandra Fischer (Hg.)
Digitale Industrie. Algorithmische Arbeit. Gesellschaftliche Transformation.
Medien, Politik, Medizin, Wirtschaft und Industrie – Künstliche Intelligenz und Digitalisierung sind aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Doch was sind sie: Helfer für ein besseres Morgen oder ein (un)bequemes Joch, das uns kontrolliert? In welchem Verhältnis stehen die neuen Technologien zur Menschenwürde, zur Verfassung, wie beeinflussen sie unsere Informationswelt, unser Konsumverhalten und unser politisches System?
Thomas Hartmann-Cwiertnia / Jochen Dahm / Frank Decker (Hg.)
Utopien
Für ein besseres Morgen
Grenzenloses Wachstum? Lieber ökologische Kreislaufwirtschaft und Gemeinwohl! Zersetzende Ungleich heiten? Lieber eine Gesellschaft der Gleichen! Misstrauen in die Demokratie und ihre Akteure? Besser mehr Bürgerbeteiligung! Nationale Alleingänge? Lieber internationale Zusammenarbeit!
Harald Roth (Hg.)
Nie wegsehen
Vom Mut, menschlich zu bleiben
Wie oft schauen wir im Alltag weg? Verlassen uns darauf, dass Probleme von anderen gelöst werden? Haben Angst vor der eigenen (Zivil-)Courage und überlassen das Feld den Lautesten?
Erik Flügge
Egoismus
Wie wir dem Zwang entkommen, anderen zu schaden
Machen Egoisten Sie wütend? Zu Recht! Dennoch, Egoismus ist eine ganz natürliche Eigenschaft, genauso wie der Gemeinsinn. Beide müssen in Balance sein, damit eine Gesellschaft gelingt. Doch die ist bei vielen Menschen nicht mehr gegeben. Rettungskräfte werden angegriffen, wenn sie im Einsatz sind, Leute drängeln sich vor, denken zuerst und zum Teil nur noch an sich. All das ist auch das Ergebnis der gesellschaftlichen Ordnung, die wir erschaffen haben. Wo jeder selbst vorsorgen soll, wo das Miteinander infrage gestellt wird, wo Egoisten bewundert werden statt schief angeschaut, da passiert so etwas.
Franz Müntefering
Das Jahr 2020+
Übers Einmischen, Mittun und ein gutes Stück Leben auch im Ältersein
Was kommt, wenn das Virus gezähmt ist?
Franz Müntefering denkt über die Bedingungen unseres Zusammenlebens nach, über Anerkennung und Solidarität zwischen Jüngeren und Älteren. Über die Chancen der Demokratie und die Bedeutung von Gleichwertigkeit. Über das Älterwerden und Ältersein als ein gutes Stück Leben. Auch über Einsamkeit und Sterben.
Katharina Hitschfeld / Uwe Hitschfeld / Christoph Bigalke (Hg.)
Gestern – Heute – Morgen
Neue Wege
Leipziger Impulse für die Deutsche Einheit
Mit zahlreichen Fotos
30 Jahre deutsche Vereinigung – ein Jubiläum, das auf vielfältige Art begangen und begleitet wird. Das Buch GESTERN HEUTE MORGEN will nicht die Geschichte der Deutschen Vereinigung erzählen, sondern spannende Geschichten, die sie erlebbar machen. Entscheider*innen von damals, die auch heute zu Teilen das wirtschaftliche und politische Leben prägen, berichten, welche Weichen in der unmittelbaren Nachwendezeit gestellt und welche Impulse für das Gedeihen der Stadt Leipzig und die Gestaltung des Vereinigungsprozesses gegeben wurden – die bis heute und für nachfolgende Generationen von Bedeutung sind.
Erik Flügge
Egoismus
Wie wir dem Zwang entkommen, anderen zu schaden
Machen Egoisten Sie wütend? Zu Recht! Dennoch, Egoismus ist eine ganz natürliche Eigenschaft, genauso wie der Gemeinsinn. Beide müssen in Balance sein, damit eine Gesellschaft gelingt. Doch die ist bei vielen Menschen nicht mehr gegeben. Rettungskräfte werden angegriffen, wenn sie im Einsatz sind, Leute drängeln sich vor, denken zuerst und zum Teil nur noch an sich. All das ist auch das Ergebnis der gesellschaftlichen Ordnung, die wir erschaffen haben. Wo jeder selbst vorsorgen soll, wo das Miteinander infrage gestellt wird, wo Egoisten bewundert werden statt schief angeschaut, da passiert so etwas.
eBook
Franz Müntefering
Das Jahr 2020+
Übers Einmischen, Mittun und ein gutes Stück Leben auch im Ältersein
Was kommt, wenn das Virus gezähmt ist?
Franz Müntefering denkt über die Bedingungen unseres Zusammenlebens nach, über Anerkennung und Solidarität zwischen Jüngeren und Älteren. Über die Chancen der Demokratie und die Bedeutung von Gleichwertigkeit. Über das Älterwerden und Ältersein als ein gutes Stück Leben. Auch über Einsamkeit und Sterben.
eBook
Birgit Lahann
Als endete an der Grenze die Welt
Nach der Wende – Geschichten einer untergegangenen Gesellschaft
Mit Fotografien von Ute Mahler, Karin Rocholl, Dieter Bauer u.a.
Gleich nach dem Mauerfall ging STERN-Autorin Birgit Lahann in die DDR – für sie als Westdeutsche ein »Land mit sieben Siegeln«. Begleitet von den Fotografinnen Ute Mahler und Karin Rocholl traf sie Heiner Müller, Ulrich Mühe, Friedrich Schorlemmer, Tamara Danz, Kurt Böwe, Gregor Gysi, Sascha Anderson, Eva-Maria Hagen, Wolf Biermann, Jürgen Fuchs oder Thomas Brussig und viele andere mehr. Und die Reise ging noch 30 Jahre weiter…
Franziska Richter (Hg.)
Echoräume des Schocks
Wie uns die Corona-Zeit verändert. Reflexionen Kulturschaffender und Kreativer. Eine Anthologie
Im Frühjahr 2020 erreichte die Corona-Pandemie auch Deutschland. Covid-19 löste Schallwellen aus,die ein großes Echo nach sich zogen. In 25 Beiträgen zeichnen Kulturschaffende und Kreative den Widerhall dieser Zeit auf, berichten von Ereignissen aus Politik und Gesellschaft und erzählen von Ängsten und Hoffnungen in ihrem Alltag im Ausnahmezustand. Sie vermessen den Schock, der den Kulturbereich in dieser Zeit getroffen hat, und stellen sich die Frage, wie Kunst und Kultur in und nach der Corona-Zeit gefördert beziehungsweise gestärkt werden können. Entstanden ist so ein berührendes, inspirierendes und authentisches Dokument der Corona-Zeit.
Peter Birle / Antonio Muñoz Sánchez
Partnerschaft für die Demokratie
Die Arbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung in Brasilien und Portugal
Mit einem Vorwort von Svenja Blanke
Band 14 der Reihe über die internationale Arbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung widmet sich den beiden portugiesischsprachigen Ländern Brasilien und Portugal. Die Autoren Peter Birle und Antonio Muñoz Sánchez schildern eindrucksvoll die Geschichte der Demokratieförderung der FES in Brasilien und Portugal und welche Früchte solche Beiträge zur Überwindung von Diktaturen und zum Aufbau demokratischer Strukturen tragen können. Ihre Ausführungen zeigen konkret, inwiefern sich die Demokratieförderung einer politischen Stiftung von der staatlichen Förderpolitik unterscheidet, diese ergänzt und zivilgesellschaftlich in Richtungen lenken kann, wie es die staatliche Politik nicht vermag.
Paul Nemitz / Matthias Pfeffer
Prinzip Mensch
Macht, Freiheit und Demokratie im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz
Mensch oder Algorithmus – Wer entscheidet im Zeitalter Künstlicher Intelligenz über unsere Zukunft? Überwältigend groß ist schon jetzt die Macht der digitalen Konzerne im Silicon Valley und damit die Bedrohung für Demokratie und Freiheit. Paul Nemitz und Matthias Pfeffer zeigen eindrücklich, wie die derzeitigen Versuche ethischer Regulierung von Künstlicher Intelligenz zu kurz greifen. Nemitz ist Mitglied der Datenethikkommission der Bundesregierung und war maßgeblich verantwortlich für die Einführung der EU-Datenschutzgrundverordnung. Pfeffer beschäftigt sich als freier TV-Journalist und Produzent mit dem Thema Künstliche Intelligenz.
Dierk Hirschel
Das Gift der Ungleichheit
Wie wir die Gesellschaft vor einem sozial und ökologisch zerstörerischen Kapitalismus schützen können
Das 21. Jahrhundert droht ein Jahrhundert der extremen Ungleichheit zu werden. Nicht nur zwischen Nord und Süd, West und Ost. Die Klassengesellschaft kehrt zurück – auch in Deutschland. Die soziale Spaltung gefährdet unsere Demokratie. Der Raubbau an der Natur zerstört die Zukunft unserer Kinder. Klimawandel, Armut und Kriege zwingen Millionen Menschen zur Flucht. Verantwortlich dafür ist ein entfesselter, sozial und ökologisch blinder Kapitalismus.
Winfried Veit
Europas Kern
Eine Strategie für die EU von morgen
Die Welt scheint aus den Fugen zu geraten. Der Westen und seine Bündnisse erodieren. Neue geopolitische Player wie China, Russland und Indien erobern die Weltbühne. Hinzu kommt, dass Europa von einem Krisenbogen aus zerfallenden Staaten und Bürgerkriegen umgeben ist. Wie steht die EU dazu? Spricht Europa mit einer Zunge? Ist es abwehrbereit, handlungsfähig und wirklich demokratisch verfasst? Nein, es ist gelähmt von inneren Krisen und divergierenden Interessen. »Mit 27«, so Winfried Veit, »wird das nichts«.
Andreas Audretsch / Claudia Gatzka (Hg.)
Schleichend an die Macht
Wie die Neue Rechte Geschichte instrumentalisiert, um Deutungshoheit über unsere Zukunft zu erhalten
Die Neue Rechte strebt in Europa an die Macht. Eine ihrer stärksten Strategien: die Instrumentalisierung von Geschichte, um ihre Weltsicht in den Köpfen der Menschen zu verankern. Mythen über die Nation, ihre Helden und Freiheitskämpfe sollen Nationalismus und völkisches Denken wieder gesellschaftsfähig machen. Das zeigt: Wir müssen um die Geschichte kämpfen, auf dass die liberalen Grundwerte unserer Gesellschaft eine Zukunft haben.
Werner Daum (Hg.)
Handbuch der europäischen Verfassungsgeschichte im 19. Jahrhundert
Institutionen und Rechtspraxis im gesellschaftlichen Wandel
Band 3: 1848-1870
unter Mitwirkung von Peter Brandt, Martin Kirsch und Arthur Schlegelmilch
Der vorliegende Band 3 setzt die vorangegangene Betrachtung der verfassungsgeschichtlichen Entwicklung Europas im 19. Jahrhundert fort: Die 28 Länderartikel eröffnen dank ihres einheitlichen Gliederungsschemas einen vergleichenden Zugang zur europäischen Verfassungsentwicklung 1848–1870. In ihrer ausführlichen Einleitung legen die Herausgeber mit einer vergleichenden Synthese der Länderbeiträge die Grundlage für künftige komparatistische Forschungen.
Stefan Müller
Die Ostkontakte der westdeutschen Gewerkschaften
Entspannungspolitik zwischen Zivilgesellschaft und internationaler Politik 1969 bis 1989
In den 1970er- und 1980er-Jahren unterhielt der Deutsche Gewerkschaftsbund intensive Kontakte zu den kommunistischen Staatsgewerkschaften Osteuropas. Über diese transnationalen Begegnungen ist bislang wenig bekannt. Entlang einer gewerkschaftshistorischen Studie lenkt Stefan Müller den Blick auf diese besonderen Beziehungen im Ost-West-Konflikt und lotet dabei die Potenziale der Neuen Ostpolitik aus.
Paul Nemitz / Matthias Pfeffer
Prinzip Mensch
Macht, Freiheit und Demokratie im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz
Mensch oder Algorithmus – Wer entscheidet im Zeitalter Künstlicher Intelligenz über unsere Zukunft? Überwältigend groß ist schon jetzt die Macht der digitalen Konzerne im Silicon Valley und damit die Bedrohung für Demokratie und Freiheit. Paul Nemitz und Matthias Pfeffer zeigen eindrücklich, wie die derzeitigen Versuche ethischer Regulierung von Künstlicher Intelligenz zu kurz greifen. Nemitz ist Mitglied der Datenethikkommission der Bundesregierung und war maßgeblich verantwortlich für die Einführung der EU-Datenschutzgrundverordnung. Pfeffer beschäftigt sich als freier TV-Journalist und Produzent mit dem Thema Künstliche Intelligenz.
eBook
Andreas Audretsch / Claudia Gatzka (Hg.)
Schleichend an die Macht
Wie die Neue Rechte Geschichte instrumentalisiert, um Deutungshoheit über unsere Zukunft zu erlangen
Die Neue Rechte strebt in Europa an die Macht. Eine ihrer stärksten Strategien: die Instrumentalisierung von Geschichte, um ihre Weltsicht in den Köpfen der Menschen zu verankern. Mythen über die Nation, ihre Helden und Freiheitskämpfe sollen Nationalismus und völkisches Denken wieder gesellschaftsfähig machen. Das zeigt: Wir müssen um die Geschichte kämpfen, auf dass die liberalen Grundwerte unserer Gesellschaft eine Zukunft haben.
eBook
Hans-Peter Bartels
Germany and a Europe of Defence
Global Responsibility Requires the End of Small-state Particularism
The question of whether Europe should develop its own defence capabilities has acquired a new urgency. Failing states and civil wars in Europe’s neighbourhood, cyber attacks, Russia, jihadists – these are only a few of the growing threats to peace and freedom. In the face of that, both NATO Europe and EU Europe are hampered by a kind of small-state particularism.
Kurt Thomas Schmitz
Die IG Metall nach dem Boom
Herausforderungen und strategische Reaktionen
Deutschlands erste Nachkriegsdekaden gelten zeithistorisch als »goldene Jahrzehnte«: Die Herausbildung wirtschaftlicher Prosperität ging einher mit der Entstehung stabiler demokratischer Institutionen und Verfahren, die ein robustes System der industriellen Beziehungen mit starken Akteuren ermöglichten.
Baha Güngör / Lale Akgün
Hüzün ... das heißt Sehnsucht
Wie wir Deutsche wurden und Türken blieben
Identität und Heimat, was bedeuten sie? Keiner schrieb so authentisch über diese Fragen wie Baha Güngör (1950–2018). 60 Jahre lang war er ein Grenzgänger zwischen den Kulturen. Der deutsche Journalist (und damals noch erste türkische Zeitungsvolontär der Bundesrepublik) erzählt mit viel Humor eine Integrationsgeschichte aus dem Herzen der ersten türkischen Gastarbeiter-Generation. Doch erklärt er auch, warum am Ende so viele Integrationsbemühungen zum Scheitern verurteilt waren und sich das Gefühl von Zugehörigkeit bis zum Schluss nicht einstellen mochte. Er starb, skeptischer geworden gegenüber seiner deutschen Heimat, bevor dieses Manuskript abgeschlossen werden konnte.
eBook
Nils Heisterhagen
Verantwortung
Für einen neuen politischen Gemeinsinn in Zeiten des Wandels
Wir brauchen ein republikanisches Wir gegen das Gespenst (neo-)liberaler Ich-Philosophie. Die politische Linke sollte die materiellen Bedürfnisse der Menschen wieder ins Zentrum ihrer Politik rücken. Und sie muss die Menschen auch wieder an ihre Pflichten als Bürger erinnern. Sie schulden sich einander etwas, und das ist mehr, als sich an Gesetze zu halten. Verantwortung trägt jeder: für sich, den Anderen und das Gemeinwohl.
eBook
Hans-Peter Bartels
Deutschland und das Europa der Verteidigung
Globale Mitverantwortung erfordert das Ende militärischer Kleinstaaterei
Die Frage der eigenen Verteidigungsfähigkeit Europas hat neue Aktualität gewonnen. Amerika, die frühere Schutzmacht, entfernt sich. Cyberattacken, Russland, Djihadisten – das sind nur ein paar Schlagworte für die unterschiedlichen, wachsenden Bedrohungen von Frieden und Freiheit. Dagegen steht die sicherheitspolitische Kleinstaaterei in Nato-Europa wie in EU-Europa.
eBook
Baha Güngör / Lale Akgün
Hüzün ... das heißt Sehnsucht
Wie wir Deutsche wurden und Türken blieben
Identität und Heimat, was bedeuten sie? Keiner schrieb so authentisch über diese Fragen wie Baha Güngör (1950–2018). 60 Jahre lang war er ein Grenzgänger zwischen den Kulturen. Der deutsche Journalist (und damals noch erste türkische Zeitungsvolontär der Bundesrepublik) erzählt mit viel Humor eine Integrationsgeschichte aus dem Herzen der ersten türkischen Gastarbeiter-Generation. Doch erklärt er auch, warum am Ende so viele Integrationsbemühungen zum Scheitern verurteilt waren und sich das Gefühl von Zugehörigkeit bis zum Schluss nicht einstellen mochte. Er starb, skeptischer geworden gegenüber seiner deutschen Heimat, bevor dieses Manuskript abgeschlossen werden konnte.
Niklas Frank
Auf in die Diktatur!
Die Auferstehung meines Nazi-Vaters in der deutschen Gesellschaft
Ein Wutanfall von Niklas Frank
Niklas Frank ist der Sohn von Hans Frank, Hitlers »Generalgouverneur« im besetzten Polen. Er erkennt in Rhetorik und Verhalten heutiger Politiker erschreckende Parallelen zur NS-Zeit. Der Hass, die Empathielosigkeit und der menschenverachtende Humor der Nationalsozialisten finden sich heute wieder in der AfD, aber auch bei anderen Vertretern aus Politik, Kultur, Sport, Kirchen etc. Frank warnt: »Jetzt tauchen wieder Väter von meines Vaters Art auf, die mein Hirn vergiften wollen.«
Nils Heisterhagen
Verantwortung
Für einen neuen politischen Gemeinsinn in Zeiten des Wandels
Wir brauchen ein republikanisches Wir gegen das Gespenst (neo-)liberaler Ich-Philosophie. Die politische Linke sollte die materiellen Bedürfnisse der Menschen wieder ins Zentrum ihrer Politik rücken. Und sie muss die Menschen auch wieder an ihre Pflichten als Bürger erinnern. Sie schulden sich einander etwas, und das ist mehr, als sich an Gesetze zu halten. Verantwortung trägt jeder: für sich, den Anderen und das Gemeinwohl.
Niklas Frank
Auf in die Diktatur!
Die Auferstehung meines Nazi-Vaters in der deutschen Gesellschaft
Ein Wutanfall von Niklas Frank
Niklas Frank ist der Sohn von Hans Frank, dem »Schlächter von Polen« und Hitlers »Generalgouverneur« im besetzten Polen. Er erkennt in Rhetorik und Verhalten heutiger Politiker erschreckende Parallelen zur NS-Zeit. Der Hass, die Empathielosigkeit und der menschenverachtende Humor der Nationalsozialisten finden sich heute wieder in der AfD, aber auch bei Vertretern anderer Parteien. Frank warnt: »Jetzt tauchen wieder Väter von meines Vaters Art auf, die mein Hirn vergiften wollen.«
eBook
Gustav Flohr
Noch ein Partisan!
Ein Remscheider Kommunist, Klempner, Spanienkämpfer und Bürgermeister
Ediert von Jörg Becker
Mit einem Beitrag von Werner Abel
Der Arbeitersohn, Kommunist und spätere Remscheider Oberbürgermeister Gustav Flohr (1895–1965) war zutiefst geprägt vom Kampf gegen den Faschismus und vom Systemkonflikt des 20. Jahrhunderts. Der Politologe Jörg Becker hat Flohrs unveröffentlichte Schriften ediert und kommentiert, darunter hochinteressante Briefe und Notizen über die inneren Verhältnisse des Deutschen Reichs, die NS-Verfolgung und den linken Widerstand gegen Hitler.
Friedrich-Ebert-Stiftung (Hg.)
Archiv für Sozialgeschichte, Band 59 (2019)
Die Welt verändern. Revolutionen in der Geschichte
Herausgegeben für die Friedrich-Ebert-Stiftung von: Kirsten Heinsohn, Thomas Kroll, Anja Kruke, Philipp Kufferath (geschäftsführend), Friedrich Lenger, Ute Planert, Dietmar Süß und Meik Woyke.
»Lokomotiven der Geschichte« hat sie Karl Marx genannt: Revolutionen beflügeln Phantasien, den Traum von einer »besseren Welt«, die Hoffnung auf ein anderes Morgen. Was aber sind Revolutionen aus sozialgeschichtlicher Perspektive? Sind sie immer gewaltsam und ungeplant? Können sie trotzdem ein »Mehr« an Freiheit oder »Emanzipation« bewirken? Gibt es revolutionäre Verlaufsmuster, prägende Akteure, dominante Erzählungen, Mythen und Inszenierungen? Hat der Begriff angesichts einer inflationären Verwendung in der Populärkultur überhaupt analytische Qualität? Diese und weitere Fragen rückt das Archiv für Sozialgeschichte in diesem Jahr ins Zentrum.
Benedikt Brunner / Thomas Großbölting / Klaus Große Kracht / Meik Woyke (Hg.)
»Sagen, was ist«
Walter Dirks in den intellektuellen und politischen Konstellationen Deutschlands und Europas
Walter Dirks (1901–1991) war als linkskatholischer Publizist und Intellektueller ein präziser Beobachter und scharfzüngiger Kommentator, der jenseits der sich im 20. Jahrhundert weiter verfestigenden Trennlinien der weltanschaulichen, politischen und religiösen Lager in Deutschland agierte. Zeitlebens beanspruchte er für sich, gleichermaßen ein gläubiger Katholik und überzeugter Sozialist zu sein.
Arthur Benz / Stephan Bröchler / Hans-Joachim Lauth (Hg.)
Handbuch der Europäischen Verfassungsgeschichte
im 20. Jahrhundert
Institutionen und Rechtspraxis im gesellschaftlichen Wandel
Band 5: seit 1989
Herausgegeben in Verbindung mit Peter Brandt/Werner Daum/Martin Kirsch/Arthur Schlegelmilch
Der vorliegende Band 5 bildet den Abschluss der Handbuchreihe zur Verfassungsgeschichte im 20. Jahrhundert. Beginnend mit den Umwälzungen von 1989/90 veranschaulicht er bis in die 2010er-Jahre hinein das Spannungs- und Wechselverhältnis zwischen der einzelstaatlichen Verfassungsentwicklung sowie der Ausbildung einer supranationalen Verfassungsebene. Die Herausgeber betrachten neben formalen und materiellen Aspekten auch die faktische Ausprägung der Verfassungen.
Katrin Grajetzki
»Kanalarbeiter« und Bundesminister
Der Sozialdemokrat Egon Franke (1913-1995)
Das sozialdemokratische Urgestein Egon Franke repräsentierte mit den »Kanalarbeitern« den mächtigen rechten Flügel in der SPD-Bundestagsfraktion der 1960er- und 1970er-Jahre. Mit den »Kanalern« versuchte er, einen befürchteten »Linksruck« in der Partei abzuwenden. Es galt, den Godesberger Volkspartei-Kurs und damit die sozialliberale Koalition zu erhalten. Franke war aber nicht nur Chef des rechten Flügels in der SPD, sondern auch Minister für innerdeutsche Beziehungen unter Willy Brandt und Helmut Schmidt.
Franziska Rehlinghaus / Ulf Teichmann (Hg.)
Vergangene Zukünfte von Arbeit
Aussichten, Ängste und Aneignungen im 20. Jahrhundert
Wie die Arbeit der Zukunft aussehen und ob Arbeit überhaupt eine Zukunft besitzen würde – diese Fragen waren im 20. Jahrhundert allgegenwärtig. Die Aussichten der zahlreichen Akteure im Feld der Arbeit und ihre Praktiken der Zukunftsplanung und -gestaltung ließen Arbeit nicht nur zur Projektionsfläche von Hoffnungen und Ängsten werden, sondern auch zum Labor, in dem Zukunft angeeignet und erschaffen wurde.
Philipp Kufferath / Jürgen Mittag
Geschichte der Arbeiterwohlfahrt (AWO)
Die im Dezember 1919 gegründete Arbeiterwohlfahrt blickt auf eine über 100-jährige Geschichte zurück. Als Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege zählt sie zu den wichtigsten Akteuren der Sozialpolitik in Deutschland. Sie engagiert sich im Kinder-, Jugend-, Senioren-, Gesundheits- und Pflegebereich, sie kümmert sich auch auf breiter ehrenamtlicher Basis um Hilfs- und Schutzbedürftige und tritt politisch für Chancengerechtigkeit und gesellschaftliche Teilhabe ein.
Dieter Vaupel
Auf einem fremden unbewohnbaren Planeten
Handreichungen, Kopiervorlagen und Aufgabenstellungen für den Unterricht in Jahrgangsstufe 7-13
Die Handreichungen zeigen eine Fülle von Möglichkeiten für die didaktische Arbeit mit dem Buch »Auf einem fremden unbewohnbaren Planeten« auf. Die Arbeitsmaterialien helfen dabei, einzelne Aspekte im Unterricht schülerorientiert zu bearbeiten und zu vertiefen. Sie reichen von Anregungen zur Gestaltung eines Lesetagebuches über die Erarbeitung historischer Hintergründe bis hin zur Auseinandersetzung mit ethisch-moralischen und aktuell-politischen Fragestellungen.
Hans-Peter Bartels
Deutschland und das Europa der Verteidigung
Globale Mitverantwortung erfordert das Ende militärischer Kleinstaaterei
Die Frage der eigenen Verteidigungsfähigkeit Europas hat neue Aktualität gewonnen. Amerika, die frühere Schutzmacht, entfernt sich. Cyberattacken, Russland, Djihadisten – das sind nur ein paar Schlagworte für die unterschiedlichen, wachsenden Bedrohungen von Frieden und Freiheit. Dagegen steht die sicherheitspolitische Kleinstaaterei in Nato-Europa wie in EU-Europa.
Lale Akgün / Adrian Gillmann / Norbert Reitz (Hg.)
säkular. sozial. demokratisch
Ein Plädoyer für die Trennung von Religion und Politik
Was ist eigentlich säkular? Das Grundgesetz verbietet sowohl Bevorzugung als auch Benachteiligung einzelner Bürger oder Gruppen. Dieses Buch klärt auf über alltägliche Verstöße gegen dieses Verbot im Verhältnis zwischen Kirchen und Staat. Es plädiert für eine striktere Trennung von Religion und Politik, gleichzeitig aber auch für Respekt und Toleranz gegenüber Andersgläubigen und Menschen ohne religiöse Bindung.
Walter Mühlhausen
Das Weimar-Experiment
Die erste deutsche Demokratie. 1918–1933
Weimar war Experiment, Versuch, Aufbruch, Sprung in die Moderne. Die Geschichte der ersten deutschen Demokratie und ihres Endes ist komplex und bis heute wichtig für uns: War sie durch Fehler und Versäumnisse in der Gründungsphase zum Scheitern verurteilt oder hatte sie nicht doch bis zuletzt eine echte Überlebenschance? Walter Mühlhausen zeichnet die Entwicklungen der Weimarer Republik kompetent nach und liefert ein spannendes Bild einer von inneren Kämpfen zerrissenen, äußerlich bedrängten und ökonomisch belasteten Republik.
Reinhard Krumm
Russlands Traum
Anleitung zum Verständnis einer anderen Gesellschaft
Die russische Gesellschaft hat einen alten Traum – den Traum von Freiheit. Sie träumt ihn immer völlig unabhängig von ihren jeweiligen Herrschern. Die große Mehrheit der Bevölkerung ist heute freier als je zuvor, auch wenn es ungerecht im Land zugeht. Doch der Anschein, dass sich die Gesellschaft widerstandslos vom Staat beherrschen lässt, war und ist falsch. Warum, das erklärt dieser brillante Essay.
Cas Mudde / Cristóbal Rovira Kaltwasser
Populismus: Eine sehr kurze Einführung
Aus dem Englischen übersetzt von Anne Emmert
Mit Populismus werden ganz unterschiedliche Phänomene beschrieben – leider oft ungenau und interessegeleitet. Dieses kurze, kompakte Buch vermittelt ein tiefergehendes Verständnis. Was ist Populismus? Was macht seine Führer aus? Und wie ist seine Beziehung zur Demokratie?
Wolfgang Schroeder / Bernhard Weßels (Hg.)
Smarte Spalter
Die AfD zwischen Bewegung und Parlament
Wie verändert die AfD das Parteiensystem? Und was heißt das für die Demokratie in Deutschland? Die Partei neuen Typs verbindet Rechtspopulismus mit konventionellen Moralvorstellungen, durchdringt die sozialen Netzwerke mit ihrer Agitation und hat, stärker als andere Parteien, den Charakter einer politischen Bewegung. Erstmals wird die AfD auf Grundlage umfangreicher sozialwissenschaftlicher Daten analysiert. Dieser empirische Ansatz ist bislang einzigartig. Das Buch erklärt die komplexe Entwicklung von Wählerschaft und Ideologie, Kandidaten und Programmatik, der Abgeordneten und ihrer Aktivitäten auf Landes- und Bundesebene.
Stefanie Molthagen-Schnöring / Dietmar Molthagen
Lasst uns reden!
Wie Kommunikation in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gelingt
Dieses Buch zeigt, wie wir kontroverse Themen erfolgreich diskutieren können. Viele Menschen empfinden große Sprachlosigkeit. Es fällt ihnen schwer, über regionale, Geschlechter- oder politische Meinungsgrenzen hinweg miteinander zu reden. Alle Studien zeigen: Die Gesellschaft zerfällt in Teilöffentlichkeiten, die nur innerhalb ihrer Filterblasen kommunizieren. Das gefährdet den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Demokratie.
Tobias Mörschel (Hg.)
Social Democracy and State Foundation
The emergence of a new European state landscape after the First World War
The map of Europe changed with the end of the First World War. The large multi-ethnic states disintegrated. In northern, central and eastern Europe numerous new (nation) states came into being or recovered their statehood after a long period. A comprehensive democratic thrust set in. The social democratic parties were among the main driving forces of this Europe-wide development.
Nils Heisterhagen
Das Streben nach Freiheit
Essays gegen die Orientierungslosigkeit
Vielen Menschen fehlen Zuversicht und Vertrauen in die Zukunft. Wenn man ehrlich ist – wer findet nicht, dass die Welt von heute immer schwerer zu verstehen ist? Die gesammelten Artikel des jungen Politik-Talents Nils Heisterhagen zeugen davon, wie eine neue Generation in Deutschland nach Wegen sucht, die Welt zu deuten und eine Debatte über ein besseres Morgen zu führen.
Thilo Scholle / Jan Schwarz
»Wessen Welt ist die Welt?«
Geschichte der Jusos
Die seit 1904 währende Geschichte der Jungsozialist*innen in der SPD (Jusos) ist eine Geschichte der Abgrenzung einerseits und der Versuche, die SPD programmatisch weiterzuentwickeln, andererseits. Ein bestimmender Konflikt der Jugendorganisation ist ihr Anspruch auf inhaltliche und organisatorische Autonomie gegenüber dem SPD-Parteivorstand. Zusätzlich kennzeichnen die Parteijugend langwierige interne Auseinandersetzungen zwischen unterschiedlichen Flügeln – etwa Austromarxisten gegen Nationalisten in den 1920er- oder Marxisten gegen Reformisten in den 1970er-Jahren.
Norbert Bicher
Schauplatz BRD
Reisen ins Innere der Republik
Zum 70. Geburtstag der zweiten deutschen Demokratie reist Norbert Bicher zurück an denkwürdige Orte, die das öffentliche Leben und Selbstverständnis der Deutschen geprägt haben. Er erzählt ihre Geschichten mit dem Blick von heute. So entsteht ein Kanon der Ereignisse aus der Bonner und Berliner Republik, der berührt und aufwühlt und uns zeigt, wie dieses Land nach dem Krieg wurde, was es heute ist.
Ulrike Guérot
Why Europe Should Become a Republic!
A Political Utopia
Ins Englische übersetzt von Ray Cunningham
Ulrike Guérot outlines the idea of a radically different Europe: Europe as a Republic. The concept is based on two pillars: Firstly, the principle of political equality for all European citizens and the separation of powers, instead of a non-transparent and technocratic »trilogy« of the existing European institutions. Secondly, strong European regions actively participating in European decision-making.
eBook
Axel Schildt / Wolfgang Schmidt (Hg.)
»Wir wollen mehr Demokratie wagen«
Antriebskräfte, Realität und Mythos eines Versprechens
»Wir wollen mehr Demokratie wagen.« Dieser Satz von Willy Brandt ist zum legendären Leitspruch für die Reformen in der Bundesrepublik am Übergang von den 1960er- zu den 1970er- Jahren geworden. Der Sammelband analysiert die Hintergründe und die gewollten sowie die ungewollten Folgen und Wirkungen jenes Versprechens und ordnet die Demokratisierungs- und Liberalisierungsbestrebungen der Ära Brandt in den internationalen Kontext ein.
Christiane Wirtz
Das Katzenprinzip
Immer auf den Füßen landen - Sieben Wege aus der psychischen Krise
Bestseller-Autorin Christiane Wirtz weiß aus eigener Erfahrung, wie man psychische Krisen überwindet und immer wieder auf den Füßen landet. Das Katzenprinzip – so nennt sie sieben Grundregeln, denen sie nach ihrer Psychose instinktiv folgte und die ihr in ein neues Leben halfen. Sie wollte sie selbst bleiben. Mit den Regeln des Katzenprinzips hat sie es geschafft. Ein Buch nicht nur für Menschen, die eine psychische Krankheit haben, sondern für alle, die ihre Resilienz stärken und ihre Krise in Angriff nehmen wollen.
Philipp Adorf / Ursula Bitzegeio / Frank Decker (Hg.)
Ausstieg, Souveränität, Isolation
Der Brexit und seine Folgen für die Zukunft Europas
Der EU-Austritt Großbritanniens ist weniger die Konsequenz des antieuropäischen britischen Sonderwegs, sondern vor allem ein Zeichen für die heutige Anfälligkeit westlicher Demokratien für rechtspopulistische Agitation. Zur Brexit-Rhetorik gehört das Lamento über die angebliche Bürgerferne in Brüssel und oligarchische EU-Strukturen, das Schüren von Abstiegsängsten oder Ressentiments gegen Geflüchtete. Die vermeintliche Lösung: ein »souveränes« Großbritannien, das sich von der kontinentaleuropäischen Bürokratie nicht mehr bevormunden lässt. Doch werden alle Brücken ohne Deal abgebrochen, kann dieser Weg auch in eine Isolation führen, aus der es kein Zurück mehr gibt.
Marvin Oppong
Ewig anders
schwarz, deutsch, Journalist
Die Black Lives Matter-Bewegung hat es gezeigt: Deutschland hat ein Problem mit Alltagsrassismus. Diesem Umstand geht Marvin Oppong auf den Grund und betreibt Ursachenforschung: In schonungslosen Gesprächen und Begegnungen testet er die deutsche Gesellschaft und fragt, wie sich das politische Klima nach Ereignissen wie dem 11. September 2001, der Silvesternacht am Kölner Hauptbahnhof 2015/16 oder der Özil- und #MeTwo-Debatte verändert hat.
Franz Müntefering
Unterwegs
Älterwerden in dieser Zeit
Älterwerden heißt leben. Das ist eine spannende Sache. Und für die meisten von uns geht sie länger als jemals zuvor in der Geschichte der Menschheit. So ergibt sich Gelegenheit, unterwegs zu sein, sich einzumischen, Mitverantwortung und Selbstverantwortung zu übernehmen und zu sagen, wohin die Reise geht. Das Alter und die Älteren, ein Problem? Sie sind auch die Lösung.
Volker Stanzel
Die ratlose Außenpolitik
und warum sie den Rückhalt der Gesellschaft braucht
»... glänzend geschrieben, hochinformativ und vor allem sehr gut strukturiert. Nach meinem Urteil ist es das beste Buch über deutsche Außenpolitik, das derzeit auf dem Markt ist.«
Theo Sommer
Die deutsche Außenpolitik, jahrzehntelang erfolgsverwöhnt, verlangt nach neuer Orientierung. Denn zahlreiche außenpolitische Krisen gefährden die Stabilität Deutschlands in Politik und Gesellschaft. Das Hauptproblem ist der geringe Rückhalt für außenpolitische Entscheidungen in der Bevölkerung, und damit ein Mangel an Legitimation. Zudem stehen die deutschen auswärtigen Beziehungen unter dramatisch gewandelten Einflüssen: neue Technologien, neue starke und autoritäre Player auf internationalem Parkett sowie neue Öffentlichkeiten in unserer Gesellschaft.
Marvin Oppong
Ewig anders
schwarz, deutsch, Journalist
Die Black Lives Matter-Bewegung hat es deutlich gemacht: Auch Deutschland hat ein Problem mit Alltagsrassismus. Diesem Umstand geht Marvin Oppong auf den Grund und betreibt Ursachenforschung: In schonungslosen Gesprächen und Begegnungen testet er die deutsche Gesellschaft und fragt, wie sich das politische Klima nach Ereignissen wie dem 11. September 2001, der Silvesternacht am Kölner Hauptbahnhof 2015/16 oder der Özil- und #MeTwo-Debatte verändert hat.
eBook
Johannes Hillje
Plattform Europa
Warum wir schlecht über die EU reden und wie wir den Nationalismus mit einem neuen digitalen Netzwerk überwinden können
Der Europäischen Union fehlt zu einer lebendigen Demokratie ein zentraler Baustein: eine europäische Öffentlichkeit. Die Plattform Europa möchte diese Lücke schließen. Pünktlich zu den Europawahlen analysiert der Europa-Experte und Politikberater Johannes Hillje die heutigen Europa-Debatten und entwickelt einen visionären Vorschlag für ein digitales, öffentlich finanziertes und gemeinwohlorientiertes soziales Netzwerk: ein virtueller Ort für Nachrichten, Unterhaltungsangebote oder Dienstleistungen, aber auch Bildung, europäische Bürgerinitiativen und den direkten Austausch unter Menschen in ganz Europa.
Johannes Hillje
Plattform Europa
Warum wir schlecht über die EU reden und wie wir den Nationalismus mit einem neuen digitalen Netzwerk überwinden können
Der Europäischen Union fehlt zu einer lebendigen Demokratie ein zentraler Baustein: eine europäische Öffentlichkeit. Die Plattform Europa möchte diese Lücke schließen. Pünktlich zu den Europawahlen analysiert der Europa-Experte und Politikberater Johannes Hillje die heutigen Europa-Debatten und entwickelt einen visionären Vorschlag für ein digitales, öffentlich finanziertes und gemeinwohlorientiertes soziales Netzwerk: ein virtueller Ort für Nachrichten, Unterhaltungsangebote oder Dienstleistungen, aber auch Bildung, europäische Bürgerinitiativen und den direkten Austausch unter Menschen in ganz Europa.
eBook
Franz Müntefering
Unterwegs
Älterwerden in dieser Zeit
Älterwerden heißt leben. Das ist eine spannende Sache. Und für die meisten von uns geht sie länger als jemals zuvor in der Geschichte der Menschheit. So ergibt sich Gelegenheit, unterwegs zu sein, sich einzumischen, Mitverantwortung und Selbstverantwortung zu übernehmen und zusagen, wohin die Reise geht. Das Alter und die Älteren, ein Problem? Sie sind auch die Lösung.
eBook
Sarah Brockmeier / Philipp Rotmann
Krieg vor der Haustür
Die Gewalt in Europas Nachbarschaft und was wir dagegen tun können
Gewalt und Bürgerkriege nehmen kein Ende. Weltweit sind 66 Millionen Menschen auf der Flucht. Einige von ihnen stellt dieses Buch vor: Zum Beispiel Nadia Murad, die aus der Sklaverei des »Islamischen Staats« im Irak fliehen konnte und 2018 für ihre politische Arbeit gegen den Völkermord an den Jesiden den Friedensnobelpreis erhielt. Aber auch einen brasilianischen Außenminister, einen kongolesischen Warlord, einen ghanaischen Diplomaten und andere mehr – Menschen, die Frieden suchen, und Menschen, die Krieg führen. Ihnen stellen die Autoren eine eindrucksvolle Schilderung der politischen Entscheidungsprozesse gegenüber, die einer haarsträubenden Eigenlogik folgen. Sie machen die Blockaden verständlich, die den Anspruch der »deutschen Verantwortung« und der »Fluchtursachenbekämpfung« hohl klingen lassen.
Friedrich-Ebert-Stiftung (Hg.)
Archiv für Sozialgeschichte, Band 58 (2018)
Demokratie praktizieren. Arenen, Prozesse und Umbrüche politischer Partizipation in Westeuropa im 19. und 20. Jahrhundert
Herausgegeben für die Friedrich-Ebert-Stiftung von: Beatrix Bouvier, Kirsten Heinsohn, Thomas Kroll, Anja Kruke, Philipp Kufferath (geschäftsführend), Friedrich Lenger, Ute Planert, Dietmar Süß und Meik Woyke.
Wir erleben aktuell in Westeuropa eine nachlassende Akzeptanz parlamentarisch-demokratischer Systeme. Rechtspopulistische Parteien und Positionen erweisen sich als eine große Herausforderung. Diese Situation legt eine historische Reflexion über das Entstehen, Gelingen und Scheitern politischer Partizipation nahe. Um zu verstehen, wie sich der lange Übergang von der ständischen Repräsentation in der Vormoderne zu den inklusiven Verfassungsordnungen der Gegenwart vollzog, greift eine bloße Analyse der formalen Abläufe demokratischer Politik zu kurz. Schließlich waren Definitionen und Bewertungen von demokratischen Praktiken stets umkämpft und wandelten sich insbesondere in Umbruchsphasen und Krisensituationen oft grundlegend.
Volker Koop
Hitlers Griff nach Afrika
Kolonialpolitik im Dritten Reich
Hitlers koloniale Expansionspolitik für Afrika und Übersee ist ein weitgehend unbeachtetes Kapitel der NS-Geschichte. Zur Wiederherstellung der »Ehre« Deutschlands nach dem »schändlichen Versailler Friedensdiktat« sollten verlorene Kolonien zurückerobert und neue Gebiete in Besitz genommen werden. Akribisch bereitete das Dritte Reich ihre Verwaltung und Ausbeutung vor.
Heike Christina Mätzing
Georg Eckert
1912–1974
Von Anpassung, Widerstand und Völkerverständigung
Ein Leben im Jahrhundert der Extreme: Der viel zu wenig gewürdigte sozialdemokratische Ethnologe, Pädagoge, Historiker und »Diplomat der Völkerverständigung« Georg Eckert (1912–1974) steht für einen politisch aktiven deutschen Wissenschaftler.
Peter Brandt
Mit anderen Augen
Versuch über den Politiker und Privatmann Willy Brandt
Willy Brandts ältester Sohn Peter erinnert sich an seinen Vater als Politiker und Privatmann, der noch in den 1980er-Jahren eine der umstrittensten Persönlichkeiten in Deutschland war. Und er schreibt über das liebevolle, aber nicht ganz einfache Verhältnis zweier »sperriger Menschen«.
Willy Brandt
Die Kriegsziele der Großmächte
und das neue Europa
Herausgegeben, übersetzt und eingeleitet von Einhart Lorenz
Willy Brandts erstes Buch, auf Norwegisch geschrieben, konnte wegen der Kriegsereignisse nie erscheinen. Es sollte am 9. April 1940 ausgeliefert werden – dem Tag der Invasion der Deutschen in Norwegen. Die Gestapo setzte den Titel auf die Liste der verbotenen Bücher, beschlagnahmte und vernichtete es. Heute existieren nur noch wenige Originalexemplare. Erstmals erscheint es nun ungekürzt in deutscher Sprache.
Hassan Abu Hanieh / Mohammad Abu Rumman
Dschihadistinnen
Faszination Märtyrertod
aus dem Arabischen übersetzt von Günther Orth
Bis Dezember 2017 kontrollierte der IS ein Drittel des irakischen und große Teile des syrischen Staatsgebietes. Zahlreiche junge Frauen im Westen und in muslimischen Ländern gaben ihr bisheriges Leben auf, um sich dem IS anzuschließen. Wie, wo und von wem wurden diese jungen Frauen rekrutiert? Welche psychologischen, kulturellen und sozialen Faktoren treiben sie an, sich dem Gedankengut einer dschihadistischen Organisation zu unterwerfen und in den bewaffneten Kampf zu ziehen?
Blanka Pudler / Dieter Vaupel
Auf einem fremden unbewohnbaren Planeten
Wie ein 15-jähriges Mädchen Auschwitz und Zwangsarbeit überlebte
Blanka ist noch ein Kind, als sie von den Nazis verfolgt und mit ihrer ganzen Familie 1944 deportiert wird. Nach sieben schrecklichen Wochen in Auschwitz selektiert man sie zur Zwangsarbeit. In der Sprengstofffabrik Hessisch Lichtenau muss sie mit ihrer älteren Schwester Aranka Bomben und Granaten befüllen. Als die beiden Mädchen nach dem Krieg nach Ungarn zurückkommen, erfahren sie, dass sie nicht nur ihr Zuhause, sondern auch ihre Eltern im Holocaust verloren haben.
Christian Hörnlein
Abgrenzungsdebatten und politische Bekehrungen
Die Sozialdemokratie zwischen Politik und Religion im Wilhelminischen Kaiserreich
In Autobiografien, die beschreiben, wie man zur Sozialdemokratie gefunden hat, werden vielfach Muster religiöser Bekehrungen bemüht. Das steht in einer Spannung zum religionskritischen Selbstverständnis der Partei. Mit den Debatten über den Weg zum Sozialismus wird die Sozialdemokratie in der politischen und religiösen Kultur des Wilhelminischen Kaiserreichs verortet.
Hassan Abu Hanieh / Mohammad Abu Rumman
Dschihadistinnen
Faszination Märtyrertod
aus dem Arabischen übersetzt von Günther Orth
Bis Dezember 2017 kontrollierte der IS ein Drittel des irakischen und große Teile des syrischen Staatsgebietes. Zahlreiche junge Frauen im Westen und in muslimischen Ländern gaben ihr bisheriges Leben auf, um sich dem IS anzuschließen. Wie, wo und von wem wurden diese jungen Frauen rekrutiert? Welche psychologischen, kulturellen und sozialen Faktoren treiben sie an, sich dem Gedankengut einer dschihadistischen Organisation zu unterwerfen und in den bewaffneten Kampf zu ziehen?
eBook
Knud Andresen / Michaela Kuhnhenne / Jürgen Mittag / Stefan Müller (Hg.)
Repräsentationen der Arbeit
Bilder – Erzählungen – Darstellungen
Wie wird und wurde Arbeit in der Gesellschaft dargestellt und wahrgenommen? Als Quelle von Stolz und Zukunftsorientierung, aber auch als Ort des Elends, der körperlichen Anstrengung, der Unterordnung und Ausbeutung. Mit seinem interdisziplinären Ansatz lenkt dieser wissenschaftliche Sammelband den Blick auf Orte, Medien und Figuren der Darstellung von Arbeit.
Jürgen Schmidt
Brüder, Bürger und Genossen
Die deutsche Arbeiterbewegung zwischen Klassenkampf und Bürgergesellschaft
1830–1870
Herausgegeben von Gerhard A. Ritter(†) und Jürgen Kocka
Klassenkämpfe und zivilgesellschaftliches Handeln, politische Konflikte und geselliges Vereinsleben: Jürgen Schmidt beschreibt und erklärt die vielfältige Entstehungsgeschichte der deutschen Arbeiterbewegung zwischen den 1830er-Jahren und der Gründung des Deutschen Kaiserreichs 1871.
Wim van Meurs
Die Unvollendete
Eine Geschichte der Europäischen Union
Vor dem Hintergrund der aktuellen Euro- und Flüchtlingskrisen liefert dieses Buch einen fundierten und auf das Wesentliche gerichteten Überblick zur Geschichte und Gegenwart der europäischen Integration – von Briand und Monnet als Vordenker bis zu den Brexitverhandlungen heute.
Karl Marx
Gesammelte Volkslieder
Als knapp 20-Jähriger hat Marx 1839 für seine Verlobte Jenny von Westphalen eine Sammlung mit Volksliedern aus Deutschland und anderen europäischen Ländern zusammengestellt– »spanische, griechische, lettische, lappländische, esthnische, albanesische u.s.w.«
Michael Bröning
Lob der Nation
Warum wir den Nationalstaat nicht
den Rechtspopulisten überlassen dürfen
Die Nation als Relikt vergangener Zeiten? Der Nationalstaat als Irrweg? Im Gegenteil: Staat und Nation sind Erfolgsmodelle – weltweit. In seinem Plädoyer für die Rehabilitierung der Nation zeigt Michael Bröning, weshalb gerade progressive Kräfte Frieden mit dem Nationalstaat schließen müssen – nicht als ethnisch-homogene Wagenburg, sondern als Basis eines starken Europas in einer multipolaren Welt.
Nils Heisterhagen
Die liberale Illusion
Warum wir einen linken Realismus brauchen
Die SPD steht mit dem Rücken zur Wand. Sie wirkt wie gelähmt durch das Beharren auf der Politik der »Neuen Mitte« und des »Dritten Weges«, mit der sie in den 2000er Jahren zuletzt Wahlerfolge erringen konnte.
Ursula Bitzegeio / Frank Decker / Sandra Fischer / Thorsten Stolzenberg (Hg.)
Flucht, Transit, Asyl
Interdisziplinäre Perspektiven auf ein europäisches Versprechen
Wo liegen Möglichkeiten und Grenzen europäischer Sicherheits-, Grenz- und Integrationspolitiken und welche gemeinsamen Vorschläge für Krisenlösungen gibt es? Nothilfe für Flüchtlinge, Asylrecht und Einwanderung – bei diesen Themen zeigen sich tiefe Gräben zwischen den europäischen »Partnern«. Dabei wird die politische Auseinandersetzung innerhalb der EU nicht nur von Sachzwängen bestimmt: Islamskeptische Argumente gegen Migration verweisen auf kulturell bedingte Differenzen, die für die spezifische Auslegung von Fragen des Asyl- und Völkerrechts an Bedeutung gewinnen.
Christiane Wirtz
Neben der Spur
Wenn die Psychose die soziale Existenz vernichtet
Eine Frau erzählt
Sie ist 34, als plötzlich die erste Psychose auftritt. »Schizophrenie« lautet die Diagnose. Diese schwere Krankheit von großer Zerstörungskraft ist nach wie vor stark angst- und schambehaftet, und es herrscht große Unkenntnis, obwohl Millionen Menschen in Deutschland von ihr direkt oder indirekt betroffen sind. Die sozialen Konsequenzen dieser Mischung aus Krankheitsfolgen, Unkenntnis und Ablehnung bekommt Christiane Wirtz grausam zu spüren. Sie verliert alles: Job, Freunde, Eigentumswohnung, Altersvorsorge. Das Leben war vorbei. Aber darf die Gesellschaft zulassen, dass Menschen so tief fallen?
David Ranan
Muslimischer Antisemitismus
Eine Gefahr für den gesellschaftlichen
Frieden in Deutschland?
Unbestritten sind anti-jüdische Einstellungen unter Muslimen weit verbreitet. Aber warum? Die gängigen Definitionen und Erkenntnismuster, erklärt David Ranan, reichen nicht mehr aus, um den Antisemitismus vieler Muslime zu beschreiben. Hat das Ganze nur mit dem Nahostkonflikt zu tun oder sind Muslime grundsätzlich antisemitisch? Ist Judenhass ein integraler Teil des Islam? Oder ist er eine Erscheinungsform des Islamismus?
Dierk Ludwig Schaaf
Fluchtpunkt Lissabon
Wie Helfer in Vichy-Frankreich Tausende vor Hitler retteten
Hannah Arendt, Marc Chagall, Max Ernst, Otto von Habsburg, Heinrich Mann – sie konnten vor Hitler fliehen. Doch ohne Menschen, die Geld und falsche Papiere beschafften, Verbote ignorierten und taten, was ihr Gewissen verlangte, wäre das nie geglückt. Dieses Buch nimmt erstmals die Fluchthelferinnen und -helfer in den Blick und erzählt, wie sie Tausende vor Tod und Lager retteten.
Uli Schöler / Thilo Scholle (Hg.)
Weltkrieg. Spaltung. Revolution
Sozialdemokratie 1916–1922
Die Geschichte der Arbeiterbewegung von 1916 bis 1922 wird oft als Zweiteilung in Mehrheitssozialdemokratie und Unabhängige Sozialdemokratie sowie die sich gründende Kommunistische Partei beschrieben. Diese allzu schlichte Darstellung wird den tatsächlichen politischen Auseinandersetzungen zwischen und in diesen Gruppen nicht gerecht.
Zwischen Ungewissheit und Zuversicht
Jugend im Nahen Osten und in Nordafrika
Herausgegeben für die Friedrich-Ebert-Stiftung
von Jörg Gertel und Ralf Hexel
Die große repräsentative Jugendstudie in der arabischen Welt erlaubt erstmals profunde Einblicke in Lebensgefühl, Selbstverständnis und Zukunftsvorstellungen von rund 9.000 jungen Menschen zwischen 16 und 30 Jahren aus Ägypten, Bahrein, Jemen, Jordanien, Libanon, Marokko, Palästina, Syrien und Tunesien.
Karl Marx
Weltgericht
Dichtungen aus dem Jahre 1837
Der große politische Philosoph hat auch literarische Schöpfungen hinterlassen, die er einst als 18-Jähriger, in der Hochzeit der Spätromantik, seinem Vater widmete. Neben Liebeslyrik und anderen Gedichten enthält dieser einzigartige, der Originalkladde von Marx nachgestaltete Band sechs kritische Epigramme im Geiste des Idealismus, den 1. Akt des phantastischen Dramas »Oulanem« und einige Kapitel des humoristischen Romans »Skorpion und Felix«. So haben Sie Marx noch nie gelesen!
Michael Bröning / Christoph P. Mohr (Hg.)
The Politics of Migration and the Future of the European Left
Recent large-scale refugee movements into Europe have triggered a fundamental re-evaluation of the continent's response to migration. As Europe grapples with the past experiences, expectations, limitations and opportunities of migration, public debates continue to be marred by controversy. This collection of essays attempts to take stock of how progressive political parties in Europe have responded to these challenges and offers fascinating insights into a debate that is as difficult as it is important.
Philipp Kufferath / Friedrich Lenger (Hg.)
Sozialgeschichte des Kapitalismus
im 19. und 20. Jahrhundert
Seit der Finanz- und Staatsschuldenkrise von 2008 ist der Kapitalismus wieder in aller Munde. In Krisenzeiten treten globale Abhängigkeiten deutlicher hervor, soziale Ungleichheit wird als Problem erfahrbar. Wie wurden Krisen in der Vergangenheit wahrgenommen und bewältigt? Warum gewannen die Finanzmärkte in einzelnen Ländern an Attraktion? Wieso haben Staaten so hohe Schulden? Welchen Stellenwert hatten prekäre Arbeitsverhältnisse in bestimmten Epochen? Wie wurden Fragen von Ethik und Umweltschutz marktförmig?
Friedrich-Ebert-Stiftung (Hg.)
Archiv für Sozialgeschichte, Band 57 (2017)
Gesellschaftswandel und Modernisierung
1800–2000
Herausgegeben für die Friedrich-Ebert-Stiftung von: Beatrix Bouvier, Anja Kruke, Philipp Kufferath (geschäftsführend), Friedrich Lenger, Ute Planert, Dietmar Süß, Meik Woyke und Benjamin Ziemann.
Die gesellschaftlichen Veränderungen der letzten zwei Jahrhunderte sind nicht zu übersehen. Häufig wurde dieser weitreichende Wandel in Richtung größerer Komplexität und funktionaler Differenzierung mit Varianten der Modernisierungstheorie beschrieben. Das Anliegen, den Aufstieg des »Westens« als Vorbild für eine »Modernisierung« anderer Regionen anzusehen, erwies sich aber als folgenreiche Perspektive und brachte grundlegende Kritik hervor. Modernisierungstheorien sind heute weitgehend diskreditiert, finden in der Praxis aber vielfältig Anwendung.
Walter Mühlhausen
Friedrich Ebert
Der Sozialdemokrat Friedrich Ebert (1871–1925) zählt zu den bedeutendsten Persönlichkeiten der deutschen Demokratiegeschichte – als Mitglied der Revolutionsregierung nach dem Ersten Weltkrieg und als erster gewählter Reichspräsident der ersten demokratischen Republik auf deutschem Boden.
Aleksandra Sowa
Digital Politics
So verändert das Netz die Demokratie
10 Wege aus der digitalen Unmündigkeit
Digitalisierung schlägt Demokratie. Die bequeme und undurchsichtige »Cyberwelt« macht uns mündig und unmündig zugleich. Sie beeinflusst unser Leben, Politik, Wirtschaft und (demokratische) Entscheidungen. In 10 Kapiteln erklärt Aleksandra Sowa, Expertin für Verschlüsselungstechnologien, wo Fallstricke liegen und wie man um sie herumkommt. Statt die Technologie als Ursache des Übels zu verdammen, muss man begreifen, dass jeder für den Schutz seiner Daten selbst verantwortlich ist. Sich zu wehren will gelernt sein! Die Autorin zeigt, wie.
eBook
Aleksandra Sowa
Digital Politics
So verändert das Netz die Demokratie
10 Wege aus der digitalen Unmündigkeit
Digitalisierung schlägt Demokratie. Die bequeme und undurchsichtige »Cyberwelt« macht uns mündig und unmündig zugleich. Sie beeinflusst unser Leben, Politik, Wirtschaft und (demokratische) Entscheidungen. In 10 Kapiteln erklärt Aleksandra Sowa, Expertin für Verschlüsselungstechnologien, wo Fallstricke liegen und wie man um sie herumkommt. Statt die Technologie als Ursache des Übels zu verdammen, muss man begreifen, dass jeder für den Schutz seiner Daten selbst verantwortlich ist. Sich zu wehren will gelernt sein! Die Autorin zeigt, wie.
Norbert Bicher
Mut und Melancholie
Heinrich Böll, Willy Brandt und die SPD
Eine Beziehung in Briefen, Texten, Dokumenten
Heinrich Böll, der am 21. Dezember 2017 hundert Jahre alt geworden wäre, und Willy Brandt sind Ikonen der bundesrepublikanischen Geschichte. Die Dokumentation zeichnet erstmals ihr Verhältnis nach, das von tiefer Sympathie, gegenseitiger Unterstützung und politischer Selbstbehauptung geprägt war.
Johannes Hillje
Propaganda 4.0
Wie rechte Populisten Politik machen
Hat Europa den Rechtspopulismus im Jahr 2017 besiegt? Im Gegenteil, vermeintliche Wahlniederlagen für Wilders, Le Pen oder Petry sind Siege auf anderen Ebenen: Die Ideen der Rechtspopulisten haben sich längst in den Programmen anderer Parteien und in den öffentlichen Debatten ein genistet. AfD & Co sind die Spitzenverdiener der Aufmerksamkeitsökonomie. Ihr Machtfaktor ist die Sprache im Diskurs, nicht der Sitz im Parlament. Selbst maßlos anmutende Äußerungen entpuppen sich als durch und durch strategisch – etwa die Aufnahme von Flüchtlingen als »Völkermord« an den »Biodeutschen« oder »Pressefreiheit andersherum« für die Aussperrung von Journalisten.
eBook
Michael Bröning / Christoph P. Mohr (Hg.)
Flucht, Migration und die Linke in Europa
Wie hält es Europas Linke mit der Migration? Welche Antworten bieten progressive Parteien auf aktuelle Herausforderungen? Welche Schwierigkeiten sehen sie? Welche Rolle spielen Flucht, Migration und Integration für Wählerinnen und Wähler? Was heißt das für politische Parteien und Bewegungen? Darüber schreiben Aydan Özoguz, Wolfgang Merkel, Ahmad Mansour, David Goodhart und viele andere mehr.
Peter Brandt / Detlef Lehnert (Hg.)
Sozialdemokratische Regierungschefs in Deutschland und Österreich
1918–1983
Friedrich Ebert, Philipp Scheidemann, Gustav Bauer, Hermann Müller, Otto Braun, Karl Renner, Willy Brandt, Helmut Schmidt, Bruno Kreisky – im November 2015 wurde den sozialdemokratischen Regierungschefs in Deutschland und Österreich von der Revolution 1918 bis zum Ende der 13 Kanzlerjahre Bruno Kreiskys eine Fachkonferenz der Paul-Löbe-Stiftung gewidmet. Daraus sind neun biografische Beiträge hervorgegangen, die Leben und politische Leistungen erstmals in einer vergleichenden Sammlung behandeln.
Hans-Peter Bartels / Anna Maria Kellner / Uwe Optenhögel (Hg.)
Strategische Autonomie und die Verteidigung Europas
Auf dem Weg zur Europäischen Armee?
Die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) war in den letzten Jahren eines der am meisten vernachlässigten Politikfelder der europäischen Integration. Während die Mitgliedstaaten ihre Verteidigungsausgaben immer und weitgehend unkoordiniert weiter kürzten, nahm die Eurokrise fast die gesamte politische Energie der EU in Anspruch. Erst die radikalen Veränderungen im globalen und regionalen Umfeld, einhergehend mit hybriden Bedrohungen und zunehmend fließenden Grenzen zwischen innerer und äußerer Sicherheit, machten die GSVP wieder zu einem politischen Schwerpunktthema der Europäischen Union. Mit der neuen Globalen Strategie (2016) und ihrem Umsetzungspaket haben die EU-Institutionen auf erstaunlich effektive Weise den Weg für eine europäische Verteidigungsunion und das langfristige Ziel einer europäischen Armee geebnet. Jetzt müssen die Mitgliedstaaten entscheiden, wie sie die gewünschte strategische Autonomie erlangen und gleichzeitig sicherstellen können, dass die Europäische Union ihre Identität als soft power wahrt.
Hans-Peter Bartels / Anna Maria Kellner / Uwe Optenhögel (Hg.)
Strategic Autonomy and the Defence of Europe
On the Road to a European Army?
Over the last decade European Common Security and Defence Policy (CSDP) has been one of the weakest links of European integration. While the member states proceeded with uncoordinated cuts in their defence budgets, Europe’s political energy was almost totally absorbed by the euro crisis. It has taken a radically changing global and regional environment, characterized by hybrid threats and a blurring divide between internal and external security, to make the CSDP a political priority for the European Union again. With the new Global Strategy (2016) and its implementation package, the EU institutions have – remarkably effectively – opened the door to a European Defence Union and eventually – in the long run – a European Army. It is now up to the member states to decide how they want to achieve strategic autonomy, but at the same time ensure that the European Union retains its identity as a soft power.
Lars Tschirschwitz
Kampf um Konsens
Intellektuelle in den Volksparteien der Bundesrepublik Deutschland
Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen – so wird der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt gerne zitiert. Wie politische Pragmatiker und Intellektuelle in CDU und SPD um die großen politischen Streitfragen seit den 1970ern rangen und wer oder was ein Parteiintellektueller ist, erzählt dieses Buch. Der »Kampf um Konsens« ist eine Vorgeschichte der politischen Gegenwart.
Christian Testorf
Ein heißes Eisen
Zur Entstehung des Gesetzes über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer von 1976
Helmut Schmidt nannte sie einen »Meilenstein«, der DGB-Vorsitzende Heinz-Oskar Vetter die größte Enttäuschung seiner Amtszeit. An der Mitbestimmung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Aufsichtsrat schieden und scheiden sich die Geister, hat sie ihre historischen Wurzeln doch in ganz unterschiedlichen Traditionen und Denkrichtungen. Die Kontroversen um die industriellen Beziehungen sind so aktuell wie nie: Neue Formen der Arbeit fordern die Mitbestimmung heraus.
Klaus Schönhoven
Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht
Das Schicksal der 1933 gewählten SPD-Reichstagsabgeordneten
Der Deutsche Reichstag ebnete am 23. März 1933 mit seiner Zustimmung zum Ermächtigungsgesetz dem NS-Regime den Weg zur Alleinherrschaft. Nur die Fraktion der SPD widersetzte sich dieser parlamenta-rischen Weichenstellung zur Diktatur. Mit ihrem mutigen Nein lieferten sich die sozialdemokratischen Abgeordneten der grenzenlosen Rachsucht der Nationalsozialisten aus.
Jo Leinen / Andreas Bummel
Das demokratische Weltparlament
Eine kosmopolitische Vision
In atemberaubendem Tempo schreitet die Verflechtung der Welt voran. Die globalen Herausforderungen unserer Zeit überfordern die Nationalstaaten. Die Menschheit befindet sich in einer entscheidenden Phase – nach der Entstehung der Demokratie in den antiken Stadtstaaten Griechenlands und ihrer Ausweitung auf die modernen Territorialstaaten im 18. Jahrhundert steht nun der nächste Schritt bevor: eine demokratische Weltrevolution und ein Parlament der Menschheit.
Walter Mühlhausen (Hg.)
Friedrich Ebert – Reden als Reichspräsident (1919–1925)
Friedrich Ebert war ein wortgewaltiger Sozialdemokrat, der seinen Aufstieg innerhalb der Arbeiter-bewegung auch seinem Redetalent verdankte. Der vorliegende Band dokumentiert seine sämtlichen überlieferten Reden als Reichspräsident bis zu seinem Tod. Es sind Zeugnisse eines Staatsmannes, der Demokratie und inneren Frieden auf dem brüchigen Grund der Nachkriegs- und Nachrevolutionszeit zu festigen versuchte und die junge Republik mit Sachlichkeit und Ruhe in eine Phase der relativen inneren Stabilität führte.
Christian Kohlross
kollektiv neurotisch
Warum die westlichen Gesellschaften therapiebedürftig sind
Sind die westlichen Gesellschaften neurotisch? Christian Kohlross, psychotherapeutischer Coach und Kulturwissenschaftler, bejaht das und unterzieht sie einer psychologischen Analyse. Längst haben Persönlichkeitsstörungen auch von großen Gruppen und Kulturkreisen Besitz ergriffen. Die alarmierende Diagnose dieses Buchs: Narzissmus, Depression, Zwang und Hysterie sind Symptome einer akuten Kollektivneurose, die Europa und die westliche Welt fest im Griff hat. Am Schluss des Buchs skizziert Christian Kohlross mögliche Wege, diesen destruktiven Seelenlagen politisch und sozial zu begegnen.
eBook
Jo Leinen / Andreas Bummel
Das demokratische Weltparlament
Eine kosmopolitische Vision
In atemberaubendem Tempo schreitet die Verflechtung der Welt voran. Die globalen Herausforderungen unserer Zeit überfordern die Nationalstaaten. Die Menschheit befindet sich in einer entscheidenden Phase – nach der Entstehung der Demokratie in den antiken Stadtstaaten Griechenlands und ihrer Ausweitung auf die modernen Territorialstaaten im 18. Jahrhundert steht nun der nächste Schritt bevor: eine demokratische Weltrevolution und ein Parlament der Menschheit.
eBook
Hilde Krüger
Der Widiwondelwald / Hurleburles Wolkenreise
Ein Bilderbuch aus bunten Dreiecken
Die Erstausgaben der Kinderbücher »Der Widiwondelwald« und »Hurleburles Wolkenreise« erschinen in den Jahren 1924 und 1926 im Verlag J.H.W. Dietz Nachf. Zum 135 Geburtstag des Verlages haben wir diese beiden Schätze mit herrlichen Bildern aus unserem historischen Programm gehoben und in einem Wendebuch neu aufgelegt.
Friedrich-Ebert-Stiftung (Hg.)
Archiv für Sozialgeschichte, Band 56 (2016)
Sozialgeschichte des Kapitalismus
Herausgegeben für die Friedrich-Ebert-Stiftung von: Beatrix Bouvier, Anja Kruke, Philipp Kufferath (geschäftsführend), Friedrich Lenger, Ute Planert, Dietmar Süß, Meik Woyke und Benjamin Ziemann.
Seit der Finanz- und Staatsschuldenkrise von 2008 ist der Kapitalismus wieder in aller Munde. In Krisenzeiten treten globale Abhängigkeiten deutlicher hervor, soziale Ungleichkeit wird als Problem erfahrbar. Leistung, Effizienz und Innovation, Prinzipien kapitalistischen Wirtschaftens, dringen in alle Lebensbereiche vor. Auch für die Geschichtswissenschaft rücken grundlegende Zusammenhänge von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft erneut in den Fokus.
Friedrich-Ebert-Stiftung (Hg.)
Archiv für Sozialgeschichte, Band 55 (2015)
Sozialgeschichte des Todes
Herausgegeben von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Redaktion: Beatrix Bouvier, Anja Kruke, Friedrich Lenger, Ute Planert, Dietmar Süß, Meik Woyke (Schriftleitung) und Benjamin Ziemann
»Gestorben wird immer« heißt es in der vielfach ausgezeichneten Fernsehserie »Six Feet Under« über ein Bestattungsunternehmen in Los Angeles, deren Folgen nie allein vom Sterben, sondern immer auch über die Trauer, den Verlust und die Bewältigungsstrategien der Lebenden erzählen. Auch Historiker und Kulturwissenschaftler haben die umfassende Bedeutung des Themas entdeckt. So wird intensiv über die Frage diskutiert, ob moderne Gesellschaften den Tod verdrängen oder sich vielmehr eine Enttabuisierung des Sterbens feststellen lässt.
Gabriele Metzler / Dirk Schumann
Geschlechter(un)ordnung und Politik in der Weimarer Republik
Weltkrieg und Revolution konnten die Geschlechterordnung in der Weimarer Republik nicht erschüttern, sondern führten zu vielen kleineren Machtverschiebungen, etwa in den Medien oder im Sport. Daraus entstand eine Unübersichtlichkeit der Geschlechter- und Rollenbilder, die sich darauf auswirkte, wie Forderungen nach »männlicher« Führung und weibliche Partizipationsansprüche in zeitgenössischen Diskursen und Körperpraktiken ausgehandelt wurden.
Rena Molho
Der Holocaust der griechischen Juden
Studien zur Geschichte und Erinnerung
Aus dem Griechischen übersetzt von Lulu Bail
Die Historikerin Rena Molho, eine Kapazität auf dem Gebiet der griechischen Holocaustforschung, legt ihre Arbeiten zur systematischen Vernichtung der griechischen Juden mit diesem Buch erstmals auf Deutsch vor. Die Nazis löschten fast 90 Prozent der jüdischen Bevölkerung Griechenlands aus. Dieser Teil der NS-Geschichte, seine Folgen und seine Aufarbeitung sind in Deutschland nahezu unbekannt.
Niklas Frank
Dunkle Seele, Feiges Maul
Wie skandalös und komisch sich die Deutschen beim Entnazifizieren reinwaschen
SPIEGEL-Bestseller 2017 (Paperback Sachbücher)
Platz 15 der Hotlist 2017
Anhand zahlloser Akten erzählt Niklas Frank empörende, aber auch absurd komische Fälle voller Lug und Trug aus der Zeit der Entnazifizierung zwischen 1945 und 1951. Dreist verkauften damals Mitglieder und Nutznießer der NSDAP die Spruchkammern für dumm und retteten sich ohne Reue ins demokratische Deutschland. Frank gewährt uns großartige Einblicke in den giftig-süßen Beginn der bundesdeutschen Demokratie und erschreckende in den Alltag des »Dritten Reichs«. Böse analysiert er, dass ein direkter Weg von damals zum heutigen Verhalten der schweigenden Mehrheit der Deutschen führt. Ein Buch zum Staunen, wütend Werden und zum bitteren Lachen.
Elmar Römpczyk
Estland, Lettland, Litauen
Geschichte, Gegenwart, Identität
Die Geschichte Estlands, Lettlands und Litauens erzählt von jahrhundertelanger Fremdherrschaft und Unterdrückung durch die großen Nachbarstaaten. »Das Baltikum« als politisch-kulturelle Einheit gibt es nicht, trotz fast 50 gemeinsamer Jahre in der UdSSR. Heute sind die drei sehr unterschiedlichen Länder wichtige Teile Europas.
Manfred Blänkner / Axel Bernd Kunze (Hg.)
Rote Fahnen, bunte Bänder
Korporierte Sozialdemokraten von Lassalle bis heute
Wussten Sie es? Bedeutende Sozialdemokraten und Vordenker der sozialen Demokratie waren Mitglieder studentischer Korporationen. Zu ihnen gehörten Ferdinand Lassalle, Wilhelm Liebknecht, Eduard David, Karl Barth, Paul Tillich, Fritz Bauer, Ludwig Bergsträsser, Detlef Carsten Rohwedder. Für sie vertraten SPD und Korporationen ähnliche Überzeugungen: gelebte Solidarität, eine demokratische Diskussionskultur, lebenslange Weggenossenschaft.
Ulrike Guérot
Warum Europa eine Republik werden muss!
Eine politische Utopie
Es ist Zeit, Europa neu zu denken. Weg mit der Brüsseler Trilogie aus Rat, Kommission und Parlament! Die Nationalstaaten pervertieren die europäische Idee und spielen Europas Bürger gegeneinander aus. Europa muss aber heißen: Alle europäischen Bürger haben gleiche politische Rechte. Vernetzt die europäischen Regionen! Schafft ein gemeinsames republikanisches Dach! Wählt einen europäischen Parlamentarismus, der dem Grundsatz der Gewaltenteilung genügt!
eBook
Jutta Limbach
»Wahre Hyänen«
Pauline Staegemann und ihr Kampf um die politische Macht der Frauen
Pauline Staegemann (1838-1909), Sozialdemokratin und Gründerin des ersten Berliner Arbeiterfrauen- und Mädchenvereins, war die Urgroßmutter der ehemaligen Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts Jutta Limbach. Ihre Biografin erzählt, wie sie späteren Frauengenerationen den Weg in Politik und Bildungsinstitutionen ebnete. Die Autorin widmet sich außerdem der Frage, welche Fortschritte das Familienrecht, die Frauenpolitik und die Rechtsgleichheit von Mann und Frau von den 1870er-Jahren bis heute gemacht haben.
Hassan Abu Hanieh / Mohammad Abu Rumman
IS und Al-Qaida
Die Krise der Sunniten und die Rivalität im globalen Dschihad
Aus dem Arabischen übersetzt von Günther Orth
Die jordanischen Islamismus-Experten Mohammad Abu Rumman und Hassan Abu Hanieh beantworten die wichtigsten Fragen nach Unterschieden und Verhältnis zwischen dem sogenannten "Islamischen Staat" und dem Al-Qaida-Netzwerk. Sie gewähren tiefe Einblicke in beide Organisationen und zeigen auf, welche internen Konflikte zur Abspaltung des IS von Al-Qaida sowie zur Entstehung zweier Rivalen im globalen Dschihad geführt haben.
Birgit Lahann
Hochhuth - Der Störenfried
mit Fotografien von Karin Rocholl
Rolf Hochhuth, der Autor des »Stellvertreters«, ist am 13. Mai 2020 im Alter von 89 Jahren gestorben. Birgit Lahann hat wenige Jahre vor seinem Tod die erste Biografie über diesen großen politischen Dramatiker und Schriftsteller geschrieben, mit allem Witz und Wahnsinn, die sein Leben kennzeichnen. Sie erfuhr alles über die Abgründe, die seine Stücke erhellen, über den Irrsinn deutscher Zeitläufte, gegen die er loszog, über Freund und Feind und seine Frauen, für ihn das fünfte Element, über seine manische Kampfeslust und darüber, woher Mut und Kraft kommen, sich zügellos einer Wahrheit zu verschreiben.
Ursula Bitzegeio / Jürgen Mittag / Lars Winterberg (Hg.)
Der politische Mensch
Akteure gesellschaftlicher Partizipation im Übergang zum 21. Jahrhundert
Das Vertrauen in Kompetenz, Verantwortung und Integrität der »politischen Prominenz« in Europa gilt als beschädigt. Der »Wutbürger« nimmt die Dinge selbst in die Hand, demonstriert montags, besetzt Parks und kapert Internetseiten. Die gesellschaftlichen Proteste der letzten Zeit haben in Europa eine Diskussion über neue Varianten der Bürgerbeteiligung ausgelöst und lassen traditionelle Formen politischen Engagements in Vereinen, Verbänden, Parteien und Gewerkschaften in einem neuen Licht erscheinen.
Andreas Zick / Beate Küpper
Wut, Verachtung, Abwertung
Rechtspopulismus in Deutschland
Herausgegeben für die Friedrich-Ebert-Stiftung von Dietmar Molthagen und Ralf Melzer
In Deutschland ist der Rechtspopulismus laut und deutlich geworden: Sichtbar bei den Pegida-Demonstrationen, hörbar in öffentlichen Debatten wie »Deutschland schafft sich ab« und politisch in Verbindungen zur neuen Partei AfD. Man hetzt gegen Muslime und Flüchtlinge, verachtet Politik und Medien, propagiert einen Nationalismus, der zur Abschottung führt, und sehnt sich nach Autorität sowie einer homogenen »Gemeinschaft«. Diese Entwicklung bedroht die gesellschaftliche Vielfalt, das friedliche Zusammenleben und die parlamentarische Demokratie.
Willy Brandt / Helmut Schmidt
Partner und Rivalen
Der Briefwechsel (1958–1992)
Herausgegeben und eingeleitet von Meik Woyke
Das Verhältnis von Brandt und Schmidt gilt als kompliziert und schwierig, weil ihre Sozialisation, ihr Politikstil und Politikverständnis sich deutlich unterschieden. Dennoch verband die beiden führenden Sozialdemokraten neben ihrer Rivalität eine jahrzehntelange Partnerschaft, deren Höhen und Tiefen sich in ihrem Briefwechsel facettenreich widerspiegeln.
Walter Mühlhausen
Friedrich Ebert 1871–1925
A Social Democratic Statesman
Ins Englische übersetzt von Christine Brocks
Brilliante Kurzbiografie in englischer Sprache. Friedrich Ebert (1871–1925) hat als erster Reichspräsident die Politik seiner Zeit ganz wesentlich geprägt. Der Sozialdemokrat nutzte die Gestaltungsmöglichkeiten seines Amtes, um die von Krisen geschüttelte Weimarer Republik zu stabilisieren und innerlich zu befrieden.
Barbara Dröscher
Wer sagt, dass Zwiespalt Schwäche sei?
Das Leben des jungen Wilhelm Dröscher. 1920–1948
Wilhelm Dröscher, der spätere rheinland-pfälzische Landesvorsitzende und Bundesschatzmeister der SPD, fälschte die Heiratsurkunde seiner Großeltern, um seine jüdische Mutter vor den Nazis zu retten und als »Halbjude« mit deutsch-nationaler Gesinnung Wehrmachtsoffizier werden zu können. Anhand von Tagebuchnotizen und Briefen lässt seine Tochter die inneren Kämpfe zwischen Krieg, rassischer Verfolgung und Vaterlandsliebe wiedererstehen.
Andreas Marquet
Friedrich Wilhelm Wagner
1894–1971. Eine politische Biografie
Als 1894 geborenes Arbeiterkind überwand Friedrich Wilhelm Wagner die Schranken einer in Klassen gefangenen Gesellschaft. Er wurde Anwalt, sozialdemokratischer Politiker, überlebte den Nationalsozialismus im Exil, war einer der Väter des Grundgesetzes und trieb in der frühen Bundesrepublik die politische wie juristische Aufarbeitung der NS-Zeit voran.
Franz Magnis-Suseno SJ
Garuda im Aufwind
Das moderne Indonesien
Indonesien ist ein Staat mit 250 Millionen Einwohnern, die meisten von ihnen Muslime. Doch was wissen wir über die Geschichte, Kultur und Politik dieses big player in Südostasien, 2015 Gastland der Frankfurter Buchmesse? Diese leicht verständliche Einführung gibt Antworten. Garuda, das mythische Wappentier des Landes, symbolisiert Indonesiens Aufstieg zur drittgrößten Demokratie der Welt, die im 21. Jahrhundert ihren Weg zwischen Tradition und Moderne sucht.
Peter Brandt / Arthur Schlegelmilch / Martin Kirsch / Werner Daum (Hg.)
Quellen zur europäischen Verfassungsgeschichte im 19. Jahrhundert
Teil 3: 1848–1870
Die CD-ROM setzt eine vierteilige Sammlung von Quellen zur europäischen Verfassungsgeschichte vom späten 18. bis zum frühen 20. Jahrhundert fort. In Verbindung mit elektronischer Schlagwort- und Volltextsuche bietet die CD-ROM zahlreiche Rechercheoptionen in unterschiedlichen Verfassungsbereichen und eröffnet vielfache Möglichkeiten zur Herstellung länderübergreifender Verknüpfungen und Zusammenhänge. Die Gesamtedition sieht sich im Dienste einer integrierten europäischen Verfassungsgeschichtsschreibung.
Knud Andresen / Michaela Kuhnhenne / Jürgen Mittag / Johannes Platz (Hg.)
Der Betrieb als sozialer und politischer Ort
Studien zu Praktiken und Diskursen in den Arbeitswelten des 20. Jahrhunderts
Der Betrieb ist im 20. Jahrhundert ein Ort, an dem soziale und politische Veränderungen auf kleinstem Raum sichtbar werden. Die damit verbundenen innerbetrieblichen Konflikte hatten erhebliche Auswirkung auf die Handlungsfelder und Aktivitäten von Gewerkschaften. Die Gewerkschaftsgeschichte braucht deshalb einen Methodenpluralismus, der verschiedene Aspekte berücksichtigt: die gewerkschaftliche Organisation vor Ort, die praktische Arbeit der Akteure und gesellschaftliche, wissenschaftliche und kulturelle Diskurse im Betrieb.
Mark Blyth
Wie Europa sich kaputtspart
Die gescheiterte Idee der Austeritätspolitik
aus dem Englischen von Boris Vormann
Sparpolitiken sollten Europa aus der Finanzkrise retten, haben aber die Schulden erhöht, ohne Wachstum zu erreichen. Mark Blyth entlarvt Austerität als einen gefährlichen Irrweg im Dienste konservativer Politik und wirtschaftlicher Interessen.
Peter Gohle
Von der SDP-Gründung zur gesamtdeutschen SPD
Die Sozialdemokratie in der DDR und die Deutsche Einheit 1989/90
Als am 7. Oktober 1989 im Gemeindehaus von Schwante bei Oranienburg die Sozialdemokratische Partei der DDR (SDP) gegründet wurde, war dies nicht nur ein Akt der Institutionalisierung oppositioneller Bürgerbewegung: Die wieder gegründete Sozialdemokratie bedeutete einen bewussten und direkten Angriff auf den Machtanspruch der SED, der auf der Fiktion der »Einheit der Arbeiterklasse« fußte.
Birgit Lahann
Am Todespunkt
18 berühmte Dichter und Maler, die sich das Leben nahmen
Selbstmord ist ein gesellschaftliches Tabu, obwohl sich weltweit jedes Jahr Millionen Menschen das Leben nehmen. In 18 biografischen Porträts berühmter Selbstmörderinnen und Selbstmörder hat Birgit Lahann den Weg in das unaufhaltbare Ende ergründet und nachgezeichnet. Es sind geheimnisvolle, spannende und spektakuläre Geschichten, die von Ängsten, Liebe, Todessehnsucht, aber auch von den oft grausamen politischen Zeitumständen des 20. Jahrhunderts handeln.
Stefan Buchen
Die neuen Staatsfeinde
Wie die Helfer syrischer Kriegsflüchtlinge in Deutschland kriminalisiert werden
Menschen, die selbst einmal Flüchtlinge waren, holen ihre Frauen, Kinder und Verwandten aus dem syrischen Krieg illegal nach Deutschland. Dafür behandelt der deutsche Staat sie wie Verbrecher. Die Fluchthelfer – die »Schleuser« – werden von Regierung, Polizei, Justiz und Presse mit Terroristen und Mördern auf eine Stufe gestellt. In dem aktuellen Fall, den Stefan Buchen recherchiert hat, verlieren Behörden und die deutsche Flüchtlings- und Migrationspolitik jedes menschliche Maß.
Michael Schneider
In der Kriegsgesellschaft
Arbeiter und Arbeiterbewegung 1939 bis 1945
Arbeiter hatten für die Kriegsführung des »Dritten Reiches« zentrale Bedeutung. Sie wurden umworben und zugleich reglementiert von der nationalsozialistischen Politik, die sie teilweise mittrugen, aber auch unterliefen, um ihre eigenen Interessen zu verfolgen. Während Millionen von Fremd- und Zwangsarbeitern unter elenden Bedingungen arbeiten mussten, sollten die deutschen Arbeiter und Arbeiterinnen zu leistungswilligen Gliedern der »Volksgemeinschaft« geformt werden.
Benjamin Ziemann
Veteranen der Republik
Kriegserinnerung und demokratische Politik 1918–1933
Die Erinnerung an den Krieg prägte die deutsche Gesellschaft nach 1918. Doch diese Erinnerung war umkämpft. Sozialdemokratische Kriegsveteranen hatten auf diesem Feld eine eigene Stimme. Aus der Perspektive der linken Kriegsveteranen ergeben sich grundlegend neue Einsichten in die historischen Bedingungen für die Stabilität und Zerstörung der Weimarer Republik.
Werner Daum / Wolfgang Kruse / Eva Ochs / Arthur Schlegelmilch (Hg.)
Politische Bewegung und Symbolische Ordnung
Hagener Studien zur Politischen Kulturgeschichte
Festschrift für Peter Brandt
Dieser Band behandelt die Themengebiete »Politische Semantik und Symbolik«, »Erinnerungskultur«, »Verfassungskultur« und »Kultur politisch-sozialer Bewegungen«. Es sind aktuelle Forschungsbeiträge zur Politischen Kulturgeschichte, die sich kulturelle Sinnzusammenhänge und ihre vielfältigen Ausdrucksformen im Kontext politischer Strukturen, Deutungsmuster, Bewegungen und Handlungsformen zum Gegenstand genommen haben.
Thilo Scholle / Jan Schwarz / Ridvan Ciftci (Hg.)
Zwischen Reformismus und Radikalismus
Jungsozialistische Programmatik in Dokumenten und Beschlüssen
Die Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten in der SPD, kurz Jusos, ist die Jugendorganisation der SPD, in der viele Politikerinnen und Politiker der SPD die entscheidenden Momente ihrer politischen Sozialisation erfuhren. In ihrer Programmatik aus fast 100 Jahren spiegeln sich Auseinandersetzungen der politischen Linken insgesamt genauso wider wie Diskussionen innerhalb der Sozialdemokratie.
Dieter Dowe / Anja Kruke / Michael Schneider (Hg.)
Der Deutsche Gewerkschaftsbund 1969–1975
Bearbeitet von Klaus Mertsching
Band 16 der »Quellen zur deutschen Gewerkschaftsgeschichte« dokumentiert den gesellschaftlichen Gestaltungsanspruch des Deutschen Gewerkschaftsbundes in den ersten beiden Perioden der Amtszeit des DGB-Vorsitzenden Heinz Oskar Vetter.
Peter Hübner
Arbeit, Arbeiter und Technik in der DDR
1971 bis 1989
Zwischen Fordismus und digitaler Revolution
Gab es noch eine Arbeiterklasse in der späten DDR? Im Laufe der 1970er- und 1980er-Jahre verloren die ostdeutschen Arbeiter fast unmerklich ihren ursprünglichen Charakter und Zusammenhalt als soziale Formation und gerieten durch die »digitale Revolution« in den Mahlstrom eines technischen Innovationsschubs. Mit dieser Entwicklung der DDR-Gesellschaft bis zum Fall der Mauer beschäftigt sich Band 15 unserer Arbeitergeschichtsreihe.
Antonio Muñoz Sánchez
Von der Franco-Diktatur zur Demokratie
Die Tätigkeit der Friedrich-Ebert-Stiftung in Spanien
Aus dem Spanischen von Friedrich Welsch.
Mit einem Vorwort von Niels Annen
»Wandel durch Annäherung« – so könnte man die Politik der SPD auch in Spanien beschreiben. Seit Mitte der sechziger Jahre nahmen die deutschen Sozialdemokaten Abstand von der sterilen Politik einer Isolierung des Franco-Regimes und schufen ihre eigene pragmatische Strategie, um an der Lösung der »Spanischen Frage« mitwirken zu können. Die Friedrich-Ebert-Stiftung stand im Zentrum dieser Politik und spielte eine wichtige Rolle beim Aufstieg der Sozialisten zur Regierungspartei.
Ernesto Harder
Vordenker der »ethischen Revolution«
Willi Eichler und das Godesberger Programm der SPD
Wer war Willi Eichler? Der »Cheftheoretiker« der deutschen Nachkriegssozialdemokratie stand als geistiger Vater hinter dem Godesberger Programm von 1959, mit dem aus der marxistischen »Klassenpartei« SPD die »Volkspartei« SPD wurde.
Meik Woyke (Hg.)
Wandel des Politischen
Die Bundesrepublik Deutschland während der 1980er Jahre
Für die Spätphase der 'alten' Bundesrepublik, die 1980er Jahre, existieren verschiedene Umschreibungen: »Abschied vom Provisorium«, »Risikogesellschaft«, andere diagnostizierten sogar den Beginn der »Postmoderne«. Auf jeden Fall handelte es sich um eine Phase des beschleunigten politischen, sozioökonomischen und kulturellen Wandels. Etablierte Normen und Deutungsmuster wurden infrage gestellt.
Martin Große Hüttmann / Hans-Georg Wehling (Hg.)
Das Europalexikon
Begriffe. Namen. Institutionen
Die aktualisierte und stark erweiterte Neuauflage des Europalexikons enthält rund 100 neue Begriffe und berücksichtigt die Entwicklungen der vergangenen anderthalb Jahre, insbesondere die Eurokrise, die europäische Außenpolitik und alle personellen Veränderungen.
Niklas Frank
Bruder Norman!
»Mein Vater war ein Naziverbrecher, aber ich liebe ihn.«
Ein mörderischer Dialog unter Brüdern als deutsche Sezierstunde: erschütternd, schonungslos, abgründig. Normans verzweifelte Liebe zum Vater Hans Frank, Hitlers Generalgouverneur in Polen, der in Nürnberg hingerichtet worden ist, lässt seinen Bruder Niklas nicht los. Sie ringen um die Wahrheit von Gefühlen, die Macht der Verdrängung und die Frage: Wie überlebe ich es, das Kind des »Schlächters von Polen« zu sein?
Frank Decker / Marcel Lewandowsky / Marcel Solar
Demokratie ohne Wähler?
Neue Herausforderungen der politischen Partizipation
Die Unzufriedenheit mit den Institutionen der Demokratie wächst. Die Wahlbeteiligung geht auf allen Ebenen zurück, die etablierten Parteien verlieren an Zuspruch und Protestereignisse häufen sich. Gleichzeitig rufen die Bürger nach anderen und besseren Formen der Partizipation.
Erfried Adam
Vom mühsamen Geschäft der Demokratieförderung
Die internationale Entwicklungszusammenarbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung
Mit einem Vorwort von Ernst J. Kerbusch
Demokratieförderung ist das zentrale Arbeitsfeld der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) in Entwicklungsländern.
Band 2 der Reihe blickt hinter die Kulissen, die internen Diskussionen, Entscheidungen und Ergebnisse, Erfolge
und Rückschläge.
Willy Brandt
»Im Zweifel für die Freiheit«
Reden zur sozialdemokratischen und deutschen Geschichte
Herausgegeben und eingeleitet von Klaus Schönhoven
Brandts Reden zur sozialdemokratischen und deutschen Geschichte sind sehr persönliche Beiträge zur Aufklärung der Vergangenheit und eröffnen neue Einblicke in sein Denken.
Philipp B. Bocks
Mehr Demokratie gewagt?
Das Hochschulrahmengesetz und die sozial-liberale Reformpolitik 1969–1976
»Unter den Talaren – Muff von 1000 Jahren« – mit dieser Parole rief die studentische Protestbewegung der 1960er-Jahre zur Demokratisierung der traditionellen Ordinarien-Universität auf. Die Sozialdemokratie und die 1969 gebildete sozial-liberale Regierungskoalition nahmen diese Forderung auf und machten die Hochschulreform zu einem der zentralen Themen ihrer Politik der »Inneren Reformen«.
Jürgen Eckl / Norbert von Hofmann
Kooperation mit Gewerkschaften und Förderung von Wirtschafts- und Sozialentwicklung
Zentrale Tätigkeitsfelder der internationalen Arbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung seit Beginn der 1960er-Jahre
Mit einem Vorwort von Ernst J. Kerbusch
Die internationale Zusammenarbeit mit Gewerkschaften und die Förderung der Wirtschafts- und Sozialentwicklung waren und sind Grundsteine für die internationale Arbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES). In den frühen 1960er-Jahren ging es um die bilaterale Kooperation mit einzelnen Partnern in der Dritten Welt. Heute geht es um die länderübergreifende Reaktion auf globale Herausforderungen – das zentrale Thema der internationalen Politik weltweit.
Werner Daum (Hg.)
Handbuch der europäischen Verfassungsgeschichte im 19. Jahrhundert
Institutionen und Rechtspraxis im gesellschaftlichen Wandel
Band 2: 1815–1847
unter Mitwirkung von Peter Brandt / Martin Kirsch / Arthur Schlegelmilch
Die Periode von Restauration und Vormärz (1815–1847) war in den meisten europäischen Ländern durch den konflikt-reichen Dualismus von Krone und Kammer geprägt. Die 29 Länderbeiträge des zweiten Bandes decken das gesamte Europa mit Russland und dem Osmanischen Reich ab und werden in der Einleitung systematisch-vergleichend zusammengefasst.
Michael Herkendell
Deutschland: Zivil- oder Friedensmacht?
Außen- und sicherheitspolitische Orientierung der SPD im Wandel (1982–2007)
»Die Sicherheit Deutschlands wird auch am Hindukusch verteidigt.« Der berühmte Satz des damaligen Bundesverteidigungsministers Peter Struck im Dezember 2002 war Ausdruck eines neuen außen- und sicherheitspolitischen Selbstverständnisses der SPD. Der Weg dorthin war schwierig. Denn für die meisten Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten waren Auslandseinsätze der Bundeswehr noch Anfang der 1990er-Jahre unvorstellbar.
Frank Fehlberg
Protestantismus und Nationaler Sozialismus
Liberale Theologie und politisches Denken um Friedrich Naumann
Um 1900 wurde er von politisierten evangelischen Theologen als Dritter Weg zwischen Manchester-Kapitalismus und Kommunismus gepriesen: der »Nationale Sozialismus auf christlicher Grundlage«.
Franz Nuscheler
Lern- und Arbeitsbuch Entwicklungspolitik
Die »zur Zeit beste Einführung in die Entwicklungspolitik aus deutscher und internationaler Sicht«. (DIE ZEIT)
Was ist Unterentwicklung? Ist sie Folge des Kolonialismus oder ungerechter Handelsbedingungen? Ist der Nord-Süd-Konflikt bereits zur Leerformel verkommen? Was heißt überhaupt Entwicklung? Was bedeutet »nachhaltige Entwicklung«? Inwieweit gefährden Umweltkrisen unsere natürlichen Lebensgrundlagen? Was heißt »Feminisierung der Armut« oder »globale Strukturpolitik«? Ist die Globalisierung für die Dritte Welt ein Heilsversprechen oder Teufelswerk? Warum wurde die »Entwicklungshilfe« inzwischen als »tödliche Hilfe« verurteilt?
Karin Gille-Linne
Verdeckte Strategien
Herta Gotthelf, Elisabeth Selbert und die Frauenarbeit der SPD 1945-1949
Die SPD-Frauensekretärin Herta Gotthelf bestimmte nach dem Zweiten Weltkrieg den Aufbau und die Ausrichtung der sozialdemokratischen Frauenarbeit. Sie inszenierte die von Elisabeth Selbert angeführte Kampagne zur gesetzlichen Gleichberechtigung.
Peter Rütters / Siegfried Mielke (Hg.)
Der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund 1945–1949/50
Gründung, Organisationsaufbau und Politik
Eingeleitet und bearbeitet von Peter Rütters unter Mitarbeit von Marion Goers
Band 15 der Reihe "Quellen zur Geschichte der deutschen Gewerkschaftsbewegung im 20. Jahrhundert" (hg. von Dieter Dowe, Anja Kruke und Michael Schneider) widmet sich dem Aufbau des FDGB auf Zonenebene, zentralen Gewerkschaftsaktivitäten der Nachkriegsjahre sowie dem Wandel der Ordnungsfunktion der Einheitsgewerkschaft in der Sowjetischen Besatzungszone.
Bernd Rother (Hg.)
Willy Brandt
Neue Fragen, neue Erkenntnisse
Willy Brandt bewegt nach wie vor die historische Forschung. Wie wird seine Politik heute bewertet? Deutsche und internationale Wissenschaftler ziehen eine Zwischenbilanz.
Christoph Kleßmann
Arbeiter im »Arbeiterstaat« DDR
Deutsche Traditionen, sowjetisches Modell, westdeutsches Magnetfeld (1945 bis 1971)
Band 14 der »Geschichte der Arbeiter und der Arbeiterbewegung in Deutschland seit dem Ende des 18. Jahrhunderts« widmet sich den Arbeitern der DDR in der Ära Ulbricht – ein Staat, in dem sie die »führende Klasse« sein sollten. Damit vollendete die DDR im Anspruchsdenken der SED die Tradition der sozialistischen Arbeiterbewegung. Doch wie gingen die Arbeiter mit ihrer Rolle angesichts faktischer Machtlosigkeit um? Wie wichtig war ihre ideologische Stilisierung durch die Staatspartei in sozialer und politischer Hinsicht?
August Bebel
Aus meinem Leben
Die berühmte Autobiographie »Aus meinem Leben« von August Bebel (1840–1913) erschien zwischen 1910 und 1914 in drei Bänden. Die vorliegende, gebundene Ausgabe versammelt alle drei Bände in ungekürzter Fassung. Das von Kautsky verfasste Vorwort zum dritten Band und sein Nachwort sind als Beilagen zugefügt.
Willy Brandt
Gemeinsame Sicherheit
Internationale Beziehungen und deutsche Frage 1982-1992
Bearbeitet von Uwe Mai, Bernd Rother und Wolfgang Schmidt
Bislang unveröffentlichte Dokumente geben profunde Einblicke in das letzte Lebensjahrzehnt Willy Brandts, seinen Einsatz für den Frieden, sein Engagement für das Zusammenwachsen Europas und sein Mitwirken an der Vereinigung Deutschlands.
Heinrich Potthoff / Susanne Miller
Kleine Geschichte der SPD 1848-2002
Die »Kleine Geschichte der SPD« reicht in der jetzt vorliegenden, komplett überarbeiteten 8. Auflage bis in die unmittelbare Gegenwart. Eine Fortschreibung dieser Geschichte der Sozialdemokratie, die längst zu einem Standardwerk geworden ist, war dringend geboten, denn die letzte, 1991 erschienene Ausgabe schloss die Darstellung mit dem Ende der sozialliberalen Koalition.
Dieter Dowe / Kurt Klotzbach (Hg.)
Programmatische Dokumente der deutschen Sozialdemokratie
Die in diesem Band vorgelegten Dokumente spiegeln die Entwicklung der deutschen Sozialdemokratie von einer proletarischen Klassenpartei mit revolutionärem Anspruch zu einer reformorientierten Volkspartei wider.
Dieter Schlesak
Capesius, der Auschwitzapotheker
Viktor Capesius war Apotheker in Schäßburg und Vertreter der Firma Bayer, bevor er als SS-Offizier nach Auschwitz kam. Als eines Tages ein Transport mit Juden aus seiner siebenbürgischen Heimat eintraf, standen sich plötzlich Täter und Opfer, seit Jahren bekannt, an der Rampe des Lagers gegenüber. Capesius schickte sie kaltblütig ins Gas und bereicherte sich an ihrer Habe. Dieter Schlesak schrieb diese wahre Geschichte auf als komplexe Kollage aus Dokumentation, Rückblende und Erzählung: ein historisches Werk, das sich literarischer Mittel bedient, von enormer sprachlicher Kraft und Authentizität, ein erschütterndes zeitgeschichtliches Zeugnis.
Angela Graf / Horst Heidermann / Rüdiger Zimmermann
Empor zum Licht!
125 Jahre Verlag J.H.W. Dietz Nachf.
Seine Geschichte und seine Bücher 1881–2006
Der Verlag J.H.W. Dietz Nachfolger Bonn feiert in diesem Jahr seinen 125. Geburtstag. Unter den politischen Fachverlagen im deutschsprachigen Raum zählt er zu den bekanntesten. Seine ereignisreiche Geschichte ist ein Spiegel der politischen Entwicklung Deutschlands vom Kaiserreich bis zur Wiedervereinigung – und darüber hinaus.
Willy Brandt
Verbrecher und andere Deutsche
Ein Bericht aus Deutschland 1946
Bearbeitet von Einhart Lorenz
Brandts Bericht über den Nürnberger Prozess ist eine Verteidigungsschrift für die große Mehrheit der deutschen Bevölkerung gegen die Vorurteile des Auslands, alle Deutschen seien Nazis. Brandt beschreibt voller Mitgefühl das Leben der Deutschen im harten Winter 1945/46, ihre Zukunftshoffnungen und ihre Visionen. »Forbrytere og andre tyskere« erschien 1946 in Oslo und Stockholm und liegt nun erstmals in deutscher Sprache vor.
Robin M. Allers
Besondere Beziehungen
Deutschland, Norwegen und Europa in der Ära Brandt (1966–1974)
In den schwierigen Beitrittsverhandlungen der Europäischen Gemeinschaft mit Norwegen übernahm die Bundesrepublik die Rolle einer »Treuhänderin« skandinavischer Interessen. Der Band zeigt, wie wichtig bilaterale »Kanäle« im EG-Erweiterungsprozess waren und wie sehr Willy Brandt sich hierbei persönlich für seine »zweite Heimat« Norwegen eingesetzt hat.
Andreas Wilkens (Hg.)
Wir sind auf dem richtigen Weg
Willy Brandt und die europäische Einigung
Ein geeintes Europa war für Willy Brandt eine Herzensangelegenheit. In diesem Band untersuchen Historiker aus sieben Ländern seine prägnante Rolle bei der Einigung Europas und den Wandel, den das Bild der Bundesrepublik durch ihn im Ausland erfahren hat.
Rüdiger Zimmermann
Der Verlag Neue Gesellschaft und seine Bücher 1954-1989
Diese Bibliographie verzeichnet sämtliche Publikationen aus dem »Verlag Neue Gesellschaft«, der 1954 als Ort sozialdemokratischer Neubesinnung ins Leben gerufen und 1989 mit dem Verlag J.H.W. Dietz Nachf. verschmolzen wurde.
Friedhelm Boll / Krzysztof Ruchniewicz (Hg.)
Nie mehr eine Politik über Polen hinweg
Willy Brandt und Polen
Die Aussöhnung mit Polen war für Willy Brandt eine politische und moralische Pflicht. Elf Beiträge polnischer und deutscher Wissenschaftler beleuchten die Ostpolitik des Kanzlers und ihre Wirkungen von 1969 bis zur friedlichen Revolution 1989 aus Sicht der Bundesrepublik, Polens, der DDR, des Vatikans und der Sowjetunion.
Nachrichten der Internationalen Arbeitsgemeinschaft Sozialistischer Parteien (I.A.S.P.).
(Wien 1921-1923). Dt., engl. und franz. Ausgabe
Otto Atzrott
Sozialdemokratische Druckschriften und Vereine.
Verboten aufgrund des Reichsgesetzes gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie vom 21. Okt. 1878
Georg Adler (Hg.)
Hauptwerke des Sozialismus und der Sozialpolitik.
Eine Sammlung grundlegender Schriften zur Gesellschaftskritik
Protokolle der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Deutschlands (1869-1887)
Band I: Eisenach 1869–Coburg 1874
Band II: Gotha 1875–St. Gallen 1887
Bernhard Becker
Geschichte der Arbeiteragitation Ferdinand Lassalle's
Nach authentischen Aktenstücken
Protokoll der Landesversammlungen der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Sachsens (Leipzig 1919-1923).
Einleitung von Hartfrid Krause
Flugblatt vom ständigen Ausschusse des Vereinstages deutscher Arbeitervereine (Frankfurt 1865)
Deutsche Arbeiterhalle (Mannheim 1867-1868)
Einleitung von Shlomo Na'aman
Erhebung von Wirtschaftsrechnungen minderbemittelter Familien im Deutschen Reich
320 Haushaltsrechnungen von Metallarbeitern
Einleitung von Jens Flemming und Peter-Christian Witt
Willy Albrecht (Hg.)
Die SPD unter Kurt Schumacher und Erich Ollenhauer 1946 bis 1963
Sitzungsprotokolle der Spitzengremien
Band 1: 1946-1948
Willy Albrecht (Hg.)
Die SPD unter Kurt Schumacher und Erich Ollenhauer 1946 bis 1963
Sitzungsprotokolle der Spitzengremien
Band 2: 1948–1950
Der vorliegende Band umfasst die Protokolle des Parteivorstandes und der anderen Führungsgremien der SPD vom Parteitag im September 1948 bis zum Parteitag im Mai 1950, d.h. die Zeit der Gründung und beginnenden Westintegration der Bundesrepublik Deutschland.
Christoph Stamm (Hg.)
Die SPD unter Kurt Schumacher und Erich Ollenhauer 1946 bis 1963
Sitzungsprotokolle der Spitzengremien
Band 3: 1950 bis 1952
Der Band umfasst die Protokolle des Parteivorstandes und der anderen Führungsgremien der SPD vom Parteitag im Juni 1950 bis zum Parteitag im September 1952, einer Zeit, die in der Bundesrepublik geprägt war von der Auseinandersetzung um den Kurs der Regierung Adenauer hinsichtlich der Westintegration und der Wiedervereinigung.
Peter Brandt / Martin Kirsch / Arthur Schlegelmilch (Hg.)
Handbuch der europäischen Verfassungsgeschichte im 19. Jahrhundert
Band 1: Um 1800
Band 1 behandelt den Zeitraum von ca. 1770 bis 1815. Nach einem einheitlichen Schema stellen die Autoren dar, wie sich die verfassungsrelevanten Teilbereiche des staatlichen, politischen und gesellschaftlichen Lebens entwickelt haben. Eine ausführliche Einleitung bietet den Leserinnen und Lesern umfassende Vergleiche und Synthesen.
Peter Brandt / Martin Kirsch / Arthur Schlegelmilch (Hg.)
Quellen zur europäischen Verfassungsgeschichte im 19. Jahrhundert.
Teil 1: um 1800
Im Mittelpunkt der ersten CD-ROM (Teil 1: Um 1800) stehen die Zusammenhänge zwischen den sich rasch verändernden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der beginnenden Moderne einerseits, den flankierenden Konstitutionalisierungsexperimenten und staatspolitischen Reformmaßnahmen andererseits. Dabei zeigen sich unterschiedliche Formen der Überlappung ständischer, absolutistischer und konstitutioneller Strukturen, die in ihrer gesamteuropäischen Vielfalt und Einheit (einschließlich Russlands und des Osmanischen Reichs) vorgestellt werden.
Peter Brandt / Werner Daum / Martin Kirsch / Arthur Schlegelmilch (Hg.)
Quellen zur europäischen Verfassungsgeschichte im 19.Jahrhundert
Teil 2: 1815-1847
Vom Wiener Kongress bis zum Vorabend der Revolution von 1848: Teil 2 dieser CD-ROM-Edition beinhaltet die wichtigsten Verfassungen, Gesetze, Verordnungen und Texte aller europäischen Länder im Zeitraum zwischen 1815 und 1847. Sie bildet das Quellenfundament von Band 2 des »Handbuchs der europäischen Verfassungsgeschichte«.
Klaus Schönhoven / Hermann Weber (Hg.)
Der Deutsche Gewerkschaftsbund 1956-1963
Band 12 der »Quellen zur Geschichte der deutschen Gewerkschafts-bewegung im 20. Jahrhundert« konzentriert sich auf die Jahre von 1956 bis 1963. In dieser Zeit schärfte der Deutsche Gewerkschaftsbund sein politisches und programmatisches Profil, öffnete sich für marktwirt-schaftliche Vorstellungen und setzte neue Richtmarken in seinem Engagement für soziale Gerechtigkeit.
Klaus Schönhoven / Hermann Weber (Hg.)
Der Deutsche Gewerkschaftsbund 1964-1969
Quellen zur Geschichte der deutschen Gewerkschaftsbewegung im 20. Jahrhundert, Band 13
Vom grundlegenden Umbruch der Bundesrepublik in den 1960er Jahren – vom Wandel der politischen Kultur über die Bildung der Großen Koalition aus SPD und CDU/CSU bis zur neuen, steuerungsorientierten Wirtschaftspolitik – war der Deutsche Gewerkschaftsbund vielfach betroffen. Wie umfassend der DGB in dieser Zeit seinen Gestaltungsanspruch für Wirtschaft und Gesellschaft wahrnahm, belegen die Dokumente und Materialien dieses Quellenbandes; sie zeigen aber auch die Grenzen seines politischen Einflusses.
Klaus Schönhoven / Hermann Weber (Hg.)
Die Interzonenkonferenzen der deutschen Gewerkschaften 1946–1948
Bearbeitet von Werner Müller
Mit Band 14 der »Quellen zur Geschichte der deutschen Gewerkschaftsbewegung im 20. Jahrhundert« werden zehn Konferenzen der gewerkschaftlichen Dachverbände aus allen vier Besatzungszonen Deutschlands von 1946 bis 1948 dokumentiert. Die Gewerkschafter strebten eine Zusammenarbeit über die Zonengrenzen hinweg an. Die erste dieser gewerkschaftlichen »Interzonenkonferenzen« fand im Juli 1946 in Frankfurt am Main statt.
Bernd Braun
Ich wollte nach oben!
Die Erinnerungen von Hermann Molkenbuhr 1851-1880
Die »Erinnerungen« von Hermann Molkenbuhr (1851–1927) gehören neben denen August Bebels zu den wichtigsten Memoirenwerken der Arbeiterbewegung im Kaiserreich. Sie liefern wertvolle historische Informationen, nicht nur für Fachhistoriker, sondern für alle geschichtlich interessierten Leser – ein lebendig geschriebenes Selbstzeugnis und buntes Zeitporträt aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
Friedrich-Ebert-Stiftung (Hg.)
Archiv für Sozialgeschichte, Band 46 (2006)
Integration und Fragmentierung in der europäischen Stadt
Band 46 des Archivs für Sozialgeschichte ist dem Rahmenthema »Integration und Fragmentierung in der europäischen Stadt« gewidmet. Der Band lebt von der Spannung zwischen geglückter Integration, wie sie z.B. bei den Polen im Ruhrgebiet erreicht wurde und den neuen Konfliktlagen, die in den letzten Jahrzehnten mit den städtischen Problemzonen, Slums, Parallelgesellschaften und Luxussanierungen entstanden. Grundlegende Forschungsberichte zur autonomen Jugendkultur der französischen Banlieues, zur Geschichte des Rassismus und des amerikanischen melting pot runden den Band ab.
Werner Abelshauser
Nach dem Wirtschaftswunder
Der Gewerkschafter, Politiker und Unternehmer Hans Matthöfer
Werner Abelshauser erschließt die Welt eines Mannes, der wie kein zweiter die Praxis des demokratischen Sozialismus verkörpert. Viele der Herausforderungen, die sich Hans Matthöfer stellten, sind noch immer akut, seine Antworten immer noch aktuell. Sein facettenreiches Leben erlaubt es, ein Kapitel der Geschichte der Bundesrepublik aus biographischer Perspektive neu zu schreiben.
Patrik von zur Mühlen
Der »Eisenberger Kreis«
Jugendwiderstand und Verfolgung in der DDR 1953–1958
Gegen Willkür und Misswirtschaft bildete sich im Herbst 1953 im thüringischen Eisenberg eine jugendliche Widerstandsgruppe, die sich 1956 auf die Universität Jena ausdehnte und fast viereinhalb Jahre gegen die SED-Herrschaft opponierte. Nach einer Denunziation wurde sie im Februar 1958 zerschlagen, ihre Angehörigen zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Die Studie ist ein beklemmendes Panorama vom Alltag der deutschen Teilung.
Friedrich-Ebert-Stiftung (Hg.)
Archiv für Sozialgeschichte, Band 48 (2008)
Dekolonisation
Prozesse und Verflechtungen 1945–1990
Band 48 des Archivs für Sozialgeschichte beschäftigt sich mit Emanzipationsprozessen in den »neuen Staaten« in Asien und Afrika und der Verflechtung mit ehemaligen Kolonialreichen. Auf diesem Wege wird das nation building untersucht, ferner werden Formen (post-)kolonialer Gewalt sowie die Rolle internationaler Organisationen (z. B. Vereinte Nationen) in den Blick genommen. Außerdem geht es um die Frage, wie sich die Dekolonisation auf die Kolonialmächte auswirkte und welche Rolle sie für die Entwicklung der Europäischen Gemeinschaft sowie der Neuen Linken spielte.
Friedrich-Ebert-Stiftung (Hg.)
Archiv für Sozialgeschichte, Band 49 (2009)
Gesellschaftsgeschichte Europas als europäische Zeitgeschichte
Band 49 des Archivs für Sozialgeschichte befasst sich mit der europäischen Geschichte seit 1945. Die internationalen Beiträge beleuchten ganz unterschiedliche Aspekte des boomenden Forschungsfelds. Sie beschäftigen sich mit der politischen Geschichte der Europäischen Integration, greifen neuere Konzepte wie Europäisierung und transnationale Ansätze auf, um zu alternativen Sichtweisen auf die europäischen Gesellschaften nach Kriegsende zu gelangen. Dabei geraten gesellschaftliche Prozesse in den Blick, die in der Zeitgeschichtsforschung bislang zu wenig ereignishistorisch betrachtet wurden, so Migration und Rassismus, Konsumgeschichte oder Massentourismus. Auch zur Agrarpolitik, zu den Gewerkschaften oder der Friedensbewegung bietet der Band neue Perspektiven.
Anja Kruke / Dietmar Süß / Meik Woyke (Hg.)
Der Deutsche Gewerkschaftsbund 1975–1982
Bearbeitet von Johannes Platz
Band 17 der »Quellen zur deutschen Gewerkschaftsgeschichte« dokumentiert den fortwährenden gesellschaftlichen Gestaltungsanspruch des Deutschen Gewerkschaftsbundes in den letzten beiden Perioden der Amtszeit des DGB-Vorsitzenden Heinz Oskar Vetter.
Michael Schneider
Unterm Hakenkreuz
Arbeiter und Arbeiterbewegung 1933 bis 1939
Die nationalsozialistische Machtübernahme am 30. Januar 1933 markiert den wohl tiefsten Bruch in der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung: Binnen weniger Wochen wurden die Gewerkschaften aller Richtungen aufgelöst, die Arbeiterparteien verboten und die Kulturbewegung zusammen mit den Genossenschaften »gleichgeschaltet«. Für zwölf Jahre wurde die Arbeiterbewegung in den Untergrund oder ins Exil getrieben.
Bernd Faulenbach
Das sozialdemokratische Jahrzehnt
Von der Reformeuphorie zur neuen Unübersichtlichkeit
Die SPD 1969-1982
Nie hat die SPD im Bund länger regiert, nie die deutsche Gesellschaft intensiver geprägt als in den Jahren von 1969 bis 1982, die als das »sozialdemokratische Jahrzehnt« der alten Bundesrepublik gelten. Der Bochumer Historiker Bernd Faulenbach stellt seine Bilanz der Sozialdemokratie jener Jahre in den Kontext der damaligen politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Auseinandersetzungen.
Peter Brandt
Mit anderen Augen
Versuch über den Politiker und Privatmann Willy Brandt
Willy Brandts ältester Sohn Peter erinnert sich an seinen Vater als Politiker und Privatmann, der noch in den 1980er-Jahren eine der umstrittensten Persönlichkeiten in Deutschland war. Und er schreibt über das »liebevolle, aber nicht ganz einfache Verhältnis zweier sperriger Menschen«.
eBook
Niklas Frank
Bruder Norman!
»Mein Vater war ein Naziverbrecher, aber ich liebe ihn.«
Ein mörderischer Dialog unter Brüdern als deutsche Sezierstunde: erschütternd, schonungslos, abgründig. Normans verzweifelte Liebe zum Vater Hans Frank, Hitlers Generalgouverneur in Polen, der in Nürnberg hingerichtet worden ist, lässt seinen Bruder Niklas nicht los. Sie ringen um die Wahrheit von Gefühlen, die Macht der Verdrängung und die Frage: Wie überlebe ich es, das Kind des »Schlächters von Polen« zu sein?
eBook
Ernst Hillebrand / Anna Maria Kellner (Hg.)
Für ein anderes Europa
Beiträge zu einer notwendigen Debatte
Mit der »Eurokrise« stellt sich die Frage: Wie steht die Europäische Union zu den grundlegenden Werten und Zielen der politischen Linken – Demokratie, Selbstbestimmung, Freiheit und Wohlstand für möglichst viele Menschen? Ist die EU ein emanzipatorisches Instrument der Bürger Europas? Oder ist sie ein Agent ihrer schleichenden Entmündigung?
eBook
Ernst Hillebrand / Anna Maria Kellner (Hg.)
Shaping a different Europe
Contributions to a Critical Debate
In the face of the »euro crisis« the question arises: how does the European Union look in terms of the fundamental values and goals of the political left – democracy, self-determination, freedom and prosperity for as many people as possible? Is the EU an emancipatory instrument for the citizens of Europe? Or is it an agent of their creeping disenfranchisement?
eBook
Rita Brockmann-Wiese
Schluss. Aus. Vorbei!
Wenn nur die Scheidung hilft
Erlebnisse einer Familienanwältin
eBook